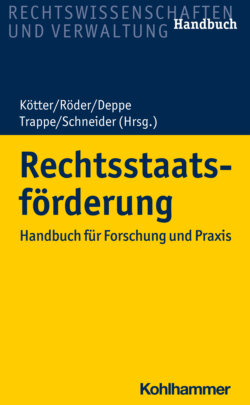Читать книгу Rechtsstaatsförderung - Группа авторов - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II.Universitäre und außeruniversitäre Forschung zur Rechtsstaatsförderung in Deutschland
ОглавлениеBeiträge zur Rechtsstaatsförderungsforschung liefern die Rechtswissenschaften und hier vor allem die empirisch forschenden Subdisziplinen wie die Rechtsethnologie,46 die – thematisch und methodisch breit und im Sinne der internationalen law-and-society-Forschung verstandene – Rechtssoziologie,47 die Politikwissenschaft48 und die Wirtschaftswissenschaften, wobei die meisten relevanten Beiträge aus der politischen Ökonomie oder Wirtschaftssoziologie kommen.49 Jede dieser Disziplinen betrachtet gesellschaftliche Phänomene aus einer spezifischen Perspektive, verfolgt spezifische Forschungsziele und wendet bestimmte Methoden an.
In der empirischen Rechtsforschung finden sich unterschiedliche Zugriffe auf die Entstehung, die Geltung und den Transfer von Rechtsnormen, die auch für die Rechtsstaatsförderung relevant sind. Einen immensen Materialfundus für den theoriegeleiteten Zugang zu diesen Themen bietet auch die Rechtsgeschichte.50 Seit einigen Jahren gewinnt zudem das Themenfeld Recht und Entwicklung im deutschsprachigen Raum an Bedeutung, wobei aus juristisch geprägter Perspektive an die internationalen Law and Development-Forschungen angeknüpft wird.51 Weitere sozialwissenschaftliche Forschung beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen Bedingungen von Rechtsstaatlichkeit und RSF sowie den Problemen, die externe Intervention aufwerfen können.52 Fragen hinsichtlich des sozialen, ökonomischen und kulturellen Kontexts einer RSF-Maßnahme finden in der regionalwissenschaftlichen, soziologischen oder anthropologischen Forschung Anknüpfungspunkte.
Thematisch behandeln diese meist interdisziplinär durchgeführten Forschungen verschiedene Formen von Recht und deren rechtskulturelle Prägung – wie das parlamentarische Gesetz, die Rechtsschulen des Islam oder das Gewohnheitsrecht – und die Bedingungen ihrer Entstehung und Geltung.53 Ein zweites Forschungsfeld betrifft informelle Rechtssysteme und Rechtspluralismus sowie die damit verbundenen Geltungskollisionen (§ 8 A.), die bis auf die Zeit des Kolonialismus zurückreichen.54 Besonderes Interesse der RSF besteht hierbei – mit Blick auf die meist von erheblicher sozialer, politischer und rechtlicher Pluralität geprägten Kontexte – an der Möglichkeit der Verkopplung von Rechtsordnungen und Kollisionsregimen.55 Drittens lassen sich die der RSF zugrunde liegenden Wirkungsannahmen mit Blick auf rechtsempirische,56 aber auch rechtsvergleichende Forschungen zum Institutionen- und insb. zum Rechtstransfer beurteilen (§ 8 B.). Diese beruhen auf unterschiedlichen Begriffen und Modellen wie Diffusion, kulturelle Übersetzung oder Rezeption.57
Hinsichtlich der Akteure der RSF-Forschung sind einzelne Wissenschaftler:innen zu nennen, die über längere Zeiträume zur Entwicklungspolitik geforscht und dabei auch RSF betreffende Fragen aufgeworfen haben, etwa Brun-Otto Bryde im Öffentlichen Recht und der Rechtssoziologie,58 oder der Zivilrechtler Rolf Knieper, der in vielen Projekten der rechtlichen Zusammenarbeit praktisch tätig war.59
Dauerhafte Forschung wird durch institutionell geförderte Einrichtungen sichergestellt, die sich auf Themen spezialisiert haben, welche die Probleme der RSF besonders berühren: bspw. die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer, die rechtsbezogenen Max-Planck-Institute,60 die Ostrecht-Institute oder die Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main. Dazu kommt vernetzte und interdisziplinär koordinierte Forschung in größeren Forschungszentren oder projektfinanzierter Verbundforschung wie dem von 2006 bis 2017 an der Freien Universität Berlin angesiedelten DFG-Sonderforschungsbereich 700 „Governance in Räumen begrenzter Staatlichkeit“ oder dem Frankfurter Exzellenzcluster „Normative Orders“. Hinzu kommen universitätseigene Einrichtungen wie das Law & Society Institute an der Humboldt-Universität zu Berlin, das Zentrum für Entwicklungsforschung an der Universität Bonn oder das Bremer Zentrum für Europäische Rechtspolitik. Länderspezifisches Wissen gewährleisten auch Fachgesellschaften, die sich einzelnen Regionen widmen und häufig aus interdisziplinären Teams bestehen. Beispiele stellen die Gesellschaft für Afrikanisches Recht oder die Gesellschaft für Arabisches und Islamisches Recht dar.