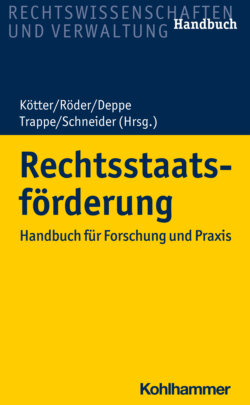Читать книгу Rechtsstaatsförderung - Группа авторов - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV.Rechtsstaatsförderungsforschung als eigenständiger Wissensbestand
ОглавлениеRechtsstaatsförderungsforschung kann zur Fundierung eines eigenständigen Wissensbestands dienen, der das von der Praxis erhobene und verarbeitete Wissen über Kontexte, Instrumente und Wirkungsweisen (§ 14 A.) mit korrespondierendem Forschungswissen verknüpft und für beide Seiten anschlussfähig macht. Das Wissen ist hierbei in einer für die Anwendung durch die Praxis geeigneten Weise aufbereitet. Die Irritation durch die Wissenschaft kann der Praxis den Anschub dazu geben, einen bewährten Ansatz zu überdenken. Zugleich hat sich ein theoretischer Zugriff dem Praxistest zu stellen, was ebenfalls mit Irritation verbunden ist. Herausforderungen, die sich beim Wissensaustausch zwischen der Forschung, der Politik und der Durchführungspraxis ergeben, sind denen nicht unähnlich, die bei Rechtsstaatsförderprojekten zwischen der Geber- und Empfängerseite entstehen, und die in der wissenschaftlichen Politikberatung typischerweise auftreten.64
Die Praxis hat direkten Zugang zum Feld und verfügt damit über umfangreiches empirisches Wissen. Jedoch hat sie strukturelle Schwierigkeiten, dieses Wissen zu verallgemeinern, zu speichern und über Projekt- und Politikzyklen hinweg verfügbar zu machen. Außerdem ist theoriebasiertes Forschungswissen zumeist nicht unmittelbar an die Praxisfragen anschlussfähig und besitzt für deren Bedürfnisse wenig Relevanz. Dies hat mehrere Gründe: Das Problemlösungsinteresse der Praxis ist einzelfallbezogen, während die Wissenschaft ein auf allgemeine Aussagen abzielendes Erkenntnisinteresse verfolgt, das durch den jeweiligen fachspezifischen Theoriebezug geprägt ist. Der Einzelfall dient dabei in erster Linie als Material für die Theorieentwicklung. Weiterhin stellt die Forschung, solange es sich nicht um Auftrags- oder Anwendungsforschung handelt, kein passgenaues „Entscheidungswissen“ bereit, sondern betrachtet die Wirklichkeit aus einer Vielzahl an Perspektiven. Das kann auch zu Erkenntnissen führen, die politisch unerwünscht sind, wenn etwa die Ziele und Methoden der RSF hinterfragt und zum Gegenstand grundsätzlicher Kritik werden.65 Dazu kommen kulturelle Differenzen zwischen Praxis und Forschung, etwa „training, professional identity, and career incentives“.66 Forscher:innen arbeiten meist langfristig an Themen, während Ministerialbeamt:innen häufiger den Posten wechseln und Praktiker:innen im Feld schon beim nächsten Projekt sind. Dies erschwert den oftmals personenbezogen Wissensaustausch. Kurzfristige Begegnungen, die in keinem systematischen Gesprächszusammenhang stehen, bleiben oft flüchtig und ohne nachhaltigen Effekt. Das gilt bspw. für Vorträge, Beratungsgespräche und Policy-Papiere zu Einzelfragen, die nicht in einem größeren politischen Zusammenhang erörtert werden und so Erklärungen für die Ineffektivität einer politischen Praxis liefern, ohne dass es zur gemeinsamen Reflexion über deren strukturelle Ursachen und zielgerichtete Veränderung käme. Selbst größere und mit erheblichem Mittelaufwand ermöglichte Veranstaltungen bleiben oft ohne konkrete Nachwirkung.
Trotz dieser strukturellen Probleme erscheint die systematische Verknüpfung von Theorie und Praxis sinnvoll. Die Wissenschaft kann zur Systematisierung des Praxiswissens beitragen, sie kann Forschungslücken sichtbar machen und Maßstäbe für die Qualitätssicherung liefern. Vorüberlegungen in einer theoretischen Literatur können es ermöglichen, Probleme der Praxis als Forschungsfragen zu reformulieren und mithilfe wissenschaftlicher Methodik zu bearbeiten. Dies setzt einen nachhaltigen Wissensaustausch zwischen der politischen und der Durchführungspraxis sowie der Forschung über RSF-Fragen voraus.
Der effektive Wissensaustausch zwischen Praxis und Forschung erfordert geeignete Begegnungsräume und Austauschformate, welche die Übersetzung und Reformulierung der Fragen zwischen den Handlungssystemen ermöglichen. Dazu bedarf es dauerhafter Forschungsstrukturen über mittel- bis längerfristig angelegte Kooperationen, Austausche und Einbettungen. Diese Strukturen sind auf Vertrauensnetzwerke und die Kenntnis der lokalen Besonderheiten angewiesen und benötigen Informations-, Feedback- und Gesprächskanäle. Geeignete Formate sind etwa Beiräte, Gesprächskreise, Vortragsreihen, Expert:innen- und Literaturdatenbanken, Newsletter oder Social-Media-Kanäle.
Im Rahmen der Wissenschaftskooperationen, die das Auswärtige Amt mit mehreren Universitäten und nicht-universitären Forschungseinrichtungen pflegt – zu denen der 2017 an der Freien Universität Berlin eingerichtete RSF Hub67 zählt, der wesentlich an der Vorbereitung dieses Handbuchs mitgewirkt hat – hat sich gezeigt, wie effektiv die längerfristige Einbettung von Wissenschaftler:innen in den Bereich der politischen Praxis ist, wo sie in der Rolle von Intermediären fungieren und die zwischen Wissenschaft und Praxis unabdingbaren Übersetzungsleistungen erbringen. Ein anderes Mittel sind interdisziplinär oder plural besetzte Forschungs- oder Entscheidungsteams, die projektbezogen einen längerfristigen Austausch ermöglichen.
Doch gerade die Einbettung von Personen ist auch in umgekehrter Richtung denkbar. So können Sabbaticals und Forschungsstipendien an wissenschaftlichen Einrichtungen Praktiker:innen eine temporäre Betätigung in der Wissenschaft ermöglichen. Dort können diese ihre Arbeiten einem wissenschaftlichen Kolleg:innenkreis präsentieren und wissenschaftlich fundierte Kritik erfahren. Dies bewirkt, dass empirisches Wissen systematisch vermehrt aufbereitet und publiziert wird. Damit langfristig hochqualifiziertes Personal zur Verfügung steht, bietet es sich auch an, praxisrelevante Themen für Forschungsarbeiten zu vergeben. Erforderlich ist in jedem Fall eine enge und langfristige Verbindung von Wissenschaftler:innen und Praktiker:innen in der Politik und den Organisationen vor Ort.