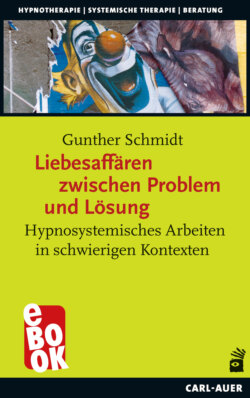Читать книгу Liebesaffären zwischen Problem und Lösung - Gunther Schmidt - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Definition „Therapie“ und „Beratung“
ОглавлениеIch verwende deshalb in diesem Buch auch immer die Begriffe „Therapie“ und „Beratung“ nebeneinander. Die jeweiligen Bezeichnungen für eine entsprechende Kooperation stellen aus systemischkonstruktivistischer Sicht immer nur Realitätskonstruktionen dar, keine Wahrheiten. Es ergibt deshalb auch keinen Sinn, sie genau abgrenzen zu wollen mit Beschreibungen aus sich selbst heraus (z. B. „Im Gegensatz zu Beratung ist Therapie …“). Geprüft werden sollte immer, welche Etikettierung („Therapie“, „Beratung“, „Coaching“, „begleitende Supervision“, „unterstützende Familiengespräche“ oder was auch immer) die Kooperation optimal unterstützen würde. Die Begriffe sind also zieldienlich zu gebrauchen. Deshalb werde ich in dieser Einführung der Einfachheit halber nur noch von „Therapeuten“ und „Therapeutinnen“ reden.
Der Begriff „Therapie“ z. B. müsste dann aber, wie die hier ausführlich zu diskutierenden Ideen der Aufmerksamkeitsfokussierung zeigen, jeweils sehr kritisch behandelt werden. Denn üblicherweise assoziieren die meisten Menschen in unserer Kultur damit auch, dass jemand, der in Therapie geht, irgendwie durch Defizite oder Pathologie gekennzeichnet ist. Dies stellt aus der hier vertretenen Sicht natürlich keine Wahrheit, wohl aber eine sehr wirksame Realitätskonstruktion dar, die solche Realitäten mit schafft, welche sie dann wieder auflösen will.
Bei der jeweiligen Begriffswahl sind natürlich auch wichtige Kontextfaktoren zu beachten; soll z. B. die Krankenkasse eine jeweilige Kooperation als bezahlungspflichtig akzeptieren, muss sie „Psychotherapie“ genannt werden, und deren Kontraktbedingungen sind zu beachten. Die möglicherweise inhaltlich gleichen Interaktionen der Kooperationspartner würden in einem beruflichen Kontext vielleicht eher als „Coaching“ bezeichnet. Gemeint ist hier in allen Fällen, mit denen wir uns beschäftigen, die Kooperation zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern (unter Berücksichtigung der für beide Seiten relevanten Kontextbedingungen). Diese sollte sich orientieren an den Aufträgen und Zielvorstellungen, welche die Auftraggeber einbringen, aber auch andere eventuell wichtige Auftraggeber (wie z. B. Gesetzgeber, Rentenversicherer) und ihre Ziele müssen beachtet werden, ebenso die eigenen ethischen Werte der Therapeuten. Dann sollte mit den direkten Auftraggebern differenziert ausgehandelt werden, welche Ziele und Schritte dahin in einer Kooperation sinnvoll sein könnten. Zentral dabei sollte sein, dass man sich gemeinsam nur an Zielen orientiert, die mit der erlebbaren Eigenkompetenz der Beteiligten realisierbar sind (sonst trägt die Kooperation zum Erleben von Insuffizienz und Versagen bei). Jeder Schritt in dieser Kooperation sollte wieder auf seine Wechselwirkungen hin mit allen von den direkt Beteiligten als relevant angesehenen Kontextfaktoren geprüft werden, und von dort aus sollten wieder die nächsten Schritte gemeinsam abgestimmt werden.
Auch die immer einflussreicher werdenden Konzepte der Autopoiese (Maturana 1982; Maturana u. Varela 1987) verstärkten die beschriebenen Haltungsänderungen intensiv. Die Erkenntnisse aus der biologischen Erforschung von Wahrnehmungsprozessen und der Selbstorganisation lebender Systeme zeigen, dass lebende Systeme ihre Wahrnehmung als innere, autonom selbst organisierte Prozesse gestalten, also von außen zu keinem Erleben gezwungen werden können. Ebenso machen sie deutlich, dass jede Beschreibung, die z. B. ein Mensch macht, nicht abbildet, wie es „da draußen wirklich ist“, sondern seine Entwürfe des „da draußen“ abbildet. („Alles, was gesagt wird, wird von einem Beobachter gesagt.“) Auch dies weist auf die Problematik von Diagnosen hin, die besonders dann keinen Sinn mehr haben, wenn sie behaupten, sie würden beschreiben, wie das Beobachtete „ist“. Sie beschreiben vielmehr die Prozesse des Beobachters.
Eine weitere wichtige Konsequenz der Autopoiesekonzepte war für uns, dass die Vorstellungen der frühen systemischen Arbeit, nämlich dass der Kontext so zentral sei, dass er praktisch das Erleben der Beteiligten darin bestimme, deutlich relativiert werden mussten. Wenn es keine „instruktiven Interaktionen“ gibt (also Interaktionen, die Beteiligte zu einem bestimmten Erleben oder Verhalten zwingen können), ist der Kontext als einladende Umwelt zwar wichtig, aber es bleibt viel Raum für die autonome Antwort des Individuums darauf. Die Autopoiese brachte also das Individuum wieder viel mehr in den Fokus unserer Aufmerksamkeit. Folgerichtig wurden unsere Angebote wieder viel flexibler, es musste nicht mehr die ganze Familie kommen, systemisch orientierte Einzeltherapie wurde ein immer häufiger als sehr sinnvoll angesehenes Instrument. In dieser Phase unserer Arbeit – und aus meiner Sicht ist das bis heute in vielen Anwendungsfeldern systemischer Arbeit so – wurden zentrale Implikationen der Autopoiesetheorie nicht genügend genutzt, z. B. die systematische Betrachtung und Beeinflussung der autopoietisch produzierten Wahrnehmungsprozesse (sowohl der zu Problemen beitragenden als auch der lösungsförderlichen). Diese Implikationen konsequent zu beachten und daraus Interventionshilfen herzuleiten stellt sich, wie ich weiter unten zeigen will, der hypnosystemische Ansatz als eine zentrale Aufgabe.
Ebenfalls sehr hilfreich war dafür z. B. die Idee des „problemdeterminierten Systems“ (Anderson a. Goolishian 1988). Die Goolishian-Gruppe schlug damit vor, die Entstehung und Aufrechterhaltung von Problemen nicht mehr als Hinweis auf grundsätzliche Dysfunktionalitäten der Familien anzusehen. Vielmehr könne man auch sagen, dass Phänomene, die später „Problem“ genannt werden, einfach auftreten können, manchmal vielleicht sogar durch Zufall (oder durch eine unglückliche Verkettung von Ereignissen, die etwa zu einem Unfall führen, etc.). Als Reaktion darauf bilden sich dann Interaktionen um das Phänomen herum, es werden Kommunikationsakte gebildet, die das Phänomen sogar zu lösen versuchen, aber (sogar ungewollt) bewirken, dass das Phänomen aufrechterhalten oder gar verstärkt wird. So gesehen, bildet sich quasi um das Problemphänomen herum ein System (System hier verstanden als Geflecht von Wechselwirkungen in Beziehungen, nicht unbedingt als die Familie), redundante Muster führen immer wieder den Prozessen, die als „Problem“ erlebt werden, Energie zu.
Mit dieser Sicht vom „problemdeterminierten System“ konnte nun diese quasi detektivische, teilweise Misstrauen auslösende Sicht auf Familien aufgegeben werden. Man musste nicht mehr befürchten, dass die Familien mit vehementer Kraft versuchen wollten, ihre dysfunktionalen, die Symptome funktionalisierenden Homöostasemuster aufrechtzuerhalten. Pragmatisch gelassen konnte man nun zusammen mit den Beteiligten schauen, welche Muster eventuell, sogar ungewollt, als Beiträge zur Aufrechterhaltung des Unerwünschten (des „Problems“) wirkten, und gemeinsam überlegen, welche Unterschiede im Verhalten, in der Beschreibung und Bewertung etc. das Problem auflösen könnten. Dieses Vorgehen ermöglichte viel mehr praktizierte Wertschätzung der Klientensysteme, als uns das früher möglich war. Auch konnte endlich wieder den am Problem Leidenden viel mehr Empathie entgegengebracht werden, ein Umstand, der mir in unserer früheren Arbeit sehr gefehlt hatte. Allerdings empfand ich auch diese Entwicklung als noch viel zu sehr fokussierend auf die Erlebnisbereiche der „Problemwelt“. Solche Fokussierungen können aber wieder eventuell genau eine Organisation der Wahrnehmung bewirken, die dem Problemerleben Energie zuführt. Ich werde diese Bedenken in meinen weiteren Überlegungen ausführlicher begründen.
Auch weitere Entwicklungen im systemischen Feld, wie z. B. das Konzept des „Reflektierenden Teams“ (Andersen 1990) und die „narrativen Verfahren“ brachten aus meiner Sicht wichtige Fortschritte hin zu einer mehr gleichrangig-achtungsvollen Gestaltung der Beziehung zwischen Klientensystemen und Therapeuten. Beim Reflektierenden Team wurde mehr und mehr auf die Schlussinterventionen im Sinne des Mailänder Modells verzichtet, die Beobachter werden am Ende der Sitzung von den Klientensystemen dabei beobachtet, wenn sie ihre Beobachtungen und Kommentare dazu austauschen. Diese Angebote werden dann ganz in Selbstorganisation von den Klientensystemen „weiterverarbeitet“. So wird ihre Autonomie und ihre Eigenkompetenz von vornherein mehr rituell geachtet, die Interventionen der Therapeuten werden nicht mehr quasi „von oben herab“ an sie übermittelt, die Klientensysteme selbst werden mehr als Experten für ihr Leben gewürdigt. Allerdings erlebte ich viele Sitzungen nach dem Modell des Reflektierenden Teams als sehr komplexitätserhöhend für die Beteiligten, die Vielfalt der Angebote bewirkte eine sehr breite „Streuwirkung“, die aus meiner Sicht viele Chancen für eine kraftvolle, lösungsförderliche Fokussierung ungenutzt lässt.
Die 1990er-Jahre brachten eine intensive Auseinandersetzung mit narrativen Verfahren und ihre Nutzung in der systemischen Therapie. Jetzt wurde mit ihnen der Blick nicht mehr so sehr auf die strukturelle Organisation der Beziehungssysteme gerichtet, sondern darauf, welche „Geschichten“ die Menschen über sich, ihr Leben, die Welt im Allgemeinen, über ihre Möglichkeiten etc. entwerfen und sich dann mit ihnen so identifizieren und sich an ihnen so intensiv orientieren, dass sie zu ihrer subjektiven „Wahrheit“ (also zur wirksamen Wirklichkeitskonstruktion) werden. Probleme und Symptome werden damit gesehen als Ergebnis von Geschichten, die den Betroffenen den Blick auf andere, grundsätzlich mögliche, hilfreichere Geschichten und Entwicklungen verstellen. Die Arbeit in der Therapie oder Beratung konzentriert sich dann darauf, zusammen mit den „Autoren“ durch den Blick auf Lebensereignisse, die andere, hilfreichere „Geschichten“ unterstützen würden, die Geschichten entsprechend umzuschreiben.
Mit den narrativen Verfahren rückte aus meiner Sicht in sehr günstiger Weise noch mehr in den Blick, wie Menschen in autonomer Selbstorganisation (aus hypnosystemischer Sicht würde ich sagen: „in selbsthypnotischer Weise“) ihr Erleben konstruieren und aufrechterhalten. Auch kann mit ihnen intensiv die autonome Autorenkompetenz der Klientensysteme gewürdigt und so eine gleichrangigere Beziehung zwischen Therapeuten und Klienten weiter ausgebaut werden. Wichtige Vertreter dieses Ansatzes wie z. B. H. Goolishian führten ihn aber zu Schlussfolgerungen hinsichtlich der Rolle der Therapeuten, die aus meiner Sicht in ungünstiger Weise das alte Modell der professionellen Experten, die strategisch und sehr raffiniert Interventionen konstruieren, welche die dysfunktionalen Muster „knacken“ sollen, in Schwarz-Weiß bzw. Entweder-oder-Manier einfach nur umdrehten, auf den Kopf stellten. Sie wollten nun nur noch mit „grenzenloser Neugier“ aus einer Haltung des „Nichtwissens“ heraus die Geschichtsentwürfe der Klienten staunend kennen lernen und die eigentlichen Autorenexperten zur Entwicklung neuer Geschichten anregen (Anderson u. Goolishian 1992a). Diese Haltung drückt meines Erachtens viele wertvolle Aspekte aus, z. B. eine gewisse achtungsvolle Demut den autonomen Klienten gegenüber, auch ausgeprägte Toleranz gegenüber anderer als den eigenen „Geschichten“. Aus meiner Sicht spielt sie aber die Kompetenz und die Bedeutungsmöglichkeiten der Therapeuten so herunter, dass ihre Kompetenz, Erfahrung und auch Expertenwissen im Dienste der Klienten oft zu wenig genutzt wird. Ich erinnere mich gut daran, wie Goolishian als Gastreferent bei uns Anfang der 1990er-Jahre in Heidelberg Familien auf der Basis dieses Ansatzes interviewte. Ich und andere Kollegen erlebten dies als eher dahinplätschernden Smalltalk mit den Familien, eher als Gespräche mit Bekannten im Café, ohne klare Fokussierung auf die Anliegen der Familien (die ja immerhin derentwegen gekommen waren, und nicht, um sich gemütlich mal so zu unterhalten). Die Wirkungen, die wir danach von den Familien berichtet bekamen, waren auch eher vernachlässigbar. Meiner Meinung nach wurde so eine sehr bedeutsame und sehr hilfreiche Grundidee für therapeutische Kontexte viel weniger genutzt, als es möglich gewesen wäre.