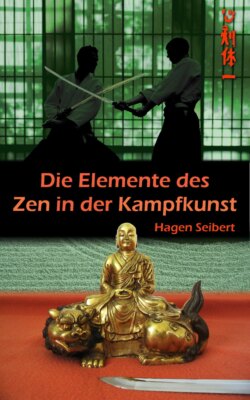Читать книгу Die Elemente des Zen in der Kampfkunst - Hagen Seibert - Страница 11
Chôryoku - Spannung
ОглавлениеMit Atmung und Haltung einher geht eine gewisse Spannung. Sie kann sowohl körperlich wie geistig sein. Die Haltung erhöht sie tendenziell, die Atmung baut sie ab. Hier muss man ein gutes Maß finden zwischen zerstreut – konzentriert – angespannt.
An der Handhaltung während des Zazen lässt sich gut ablesen, ob man gerade mit der richtigen geistigen Spannung Zazen übt. Die Hände werden so ineinandergelegt, dass die Finger der rechten Hand auf den Fingern der linken Hand liegen. Die angehobenen Daumen werden so gehalten, dass sie sich an den Spitzen leicht berühren. Im Idealfall, während der korrekten Übung, sollte sich zwischen Daumen und Zeigefinger eine ovale Öffnung ergeben.
Man kann aber gelegentlich bei sich selber oder anderen feststellen, dass man gerade die Daumen stark aneinander presst. Das ist ein Zeichen, dass jemand gerade sehr angespannt und angestrengt in seiner Übung ist und sich verbissen denkt: „Ich muss mich konzentrieren!“
Oder man bemerkt, dass man die Daumen herabhängen lässt, bis vielleicht sogar der Kontakt der Daumenspitzen verloren ging. Das ist ein untrügliches Anzeichen, dass jemand gerade seinen Gedanken nachhängt und vor sich hin träumt.
In beiden Fällen stimmt die Spannung nicht, und somit ist die Haltung nicht korrekt und die Konzentration verloren.
Ein anderes Beispiel ist die Situation, einen Vortrag zu halten. Zu Beginn hat der Vortragende vielleicht Lampenfieber, die Spannung ist hoch, er verhaspelt sich. Später erlahmt die Spannung, der Redefluss wird eintönig.
Aus dem Zusammenhang Spannung – Atmung – Haltung lässt sich ein allgemeiner Rat ableiten: Merkt man, dass die eigenen Nerven gerade bis zum Zerreißen gespannt sind, atmet man die Spannung aus. Stellt man bei sich fest, dass die Konzentration nachlässt, nimmt man als Erstes Haltung an.
In der Kampfkunst hat Spannung eine noch viel größere Bedeutung als in der Zazen-Übung, da man sich dynamisch bewegt statt statisch zu sitzen. Die geistige Spannung entscheidet über Sieg oder Niederlage. Die Körperspannung ist fundamental für jede Bewegung. (Eine digitale Unterscheidung zwischen körperlicher und geistiger Spannung soll jedoch an dieser Stelle nicht vorgenommen werden, denn beides hängt zusammen.)
Prinzipiell ist Körperspannung die Kontraktion gegenläufiger Muskeln. Eine hohe Muskelspannung ist dann notwendig, wenn man einer gegnerischen Kraft entgegenwirken muss, zum Beispiel in einem Haltegriff, wenn der Gegner fixiert werden soll, oder zum Beispiel bei einem Block, wenn der Arm den eigenen Kopf schützen soll. Der Arm soll starr bleiben.
Körperspannung bedeutet Unbeweglichkeit, das ist gelegentlich erwünscht. Sie kann aber auch von Nachteil sein, nämlich dann, wenn man die Spannung nicht wieder gänzlich loslässt. Will man sich bewegen, ist es schlecht, wenn man gegen die eigene Körperspannung arbeiten muss. Wenn sich der eine Muskel gegen die Spannung seines Antagonisten bewegt, muss er erst dessen Kraft überwinden. Bewegungen werden dadurch langsam. Das ist wie Fahren mit angezogener Handbremse.
Als Karate-ka trainiert man, eine Schlagbewegung möglichst ansatzlos auszuführen. Ein schneller Fauststoß ist aber nur möglich, wenn man geübt ist, seine Muskulatur vollständig zu entspannen.
Als Aikidô-ka sollte man versuchen, locker zu bleiben, auch wenn man mit Spannung angegriffen wird. Man muss selber gelöst bleiben, um anpassungsfähig an die Dynamik des Geschehens zu sein. Wenn man dann den Angriff aufnimmt, ist das Entspannt-Bleiben essentiell für die gelungene Ausführung der darauffolgenden Technik. Eine gute Hilfe, um nicht in Anspannung zu verfallen, ist sich vorzustellen, dass man sich angreifen lässt, anstatt bei dem Gedanken zu verbleiben, dass man angegriffen wird. Das heißt, den Angriff aufzunehmen in einem Bewusstsein von „Ich lasse mich greifen“; es heißt, ihn zu akzeptieren, anstatt ihn abzuwehren.
Lächelt man jemanden an, so lächelt er meistens zurück. Wenn man bei anderen Begeisterung spürt, zum Beispiel bei einem Sportereignis, oder einem Konzert, so lässt man sich anstecken. Begegnet man jemandem unfreundlich, so wird er mit Unfreundlichkeit antworten. Es gibt eine natürliche menschliche Regung, einen Gleichklang zum jeweiligen Gegenüber herzustellen. Dies gilt für Gefühle und Stimmungslagen, und es gilt auch für den Grad der körperlichen Anspannung.
Körperspannung kann übertragen werden, sogar unbewusst, durch Berührung, über körperlichen Kontakt. Ein Gegner kann meine Spannung spüren, zum Beispiel wenn ich ihn am Handgelenk oder an der Schulter fasse und nimmt dann diesen Kontakt auf. Wenn der Gegner Spannung spürt, wenn er merkt, dass ich etwas mit ihm machen will, dann reagiert er mit Gegenwehr. Wenn ich seinen Arm verdrehen will, so wird er es nicht zulassen, durch Anspannung und Gegendruck. Es reicht aber auch schon, dass er die Spannung nur unbewusst wahrnimmt, um unwillkürlich selber anzuspannen. Wird er fest, mit angespanntem Arm, gegriffen, spannt er an. Greift man locker, so tritt der Effekt eher nicht auf.
Im Aikidô möchte ich, dass der Gegner meiner Führung folgt. Aus diesem Grund sollte ich vermeiden, Anspannung bei ihm auszulösen. Man muss selber entspannt bleiben, während man eine Technik ausführt, um den Mechanismus der Übertragung nicht in Gang zu setzen.
Eine grundlegende Idee des Aikidô ist: Nicht ich mache etwas mit meinem Gegner, sondern es entsteht eine gemeinsame Bewegung. Nicht ich werfe ihn, sondern er fällt (durch die Technik – ist sie gut ausgeführt, hat er keine andere Wahl als zu fallen). Man kann kein Aikidô machen, wenn man selber angespannt ist. Nur unverkrampfte Bewegungen können sich dem Angreifer so anpassen, dass es eine gemeinsame Bewegung wird. Ist man angespannt, so gibt man zu viel seiner eigenen Dynamik und eigenen Intention in die gemeinsame Bewegung, die dann ihre Gemeinsamkeiten verlieren wird. Die Technik ist dann eckig und wirkt über den Schmerz, anstatt rund zu werden und über die Dynamik zu funktionieren.