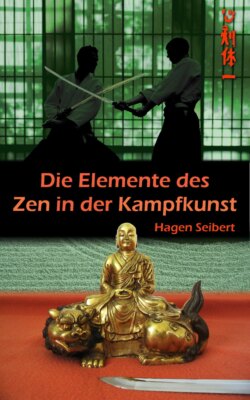Читать книгу Die Elemente des Zen in der Kampfkunst - Hagen Seibert - Страница 9
Kokyu - Atemkraft
ОглавлениеDie Atmung ist der Schlüssel zur Zazen-Übung. Deshalb konzentriert sich der Übende zuerst auf das richtige Atmen. Eine häufig verwendete Methode ist das Atemzählen. Bei jeder vollendeten Ausatmung zählt man eins … zwei … bis zehn und fängt dann wieder bei eins an. Das Ein- und Ausatmen soll möglichst gleichmäßig und langsam erfolgen. Man kommt so leicht auf nur drei Atemzüge pro Minute. (Atemzählen ist eine Methode für den Anfang, später zählt man nicht mehr und übt „shikantaza“, so-da-sitzen.)
Auch sollte dieses Atmen sehr tief sein, so wie ein Fahrstuhl vom Dachgeschoss bis in die Tiefgarage fährt. Das Gefühl sollte „strömend“ sein. Man kann sich vorstellen, dass man anstelle des Beckens eine Schüssel hätte, bis zu deren Grund man atmet oder bis zu einem gedachten Zentrum des Atmens, das im Zen „Tanden" oder „Hara" genannt wird. Dieses Zentrum des Atmens im Unterbauch liegt etwa eine Handbreit unter dem Nabel.
Blicken wir zu den Kampfkünsten, so spielt die Atmung ebenfalls eine sehr wichtige Rolle. Sie geht weit darüber hinaus, dass man bei sportlicher Anstrengung gelegentlich schnaufen muss. Zum Beispiel gibt es im Aikidô spezielle Atemkraft-Techniken („Kokyu-Nage“), bei denen man den Gegner nicht durch Hebeltechniken, sondern durch gezielten Körpereinsatz wirft. Für diese Atemkraft-Würfe benötigt man die Atmung aus dem Tanden. Dabei kommt es vor allem auf die natürliche Ausatmung im Einklang mit einer Bewegung an. Entscheidend ist, dass dieses Ausatmen aus dem Zentrum erfolgt.
Dieser Weise zu atmen liegt ein universelles Prinzip zugrunde: Wenn man Kraft ausübt, dann zusammen mit dem Ausatmen. Mit dem Einatmen wird Energie gesammelt, mit dem Ausatmen gibt man sie wieder ab. Man ist während der Ausatmung stärker, dagegen während der Einatmung schwächer, weniger konzentriert und leichter verletzbar. Um das zu spüren, gibt es einen einfachen Selbstversuch: Suche die Stelle etwa drei Finger breit über dem Nabel und klopfe mit der Handkante öfter dagegen, das eine Mal beim Einatmen, und das andere Mal beim Ausatmen. Der Unterschied ist deutlich fühlbar, während der Einatmung dringt die Empfindung für die Schläge durch bis an die Wirbelsäule. Darum ist es besser auszuatmen, wenn man von einem Fauststoß getroffen wird oder wenn man durch eine Wurftechnik des Gegners auf dem Boden aufschlägt.
So wird man im Budô stets versuchen, den Gegner dann anzugreifen, während er einatmet, wenn er also schwach ist. Ein Freund berichtete mir einmal von seinem koreanischen Tae-Kwon-Do-Meister, der manchmal im Freikampf die Faust vor den Mund hielt, oder den Kopf so weit verdrehte bis er seinen Kontrahenten nur noch aus den Augenwinkeln sah. Er tat dies, nur damit sein Gegner seine Atmung nicht erkennen konnte.
Umgekehrt wird man Kraft ausüben oder zuschlagen, während man selber ausatmet. Der Atem kommt aus der Hüfte, genauer gesagt aus dem Tanden. Die Energie für eine Bewegung, eine Kraftausübung, entwickelt sich aus diesem Punkt.
*
Was mich bei der Begegnung mit dem Mönch im Zuihô-Tempel am meisten verwundert hat, war jene Art der Atmung, bei der sich der Unterbauch beim Ausatmen vorwölbte. Das war damals etwas völlig Neues für mich. Es handelt sich dabei um die sogenannte „umgekehrte Bauchatmung”; sie ist eigentlich taoistischen Ursprungs. Als buddhistische Atemmethode kennt man dagegen eher die normale Bauchatmung, bei der sich der Unterbauch beim Einatmen vorwölbt.
Der Zuihô-in gehört zur Rinzai-Schule des Zen. Bei der anderen großen Schule des Zen, der Sôtô-Schule, wo ich später zu praktizieren begann, verwendet man im Zazen die normale Bauchatmung. Man legt größeren Wert auf die aufrechte Haltung. Außerdem sitzt man auf einem höheren Kissen. Es wird nicht gelehrt, den Unterbauch beim Ausatmen vorzuwölben. Durch die betont gerade Haltung und das höhere Kissen ist beim Sitzen die Bauchdecke stärker gespannt, so dass man nur noch schlecht den Unterbauch vorschieben könnte.
Was ist nun die unterschiedliche Wirkung dieser beiden Atemtechniken und wann setzt man sie ein? Geht es darum, den Geist zur Stille zu führen, so wie in der Zazen-Meditation, würde ich doch eher die normale Bauchatmung bevorzugen, einfach weil sie ganz normal und ungekünstelt ist. Die Methode der umgekehrten Bauchatmung ist dazu eine interessante Ergänzung. Ihre Wirkung ist eine starke und bewusste Betonung des Zentrums sowie ein Gefühl, als würde sich der Körperschwerpunkt absenken.
In den Kampfkünsten sind beide Atemmethoden anwendbar. Die normale Bauchatmung zum Beispiel beim Abknien, der kurzen Meditation zu Beginn und Ende des Trainings, wenn man sich den Kopf frei machen möchte für das Training. Die umgekehrte Bauchatmung bietet sich an, wenn man ein stabiles Körpergefühl erreichen möchte und seine Mitte sucht. Ein Beispiel wäre der Moment vor Beginn eines Randori (= Freikampf).
*
Die Atmung und die Bewegung hängen miteinander zusammen. Es gibt Techniken, die man in einer Atmung ausführt, für andere benötigt man zwei Atemzüge. Oftmals ist eine Technik sowohl in einem als auch in zwei Atemzügen möglich. Es gibt keine feste Vorschrift, die Atmung ist abhängig von der Situation und der Dynamik, von der Bewegung insgesamt. Die Hauptsache ist, dass unsere Atmung natürlich und logisch ist. Generell gilt: Ausatmen, wenn man Kraft ausübt, und Einatmen wenn man sich streckt. (Meistens wird man gleich nach dem Strecken eine Kraft ausüben.)
Im Aikidô, wenn man besser wird, so verlagert sich das Augenmerk. Man wird immer frühzeitiger beginnen, auf den Angreifer einzuwirken. Ein Anfänger ist mit den Techniken an sich vollauf beschäftigt, er steckt mit seiner Aufmerksamkeit mitten im Wurf. Der Fortgeschrittene beginnt auf die Angriffsdynamik zu achten, um die Bewegung fließend und harmonisch zu machen. Das Augenmerk liegt auf dem Eingang. Der Meister kann sich darin üben, den Atem des Angreifers zu spüren und die Angriffsintention zu erkennen, noch bevor der Angriff erfolgt.
Atmung und Bewegung zusammen bilden einen Rhythmus. Wir haben einen Rhythmus und unser Gegner hat seinen Rhythmus. Es ist vorteilhaft, wenn wir bei unserem Angreifer den Rhythmus erkennen, mit dem er angreift. Wir können ihn dann führen und unseren eigenen Rhythmus abstimmen.
Was in diesem Kontext mit Rhythmus gemeint ist, kann man sich nur schwer vorstellen. Deshalb sei es noch einmal anschaulich und einfach beschrieben. Im Aikidô gibt es von jeder Technik zwei Variationen, „omote" und „ura", Hineingehen und Wegdrehen. Warum ? Reicht denn nicht eine Version? Die beiden Varianten sind unterschiedliche Möglichkeiten, auf den Rhythmus des Angreifers einzugehen. Optimale Wirkung erzielt man, wenn man die Bewegung des Angreifers genau in ihrer Wirkrichtung verstärkt, dann verliert er sein Gleichgewicht. Jede andere Kraft, die man auf den anderen ausübt, kann dieser nutzen, um sich zu stabilisieren, oder sie mit den Prinzipien von Aikidô ebenso gegen einen selbst zu verwenden und zu kontern. Der Rhythmus des Angreifers kann verschieden sein, je nach seiner Intention: Er kann vorwärts stürmen, um mir eins zu verpassen, oder er kann vorsichtig sein und zurückweichen, um sich aus der Gefahrenzone zu halten. Diesen Rhythmus kann man an seiner Mimik, an der Atmung und an der Bewegung erkennen. Man reagiert entsprechend. Ist sein Angriff nur verhalten, geht man mit einer Omote-Technik gegen ihn. Drängt er vorwärts, lässt man ihn mit einer Ura-Technik ins Leere laufen.
Dies ist nur ein Aspekt. Es kommt auch auf den richtigen Rhythmus an, während man eine Technik ausführt, oder wenn man im Randori den Abstand zum Angreifer verändert, um seinen Angriff zu erzwingen oder zu verzögern usw. Das Gefühl für den richtigen Rhythmus ist nicht mit schneller Auffassungsgabe zu verwechseln: Rhythmus ist wichtiger als Schnelligkeit, so wie Klugheit oft besser ist als Intelligenz. Durch Schnelligkeit gelangt man fix in die richtige Position; kluges Rhythmusgefühl bedeutet, schon dort zu sein.