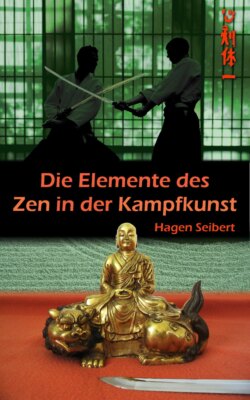Читать книгу Die Elemente des Zen in der Kampfkunst - Hagen Seibert - Страница 6
Chogen - Die Verbindung von Zen und Budô
ОглавлениеWenn ich einmal das Fechten in Europa und seine Verbindung mit dem Christentum mit dem Fechten in Japan und seiner Verbindung zum Zen-Buddhismus vergleiche, gibt es da einen Unterschied? Das Fechten hat in beiden Kulturen eine lange Tradition. In Europa gab es mit den Ritterorden eine institutionalisierte Verbindung von Ritterstand und religiöser Spiritualität. Das Christentum gab den Ordensrittern Anleitung, wofür sie ihr Schwert einsetzen sollten. Für die Frage, wie sie ihr Schwert handhaben sollten, konnten die Ritter nicht aus dem Christentum schöpfen. Die hohe Kunst des Fechtens – erst mit dem Langschwert, später mit dem Degen – entwickelte sich bar jeder Spiritualität. Heute lebt diese Kunst im Fechtsport weiter, in einer olympischen Disziplin, die auf Wettkampf ausgerichtet ist. In Japan gab es ebenfalls einen Ritterstand, die Samurai. Es gab keine mit Johannitern oder Templern vergleichbaren Orden. Trotzdem entstand eine spirituelle Verbindung, aus der gestalterischen Kraft der Idee des Zen, die den Samurai Rat gab wie sie mit ihrem Schwert umgehen sollten. Der Einfluss des Zen reichte bis in die praktische Handhabung des Schwertes. Heute sind uns die Budô-Künste erhalten geblieben, in denen die Kampfkunst als Weg der persönlichen Entwicklung begriffen wird, und Wettkämpfe nicht im Vordergrund stehen (Bu=Krieg, Kampf; Dô=Weg1).
„Das japanische budô ist die Einheit der Kampfkünste und des Zen.“ ([2] S.38)
Ohne Zen gäbe es die Budô-Künste nicht in der Form, die wir heute kennen. Zen ist die Quelle der Inspiration für alle Budô-Künste.
Die Verbindung von Zen und Budô ist geschichtlich entstanden. Gautama Siddhartha, der historische Buddha2, setzte sich, der Überlieferung zufolge, nach sechsjähriger Suche und Wanderschaft unter einen Feigenbaum, praktizierte Meditation und erfuhr dadurch Erleuchtung. Diese Art der Meditation nannte man „dhyana". Nach Gautamas Tod spaltete sich der Buddhismus in verschiedene Richtungen auf. Einige behielten „dhyana" als zentrale, besonders betonte Übungsform bei.
Durch Bodhidharma gelangte diese Richtung schließlich nach China3 und wurde dort „ch´an-na" ausgesprochen. Indem der Buddhismus sich mit dem Gedankengut des Taoismus verband, entwickelte sich die spezifisch chinesische Prägung des „ch´an"-Buddhismus. Dieser blieb in China stets ein Außenseiter unter den Religionen, die Verneinung jeglicher Form machte „ch´an" im damaligen Kaiserreich ungeeignet für offizielle Zwecke.
In Japan hatte der Buddhismus – aus China kommend – als neue Religion schnell Fuß fassen können4. Immer wieder brachen japanische Mönche zu Studienreisen in das vermeintliche Ursprungsland des Buddhismus auf. Eisai und Dôgen, zwei dieser Reisenden, kamen auf ihren Studienreisen nach China mit der neueren Richtung des „ch´an"-Buddhismus in Berührung. Sie verbrachten mehrere Jahre bei ihren Lehrern und verbreiteten nach ihrer Rückkehr „Zen" in Japan5. Dort fühlte sich insbesondere die Kriegerschicht der Samurai durch die Ideen dieser neuen Richtung des Buddhismus angesprochen. Ihre Lebenssituation erforderte von ihnen, spezielle Wege zu finden den Tod zu bewältigen, an dessen Pforte sie zu jeder Zeit standen. Das einfache Volk blieb dagegen eher dem esoterischen Buddhismus (Shingon, etc.) und der „Reinen Land"-Sekte zugetan.
Als die Heian-Ära, die glanzvolle Zeit des Kaiserhofes von Kyôto, zu Ende ging, war der Tenno nicht mehr in der Lage das Land zu regieren. Der Shogun übernahm diese Funktion. Als Regent übernahm er faktisch die Macht im Lande. Die Shogune entstammten der Klasse der Samurai, und Zen wurde zeitweise Staatsreligion6. In der Folge drang der spirituelle Einfluss des Zen in viele Lebensbereiche ein, es entstanden die „Zen-Künste” – Teezeremonie, Ikebana, Kalligraphie und Budô. Durch diese wurde Zen schließlich auch von den breiten Schichten der Bevölkerung angenommen.
„Zen wäre nicht angenommen worden ohne bestimmte Formen. Zazen [-Meditation] ist eine Form, doch Zen kann unendlich viele Formen erzeugen. Ich glaube, daß Aikido eine dieser Formen ist. ... Daher wird Aikido ‚Zen in Bewegung` genannt, während man Zazen als ‚Aikido in Ruhe` beschreiben kann." ([1] S.23f)
Der ideelle Einfluss des Zen lässt sich auf viele Tätigkeiten übertragen. Umgekehrt würde man am Ende zu ganz ähnlichen Methoden gelangen, wenn man nach hervorragenden Leistungen strebte, auch ohne Zen zu kennen. Die Lehre des Zen ist etwas zutiefst Natürliches. So findet man bestimmte Elemente überall wieder.
Ein Extrem-Kletterer beschrieb einmal den mentalen Zustand, wenn er sich ohne Seil voll konzentriert weit oben in der luftigen Höhe einer Felswand bewegt, mit den Worten: „Dann ist man im Gas.“ Er skizzierte damit, dass es für den Moment dort oben nur mehr die ätherische Leichtigkeit gibt, aber keinen Abgrund, keinen Gipfel, keine Gefahr und keinen Kletterer. Er fasste einen Zustand, wie man ihn im Zen kennt, das „Hier und Jetzt“, in bildhafte Worte, ohne jemals von Zen gehört zu haben.
Jede Kunst, die eine anspruchsvolle körperliche Koordination erfordert, sei es eine Kampfkunst wie Aikidô oder Sportklettern, Skirennlauf, Gewichtheben, Tennis, Golf, oder der Zusammenbau einer mechanischen Taschenuhr – egal in welchem Bereich – alle diese Tätigkeiten haben einen mentalen Aspekt.
Ein Skirennläufer fährt vor dem Start im Geiste durch die Slalomstangen, und bei seinem Lauf während des Rennens vergisst er alles andere, seine Gegner, seine Weltcup-Punkte, seine Gefahr zu stürzen, er konzentriert sich nur auf die nächste Stange und auf seine Linie. Das ist Zen. Ein Gewichtheber nimmt sich einen Moment der stillen Sammlung, bevor er nach vorne schreitet, die Stange ergreift, und die ganze Kraft seines Körpers unter die Gewichte stemmt. Das ist Zen.
Will man erfolgreich sein, erfordern all diese Tätigkeiten letztlich die gleichen Elemente wie sie bereits vor langer Zeit aus dem Zen in die Kampfkünste eingedrungen sind. Die Meister der Budô-Künste verdanken ihre Meisterschaft in besonderem Maß diesen Elementen.
Jene Elemente, die Zen für das praktische Budô bereit hält, das sind sennen, kokyu, shisei, mushotoku, sutemi, zanshin, mushin, hishiryo, shoshin. Dieses Buch soll dienen sie aufzuzeigen.