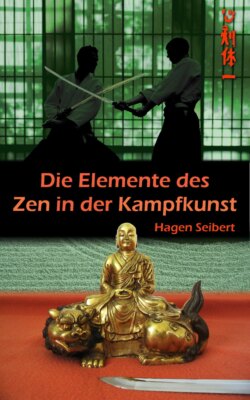Читать книгу Die Elemente des Zen in der Kampfkunst - Hagen Seibert - Страница 8
Sennen - Konzentration
ОглавлениеDie Übung der Konzentration im Zen erfolgt meist über drei Wege: Zazen, Kinhin und Samu.
Zazen, die Meditation im Sitzen, ist die zentrale Übungsform des Zen. Hierzu setzt man sich auf ein Sitzkissen, das Zafu, und verschränkt die Beine in halber oder voller Lotushaltung. Das ist wie ein Schneidersitz, bei dem die Füße oben auf dem Oberschenkel zum Liegen kommen. Die Hände werden vor dem Bauch gehalten, so dass die Finger der rechten auf den Fingern der linken liegen und die Daumenspitzen einander berühren. Man sitzt möglichst aufrecht, den Kopf zurückgenommen, die Lider etwas geschlossen und den Blick unbestimmt gegen die Wand gerichtet, ohne einen bestimmten Punkt zu fixieren8.
Die Zazen-Meditation dient dazu, den Geist zu beruhigen, damit er zu Klarheit finden kann. Dafür richtet man die Aufmerksamkeit zuerst nach innen, auf die Atmung. Den Atem ruhig fließen lassen ermöglicht es, die flackernden, irrlichtigen Gedankenregungen loszulassen. Sind die permanenten, selbsterzeugten Ablenkungen ausgelöscht, stellt sich ein Zustand des Nicht-Denkens, der subjektlosen Wachsamkeit ein9.
„Der beste Weg, um wahres Zen zu erfahren […], ist, den Körper in einen Zustand vollkommenen Gleichgewichts und vollkommener Ruhe zu bringen, so dass man ihn nicht mehr wahrnimmt …“ ([33] S.15)
Kinhin, die Meditation im Gehen, wird meist in den Pausen zwischen zwei Zazen-Einheiten verwendet, um die Glieder zu bewegen und die Muskeln zu lockern und dabei trotzdem nicht die Konzentration fallen zu lassen. Man geht im Kreis herum, mit langsamen kleinen Schritten, die Hände vor der Brust zusammengelegt. Mit dem Aufsetzen der Ferse beim Schritt beginnt man mit der Ausatmung und führt sie fort, während man das Gewicht auf den vorderen Fuß verlagert. Die Ausatmung ist zu Ende, wenn man vollständig auf dem vorderen Fuß steht. Hebt man den hinteren Fuß ab, beginnt die Einatmung, die man fortsetzt, während der Fuß langsam vorschwingt, bis er wieder aufsetzt. So ergibt sich ein sehr langsames Voranschreiten im Einklang mit der Atmung. Es sollte sich so anfühlen, als würde man weiter Zazen üben.
Samu, die Übung in täglicher Arbeit, ist ebenfalls eine Übung der Konzentration. Auch in der Ausführung von Tätigkeiten, speziell Arbeiten wie Boden wischen oder Unkraut jäten, kommt es darauf an, mit der Aufmerksamkeit dabei zu bleiben und nicht abzuschweifen. Wie verlockend naheliegend ist der Gedanke: „Ahh, ich habe keine Lust, das jetzt zu machen.“ Aber das Ziel ist die Konzentration bis zum vollkommenen Einswerden mit dem momentanen Tun. Es gibt dann keinen Raum mehr für „keine Lust“. Man geht auf im Tun. Dies kann für jede Tätigkeit gelten. Trinkt man zum Beispiel ein Glas Wasser, erfüllt es das ganze Bewusstsein: Ich bin „ein Glas Wasser trinken“.
Betrachtet man nun die Kampfkünste, so fällt zuerst Iaidô auf, die Kunst das Schwert zu ziehen, als die Kunst, von der ich sagen würde, dass sie eine logische Fortsetzung dieser Reihe bietet: Zazen im Sitzen, Kinhin im Gehen, Samu in der Tätigkeit und nun Iaidô in der Bewegung mit einem Gegenstand, dem Schwert.
Gewiss birgt Iaidô noch viele weitere Aspekte: Perfektionierung der Form in Bezug auf einen imaginären Gegner, Natürlichkeit und Effizienz der Bewegung, Auseinandersetzung mit dem Schwert … Es gibt unterschiedliche Arten des Trainierens mit verschiedenen Zielen, auf die man sich konzentriert, die jeweils ihre eigene Berechtigung haben:
Die Phase des Einübens zeichnet sich dadurch aus, dass man sich den imaginären Gegner möglichst physisch vorstellt, um der Bewegung einen realistischen Charakter zu verleihen und die Anwendung der Form darzustellen. Außerdem erfolgt ständige Selbstkontrolle der Ausführung: Ist der Schnitt gelungen? Stehe ich gut? Stimmt die Haltung? Das Training ist eher physisch, auf die Aneignung der Form bezogen.
Dem gegenüber gibt es – später, wenn die Form erlernt ist – die Phase des Ausübens. Das Bild des Gegners ist nicht mehr so wichtig, es darf zu einem abstrakten Schatten verblassen. Man steigert sich nicht weiter in einen imaginären Zweikampf hinein, sondern betrachtet die Situation des Schwertkampfes mit Abgeklärtheit. Außerdem unterwirft man sich nicht mehr permanenter Selbstbeobachtung und -kontrolle, sondern übt ohne nach-denken, wie in der Meditation, mit einem nicht-reflektierenden Geist. Das Training ist eher mental: wachsam, ansatzlos die Technik hervorbringen, die Energie auf den Punkt bringen und Kraft an der richtigen Stelle der Bewegung entfalten, die natürliche Führung des Schwertes geläufig werden lassen, Schwert und Bewegung in geistiger Einheit.
In der nächsten Stufe dieser Reihe sind wir dann bei den anderen Kampfkünsten, dort setzt sich die logische Kette fort in der Bewegung mit einem aktiven Gegenüber.
In jeder Stufe der Reihe steigt die Anzahl der ablenkenden Faktoren und der Versuchungen, die Konzentration zu verlieren und den Geist anzuhalten, verweilen zu lassen. Am Endpunkt der Reihe, mit einem Gegner, beschäftigt sich der Verstand auf einmal ungewollt mit Sieg und Niederlage, mit Angst, mit Ärger, mit Strategie, mit Schmerz und Verletzung. Dem lässt sich entgegen wirken, indem man in der einfachen Situation am Beginn der Reihe den Zustand einübt, den man in der schwierigeren Situation am Ende benötigt.