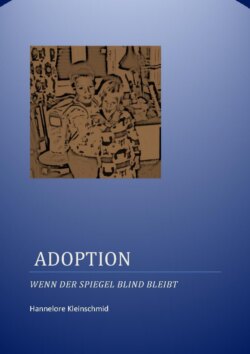Читать книгу Adoption - Hannelore Kleinschmid - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDas Köpfchen mit den vielen Wirbeln im Haar donnert Nacht für Nacht – nach dem Gefühl der Eltern pausenlos – auf die Matratze. Der Husten mit 39 Grad Fieber kehrt garantiert zurück, nachdem er ein/zwei Wochen pausiert hat.
Angesichts von Winnys ständigen Willensbekundungen wird Beate immer hilfloser und verkrampfter.
Einen Hilferuf verschluckt sie – eine Zeit lang jedenfalls -, weil sie nicht weiß, an wen sie ihn richten kann.
Was tun Eltern eines schwierigen Kindes?
Sie suchen Beratung.
Sie fragen viele Leute und überprüfen jede Menge Angaben und Anschriften. Vor allem wenn sie Journalisten von Beruf sind.
Sie wenden sich an Ämter.
Sie schreiben Briefe.
Sie verbrauchen Zeit und Energie, wenn sie es sich leisten können.
Sie sind erleichtert, als sie bei einem Psychiater an der Universitätsklinik einen Termin erhalten. Sie reden mit ihm. Er lernt den sechsjährigen Winston kennen, eine Stunde lang. Danach konzentriert er sich auf die Eltern. Er geht davon aus, dass die Probleme eines Kindes ihre Wurzeln bei den Eltern haben und also Vater und Mutter einer Gesprächstherapie bedürfen. Nach mehreren Sitzungen bescheinigt er Beate und Benno durchaus guten Willen, seine Ratschläge anzunehmen.
Zudem entdeckt er zwei gravierende Konflikte:
Da ist zum einen die Geschwistersituation.
Nur eineinhalb Jahre nach der Adoption wurde die Schwester geboren, das eigene Kind.
Und zum zweiten sieht er, dass Benno, vor allem aber Beate, nach Möglichkeit versuchen, Winny aus den Gefahrenzonen zu manövrieren, in denen er aggressiv wird und unliebsam aufhält.
Dadurch – so der Doktor - behandeln sie ihn wie ein Kleinkind, halten ihn unmündig und lassen ihm keinen Raum für eigene Erfahrungen. Er erhält durch die Eltern keine Chance, selbst Verantwortung zu übernehmen.
Das leuchtet beiden ein. Aber sie kennen auch den Teufelskreis: Andere Menschen haben keinen Grund, sich auf die Schwierigkeiten einzulassen, die der Umgang mit Winny heraufbeschwört.
Sammelt er also seine eigenen Erfahrungen mit anderen, gehört dazu auch, dass sie sein Verhalten ablehnen.
Während Benno und Beate zur Gesprächstherapie gehen, wachsen ihres Sohnes Probleme in der Vorschule so sehr, dass die Lehrerin Hilfestellung verlangt.
Das Kind selbst schlägt vor, Vater oder Mutter sollten während der Schulstunden im Raum bleiben. Als der Psychiater sich damit einverstanden erklärt, beginnen beide Grimms an seinen Erkenntnissen zu zweifeln. Wie kann es Winny helfen, wenn sie ihn noch stärker beaufsichtigen und beschützen, ihm noch weniger Raum lassen, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen? Muss der Weg nicht genau in die entgegengesetzte Richtung gehen?
Benno und Beate lernen, dass ein kleines Kind nur mit Verhaltenstherapie behandelt werden kann. Also beginnen sie, eine Gruppe dafür zu suchen. Ein privates Institut wird ihnen empfohlen, in dem Kinder betreut wird, die als leicht behindert eingestuft worden sind. Die Eltern sehen dennoch eine Chance und bringen den Sohn wöchentlich zweimal ans andere Ende der Stadt zur Therapie. Doch das bleibt eine kurze Episode, denn wegen Differenzen mit der Leitung Institutes kündigt die Psychologin, die Winnys Gruppe leitet und ihm Verständnis und Zuwendung entgegenbringt. Damit endet die Gruppentherapie.
Also suchen sie weiter, intensiv und zunehmend verzweifelt.
Sie wenden sich, als sie von seiner Arbeit erfahren, an einen Professor der Psychiatrischen und Neurologischen Klinik und Poliklinik der Freien Universität Berlin und schreiben ihm:
Bereits im Kindergarten fiel Winston durch Verhaltensstörungen auf, insbesondere durch Aggressionen gegenüber Kindern und Erzieherinnen. Beunruhigend wurde seine Unfähigkeit, sich in eine Gruppe einzufügen, mit dem Älterwerden. Er verhielt sich mit sechs Jahren diesbezüglich noch wie ein Dreijähriger.
Während des Vorschulunterrichts kam die Lehrerin zu der Überzeugung, ohne therapeutische Unterstützung sei er nicht in der Gruppe zu halten.
Da wir in der Nähe unseres Wohnortes nichts Geeignetes fanden, entschieden wir uns schließlich für ein privat geführtes Psychologisches Institut im Süden Berlins, in dem sich viermal wöchentlich für drei Stunden eine kleine Gruppe mit zwei Therapeutinnen trifft. Dass es sich dabei um behinderte Kinder handelt, setzte uns dem Verdacht aus, vor den Problemen zu schnell zu kapitulieren und unserem Sohn eher zu schaden, als ihm zu helfen.
Der bevorstehende Schulbeginn setzt uns nun unter Druck. Es gilt, eine Lösung zu finden, mit deren Hilfe er am Schulunterricht teilnehmen kann.
Der Professor bedauert, ihnen in dieser Situation nicht helfen zu können, und die Suche geht weiter. Benno und Beate fragen und telefonieren und verfassen Briefe.
Sie landen schließlich bei einer privaten Schule mit kleinen Klassen, wiederum im Süden Berlins.
Dort wird Winston angenommen. Eingeschult. Er bekommt eine große Zuckertüte, der Schulfotograf macht das obligatorische Foto, sie gehen essen mit den Großeltern, wie es sich zu diesem Anlass gehört.
Im Dezember, nach nur einem Vierteljahr, wird er entlassen. Also rausgeschmissen! Er ist von der Schule geflogen – als ABC-Schütze.
Winston ist ein temperamentvolles, kräftiges Kind, das nur kurze Zeit dem Unterricht folgen kann, ohne störend aufzufallen. Eine starke Aggressionsbereitschaft, die auf erheblichen sozialen Anpassungsschwierigkeiten beruht, hindert ihn an konzentrierter Mitarbeit. Er sucht fast ständig Anlässe zum Ärgern, Streiten oder Kämpfen. Es ist deutlich, dass er sich eine „Machtposition“ schafft, um sein schwaches Selbstwertgefühl zu überspielen.
Der abschließende Vorschlag der Schule: Einzelunterricht. Dazu vielleicht, bei Besserung, zweimal in der Woche ein Besuch der alten Klasse, eine Stunde lang.
Er ist unter den anderen komplizierten Kindern zu kompliziert. Beate und Benno haben nicht bedacht, dass es für alle diese Privatschüler gute Gründe gibt, eine besondere Schule aufzusuchen. Dort ist folglich nicht Platz für ein besonders schwieriges Kind.
Was bedeutet das eigentlich, wenn ein Erstklässler ohne Schule dasteht, obwohl in unserem Land die Schulpflicht für alle Kinder gesetzlich vorgeschrieben ist?
Es kostet immer und überall Kraft, einen Weg zu suchen, wenn man die ausgetretenen Pfade nicht gehen kann. Eltern mit besonderen Kindern fühlen sich mit diesen Konflikten oft sehr allein, obwohl unser soziales Netz dichter geknüpft ist als in den meisten Ländern. Hat man sein Problem erkannt, beginnt die Suche nach der richtigen Stelle, um Hilfe zu bekommen.
Benno wiederholt ironisch, wie gut es sei, dass beide Eltern ein abgeschlossenes Hochschulstudium und auch allerhand Zeit haben, um entsprechende Recherchen zu betreiben.
Oft gilt es einen langwierigen Kampf mit den entsprechenden Behörden führen, wenn man die zuständige Stelle endlich entdeckt hat. Nicht selten haben Betroffene dabei das Gefühl, dass die vielen Regeln und Verordnungen, ausgedacht und angewandt hinter Beamtenschreibtischen, gerade ihr Problem nicht berücksichtigen.
Was also tun?
Was tun mit einem Knaben, der nach einem Vierteljahr Schule ausgemustert wird?
Der Schulrat des Stadtbezirks fragt allen Ernstes:
Warum haben Sie das Kind überhaupt adoptiert?
Den Eltern verschlägt es die Sprache. Wenn sie später an diesen Satz denken, sind sie immer wieder sprachlos.
Doch der Schulrat bekennt offen, dass er am Ende seines Lateins sei und nicht wisse, wie man Winston helfen kann. Eigentlich könne er ihm höchstens noch „Schulunfähigkeit“ bescheinigen.
Schließlich empfiehlt er, wenn es gar nicht weiter gehe, die psychiatrische Abteilung einer nahegelegenen Kinderklinik.
Als er in die entsetzten Gesichter von Benno und Beate blickt, verspricht er – um sie erstmal loszuwerden - , dass er noch einmal nachdenken werde.
Die Mutter macht einen Spaziergang an der Klinik vorbei. Obwohl sie, wenn sie ganz ehrlich zu sich ist, gern die Verantwortung für Winny einmal abgeben würde – kurze Zeit nur -, wächst ihre Ablehnung eines solchen Schrittes.
Zu guter Letzt meldet sich der Schulrat und erklärt, es handele sich um persönliche Großzügigkeit – er nehme das auf seine Kappe -, dass er Einzelunterricht gestatte:
45 Minuten an jedem Unterrichtstag.
Die Eltern stecken mit ihrem Sohn tief in einer Sackgasse.
Was kann ein Kind im Einzelunterricht lernen, dessen Problem das Sozialverhalten ist?
Immerhin hat der Junge Glück mit dem Lehrer, der geduldig und verständnisvoll mit ihm umgeht. Er unterrichtet an einer Förderschule und nimmt Winston oft mit in seine dritte Klasse. Von ihm hören die Eltern, wie interessiert der Junge ist, was für eine schnelle Auffassungsgabe er hat.
Doch wie geht es einem Siebenjährigen, der nur stundenweise zum Unterricht gehen darf und jeden Tag für sein Gefühl viel zu lange allein ist? Der sich allein beschäftigen und allein spielen soll, obwohl er nach Gesellschaft giert. Der erlebt, wie die kleine Schwester fröhlich aus dem Kindergarten kommt und sich für den Nachmittag mit Freundinnen verabredet.
Wie es ihm geht, ahnen seine Eltern nur. Sie erleben Wutanfälle und beobachten Aggressionen. Sie sehen die Ursachen dafür und versuchen gegenzusteuern. Mit Reden. Mit Strenge – und Ungeduld.
Der Junge ist sportlich. Nur am Reck auf dem Spielplatz zieht ihn der muskulöse Po herunter, und er hängt dort wie ein kleiner Sack. Doch mit Bällen bewegt er sich flink, und er bewegt sie gezielt. Manchmal ersetzt ein Stein den Ball. Beim Spaziergang fliegt er weit, über einen Bach hinweg, und trifft dennoch, trifft Benno schmerzhaft an der Schulter. Nicht böse gemeint. Bloß gehandelt, ohne zu überlegen.
Von anderen Müttern wird Beate – entsetzensvoll – gefragt, ob sie die Tochter Jana mit diesem Sohn wirklich in einem Zimmer spielen und schlafen lasse. Er tut ihr wirklich nichts? lautet die ungläubige Frage. Die Antwort, dass er ein liebevoller Bruder sei und sich die Schwester zu wehren wisse, wird oft mit skeptischen Blicken quittiert.
Dabei ist es wirklich so.
Das Verhältnis der Geschwister bleibt ein Lichtblick bei den familiären Problemen.