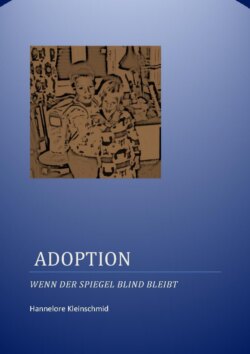Читать книгу Adoption - Hannelore Kleinschmid - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDer Deutsche Dienst der BBC verabschiedet die künftige Adoptivmutter mit einem Blumenstrauß und dem Hinweis, freiberuflich könne sie nur in Ausnahmefällen hier tätig werden, denn die Honorarkasse sei dürftig ausgestattet.
So werden sie zu dritt künftig nur über die Hälfte des bisherigen monatlichen Einkommens verfügen. Eng wird das schon werden, denn die Wohnung in der Nähe des großen Parks ist teuer und verschlang von Anfang an ein Viertel der verdienten Pfunde. Es beginnt eine Zeit, in der Beate Angst vor jeder Rechnung hat, die im Briefkasten landet.
Noch einmal gibt es ein Hindernis. Ganz plötzlich!
Ganz plötzlich hat man in der Adoptionsgesellschaft noch einmal eine Frage zum deutschen Rassismus. Mrs. Martin übermittelte sie.
Wo werden die Grimms mit Winston in Deutschland leben, wenn sie dorthin zurückkehren?
Sie werden in der Stadt leben, in der sie Arbeit finden. Das ist die Antwort. Rundfunkjournalisten wie sie arbeiten für gewöhnlich in einer Großstadt, also werden sie nicht in einer deutschen Provinzstadt oder auf dem Lande landen.
Auch in der Bundesrepublik sind Großstädte weltoffener. Diese Antwort verspricht die Sozialarbeiterin zu übermitteln. Nach einigen Tagen neuerlicher Anspannung kommt die Gewissheit: Winston wird mit ihnen leben. Zunächst während einer Probezeit, in der sie unangekündigt besucht werden können und über sie schriftlich berichtet wird. So erklärt es Anne Martin. Sie ist weiterhin zuständig.
Er liegt wirklich vor ihr auf der Wickelunterlage, die sie für ihn gekauft hat.
Beate gibt Winny einen schmatzenden Kuss auf das runde Bäuchlein. Dazu macht sie ein prustendes Geräusch. Der Kleine kreischt. Noch ein Kuss, sie beugt ihren Kopf über das Bäuchlein und kitzelt es mit ihren Haaren. Sie liebkost ihn, will ihm Nähe geben, die er bisher nicht gehabt hat. Nicht einmal ein „Küsschen durch die Luft“ kann er mit seinen 13 Monaten verschicken.
Unversehens landet seine Hand auf Beates Wange. Klatsch! Sie spürt eine winzige Enttäuschung, die schnell verfliegt.
Im Garten sitzt ihr Kind. Auf einer Decke, auf dem Rasen, den der irische Gärtner kurz geschoren hat. Der Finger zeigt in viele Richtungen, der Mund stößt muntere Töne aus. Mit dem Po schiebt sich der Kleine näher an den Ball heran.
Nur über die Straße gelangen sie mit dem Buggy, dem leichten, zusammen klappbaren Kinderwagen, in den Park. Wieder breitet Beate die bunte Decke aus. Aber Winny bleibt starr sitzen, die Händchen ineinander verschränkt, die winzige Falte zwischen den Augenbrauen, ein misstrauischer Blick.
Beate schüttet das bunte Spielzeug aus dem Plastikeimer auf die Decke. Doch der kleine Junge starrt unbewegt. Sie nimmt den Ball und kullert ihn auf der Decke hin und her. Als sie den Sohn aus dem Buggy hebt und auf die Decke setzt, bleibt sein Blick ängstlich, er streckt die Hände in Brusthöhe aus, spreizt die Finger, hält sie in die Luft, obwohl sie oft blitzschnell Dinge greifen, bewegen oder schubsen können.
Erst langsam begreift Beate, was mit ihrem Kind los sein könnte.
Das Gras ist hoch gewachsen im Park. Die Büsche biegen sich unter dem Laubwerk. So viel Natur scheint Winny selten oder gar nicht erlebt zu haben. Ihm ist es unheimlich, wo er sich wohl fühlen soll. Ein paar Monate später wird er sagen: Bumban tun nix (Blumen tun nichts). Wiederum Wochen später wird er sich nicht trauen, den Ball wieder hervorzuholen, wenn er im Garten unter einen Busch gerollt ist. Als kühner Schwimmer wird er in späteren Jahren naturtrübes Wasser meiden, wenn es irgend geht.
Manches ist schwerer zu deuten.
Beate wird manches nicht richtig verstehen in den Jahren, die kommen.
Das Headbanging macht Lärm, wenn das Bett nicht fest auf seinen Füßen steht und die Matratze nicht stramm und geräuscharm auf dem Lattenrost liegt.
Bummbumm, bummumm, bummbumm.
Es wird nicht mehr viel Zeit vergehen, bis Winny im Rhythmus dazu Hänschen klein auf hmhmhm singt.
Als Heranwachsender liegt er fast quer im Bett, jedenfalls mit weit ausgebreiteten Armen und Beinen, auf dem Bauch. Vermutlich hört das Headbanging erst auf, als eine Freundin neben ihm liegt.
Seine Eltern ahnen, welche große innere Spannung ihr Kind beherrscht.
Obwohl Winny gut isst und einen kleinen Kugelbauch vorstreckt bei den Gehversuchen, ertappt sich Beate dabei, wie sie ihm in ererbter Manier den Brei in den Mund redet:
Noch ein Löffel für Papa, ein Löffel für die Miau, ein Löffel für das Auto.
Als sie im schlauen Buch über Erziehung liest, nickt sie zustimmend.
Achtung, heißt es da, man praktiziert allzu gern selbst, was man in der Kindheit gehasst hat.
Sie hat es gehasst, ewig am Tisch hinter dem längst kalten Essen hocken und den Teller leeren zu müssen. Und nun versucht sie, Winny auch noch den letzten Löffel hineinzuzwingen.
Pass auf, Beate, denkt sie, bei allem Bemühen kann Erziehung in die falsche Richtung gehen.
Beate und Benno sind stolze Eltern eines munteren Knaben, der sie auf Trab hält, wenn er wach ist. Papa wird sein erstes Wort sein. Benno in Jeans mit Schlag, langen Haaren und nacktem Oberkörper folgt unermüdlich Winnys Wunsch, laufen zu lernen. Er bückt sich zu den Händchen, die der Sohn nach oben reckt. Noch ist er besonders klein, und der Vater krümmt sich. Da der Sohn Hausschuhe sofort auszieht, übt er seine Schritte in Strumpfhosen. Der Strumpf bleibt weit hinter dem Fuß zurück, wodurch die Hose rutscht. Doch Winny nimmt wie Benno keine Notiz davon.
Der Kleine setzt bunte Plastikbecher aufeinander. Er bemüht sich, sie danach in der richtigen Reihenfolge ineinander zu stecken. Stolz zeigt das Fingerchen auf die eigene Brust: Ich habe das gekonnt!
Winny will bewundert werden und nicht allein sein.
Die Eltern denken, dass ein Kind, das wichtige Wochen seines Lebens ohne Zuwendung verbrachte, nicht allein in seinem Zimmer bleiben und sich allein beschäftigen muss.
Wenn Winny später unzufrieden nach immer neuen Beschäftigungen sucht, fragt sich Beate gegelegentlich, ob es ein Fehler war, sich ständig zu kümmern. Vielleicht hat der Sohn auf diese Weise nicht genug Luft zum Atmen bekommen, nicht genügend Freiräume für seine Entwicklung? Konnte er sich nicht selbst entdecken? Hatte keine Chance dazu?
Noch ahnen die Eltern nichts von solchen Gefahren. Sie meinen es doch nur gut!
Winny, sag mal Mama. Winny sag mal Papa. Winny, sag doch mal Auto.
Sein zweites Wort klingt nach Auto. Aber er macht sie auch mit den wirklich wichtigen ersten Wörtern glücklich.
Nach sechs Wochen Familienleben werden sie in das große Krankenhaus eingeladen, in dem Winny geboren und im ersten Lebensjahr als Frühchen regelmäßig untersucht und getestet worden ist. Im Grunde genommen wissen die Grimms längst, dass ihr Sohn nicht behindert ist. Manchmal fragt sich Beate allerdings noch immer angstvoll, ob es denn sein könne, dass die Entwicklung eines Kindes plötzlich stehen bleibt. Doch wenn sie Winny anschaut, weiß sie, mit ihm haben solche Überlegungen nichts zu tun. Nun wollen die Eltern von den Ärzten die Bestätigung erhalten, mit der dieses Retarded endgültig aus der Welt geschafft wird.
Winston wird gründlich getestet. Benno und Beate bekommen die handschriftlichen Notizen des Arztes in die Hand gedrückt, denn er will Winny nicht wiedersehen. Das Wesentliche verstehen sie auf der Stelle. Die Ärzte sind jetzt mit Mrs. Keen, der Pflegemutter, einer Meinung:
There is nothing wrong with that boy!
Noch glücklicher aber machen sie die Abschiedsworte des Arztes: German Treatment! kommentiert er die Entwicklung des Jungen.
Nach der „deutschen Behandlung“ durch die Eltern sieht er keinen Grund, ihn weiter zu beobachten.
Winny krabbelt nur einige Tage lang. Dann macht er seine ersten Schritte. Seitdem er laufen kann, rennt er. So wird es jahrelang bleiben. Jetzt aber kriegt er nicht immer die Kurve. Jedenfalls nicht rechtzeitig. Als Anne Martin vorbei kommt, die die Adoption vor dem Komitee wird vertreten müssen, läuft ihr der Kleine mit drei blau leuchtenden Beulen am Kopf entgegen, und Beate denkt für eine Sekunde: Wenn nun jemand glaubt, wir hätten ihn geschlagen?
Beulen holt sich Winny in Zukunft noch häufig, nicht nur an der Stirn.
Die Eltern sprechen viel mit dem kleinen Sohn. Auf Deutsch, Winnys Mutter- und Vatersprache. Er beginnt zu verstehen und zu antworten. Recht bald scheinen sich aus dem Plappern Wörter zu entwickeln. Zur Freude der Eltern, die jedoch zunächst nur „Bahnhof“ - daadn oder daadndn - verstehen. Winny liebt das a so sehr, dass es über einige Zeit sein ausschließlicher Vokal bleibt, den er mit dn kombiniert, freudig, kommunikativ, durch die Nase schnaubend.
Im Laufe der Monate beginnt die Mutter, ihn herauszufordern: Als sie mit dem Auto über eine Brücke fahren, unter der ein Schiff laut tutet, sagt sie: Winny, hör mal, das Schiff macht tuuut! Tuuut!.
Ohne Zögern antwortet er: Anner Jaff a tatt.
(Die Übersetzung: Das andere Schiff macht auch tut.)
Seine Zukunft bringt Wortreichtum und gelegentlich Rekord verdächtiges Sprechtempo. Doch in der Londoner Zeit sagt er:
Dadn und daadndn, was in beiden Sprachen alles benennt, das ein Kleinkind interessant findet.