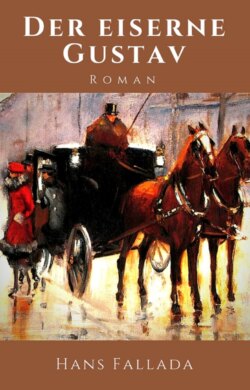Читать книгу Der eiserne Gustav - Ханс Фаллада - Страница 34
На сайте Литреса книга снята с продажи.
10
ОглавлениеDer Oberarzt der chirurgischen Abteilung stand müde in seinem Arztzimmer und wusch sich wie immer, wenn er sehr abgespannt war, die Hände. Ganz gewohnheitsmäßig nahm er die kleine, scharfe Bürste, bürstete die Nägel, wusch mit Sublimatlösung nach, spülte ab und trocknete die Hände.
Er brannte eine Zigarette an, zog den Rauch tief ein, trat an das Fenster und sah gedankenvoll, nichts sehend, in den Krankenhausgarten. Er war müde, er war abgespannt, seit elf Stunden war er auf den Beinen, und es war noch kein Ende abzusehen …
Aber, dachte er, dies ist erst der Anfang. – Dies ist erst der Anfang …, dachte er langsam, und ohne besonders erregt oder verzweifelt zu sein. Dies ist erst der Anfang …
Vier Mobilmachungstage hatten ihm drei Viertel seiner Ärzte fortgeholt: Sie waren gegangen. – „Macht’s gut hier!“ hatten sie gesagt und waren gegangen. Drei Viertel der Ärzte fort, von dem Pflegepersonal gar nicht zu reden, und die Belegung war etwas über dem Durchschnitt. Nun ja, dies war also erst der Anfang …
Der Oberarzt legte die Zigarette in einen Aschenbecher, nach dem ersten Zug hatte er keinen weiteren mehr getan. Gedankenlos trat er wieder an die Wasserleitung und fing von neuem an, sich mit der eingelernten, tausendfach beobachteten Genauigkeit die Hände zu waschen und zu bürsten. Er wußte nicht, daß er es tat. Manchmal machte ihn ein Kollege darauf aufmerksam, oder die Operationsschwester sagte: „Sie waschen sich ja schon wieder, Herr Professor. Erst vor zwei Minuten waren Sie an der Leitung.“
Aber jetzt war keiner da, der ihn erinnern konnte. Sorgfältig bürstete er die Nägel …
„Macht’s gut!“ sagten sie und gingen. Aber wie konnte man es gut machen, mit knapp einem Viertel des normalen Ärztebestandes? Man mußte es ja schlecht machen, immerzu die Augen zudrücken, über die schrecklichsten Nachlässigkeiten fortsehen …
Es wird Menschen kosten, denkt er müde, und so lange er schon in seinem Beruf gearbeitet, an so vielen Krankenbetten er auch schon gestanden hat, er hat nie das Gefühl dafür verloren, daß da Menschen lagen, keine Fälle: Mütter, deren Kinder zu Haus weinen; Väter, auf deren Leben Glück und Wohlstand eines kleinen Gemeinwesens beruhen.
Es wird Menschen kosten, denkt er. Aber in der nächsten Zeit wird nichts so wohlfeil sein wie Menschenleben. Und es werden nicht nur die Kranken, die Verbrauchten, die Alten sterben – grade die Jugend wird fort müssen, die Jugend, die Gesundheit. Die Kraft des Volkes wird systematisch verringert werden, tagelang, wochenlang, vielleicht monatelang … Und ich stehe hier und jammere, daß ich einen vereiterten Blinddarm eine halbe Stunde zu spät operiere?
Er sieht um sich und horcht. Er steht schon wieder an der Wasserleitung und wäscht sich die Hände. Die Zigarette verschwelt im Aschenbecher, aber das hat ihn nicht aufmerksam gemacht. Langsam kommt ihm zum Bewußtsein, daß es vielleicht geklopft hat, und als er nun „Herein!“ sagt, tut sich wirklich die Tür auf, und eine Schwester tritt ein, etwas verlegen.
„Nun, Schwester, was ist denn?“ fragt er zerstreut und trocknet sich die Hände am Handtuch. „Ich gehe gleich noch einmal durch die Station. – Oder ist es eine Neuaufnahme?“
Die Schwester schüttelt den Kopf und sieht ihn an. Sie hat merkwürdige Augen, ein wenig scheu und doch trotzig; sie hat auch ein unausgeglichenes Gesicht, jung und doch scharf. Sie hat es wohl nicht immer leicht gehabt.
„Ich habe eine persönliche Bitte, Herr Professor“, sagt die Schwester leise.
„Damit gehen Sie aber besser zu Ihrer Oberin, Schwester. Sie wissen doch, daß Sie Ihrer Oberin unterstehen.“
„Ich war schon bei der Oberin“, sagt die Schwester leise. „Aber die Oberin hat es mir abgeschlagen. Und da habe ich gedacht, Herr Professor …“
„Nein, Schwester, nein“, sagt der Arzt energisch. „Einmal mische ich mich grundsätzlich nicht in die Angelegenheiten der Schwesternschaft. Und dann habe ich jetzt wirklich so viel um die Ohren …“
Er sieht die Schwester abschließend an, seufzt, schiebt die Ärmel hoch und geht zur Wasserleitung.
„Herr Professor hatten sich grade eben gewaschen, als ich hereinkam“, sagt die kleine Schwester mutig. (Der Tick des Oberarztes ist natürlich im ganzen Krankenhaus bekannt.)
„Danke schön, Schwester“, sagt der Professor. „Sie können der Operationsschwester – Sie wissen, Schwester Lilli – sagen, daß ich in zehn Minuten wieder anfange.“
Und er läßt sich das Wasser über die Hände laufen.
„Ja, Herr Professor.“ Sie sieht ihn zögernd, etwas ängstlich an. „Herr Professor, verzeihen Sie, daß ich noch einmal davon anfange … Es sind heute früh die bestimmt, die mit an die Front dürfen … Und ich – ich soll nicht mit …“
Der Oberarzt macht eine ärgerliche Gebärde. „Es können nicht alle mit!“ ruft er. „Es gibt auch hier Arbeit, sehr viel Arbeit, sehr notwendige Arbeit!“
„Herr Professor! Ich muß aber mit! Bitte, Herr Professor, sagen Sie der Frau Oberin, daß ich mit soll. Es kostet Sie doch nur ein Wort, Herr Professor …“
Der Oberarzt dreht sich um und sieht die junge Schwester wutfunkelnd an. „Und wegen solchem Dreck stören Sie mir meine paar freien Minuten?!“ ruft er zornig. „Schämen Sie sich was, Schwester! Wenn Sie Abenteuer mit jungen Männern haben wollen, dann brauchten Sie nicht Schwester zu werden! Das konnten Sie an jeder Straßenecke haben! Das ist Ihnen wohl zu langweilig, Ihr Saal mit alten Frauen … Ach, lassen Sie mich zufrieden, Schwester!“
Aber wenn der Oberarzt erwartet hatte, daß die Schwester nach diesem kräftigen und deutlichen Anpfiff nun begossen abziehen würde, so irrte er sich. Die Schwester Sophie stand, ohne zu weichen und zu wanken, vielleicht hatte sich sogar etwas von dem Scheuen in ihrem Auge verloren, und das Kraftvolle, das Trotzige darin war stärker geworden. Der Arzt sah es nicht ohne Interesse.
„Ich will nicht wegen der jungen Männer heraus“, sagte sie beharrlich. „Frau Oberin hat mich doch grade darum zu den alten Omis versetzt, weil ich mich für die Männerstation nicht eigne. Ich mag Männer nicht …“
„Schwester“, sagte der Professor milde. „Sie sollen mir hier keine Vorträge über Ihre Neigungen halten. Das interessiert mich nicht. Machen Sie, daß Sie auf Ihre Station kommen.“
„Jawohl, Herr Professor“, sagte sie mit unüberwindlicher Hartnäckigkeit. „Aber, Herr Professor, ich muß raus, und Sie müssen mir dazu helfen …“
„Himmeldonnerwetter, Schwester!“
„Herr Professor, ich habe nie einen Menschen ausstehen können, ich habe nie einen Menschen gern gehabt, meine Eltern nicht, meine Geschwister nicht. Und auch hier die Patienten nicht …“
„Großartig, Schwester!“ spottete der Arzt. „Ganz vorzüglich!“
„Nein, ich habe nie jemand leiden mögen, und auch mich hat nie jemand leiden mögen. Ich habe immer gedacht, man ist ganz unnütz … Und nun plötzlich – bitte, Herr Professor, hören Sie mich nur noch einen Augenblick an –, und nun plötzlich ist das gekommen mit dem Krieg. Ich verstehe nichts von Politik, Herr Professor, ich weiß nicht, wieso und warum. Aber plötzlich denke ich, ich könnt vielleicht doch noch etwas nützen und etwas Gutes tun und nicht ganz umsonst sein auf der Welt …“
Sie sah ihn einen Augenblick an.
„Vielleicht verstehen Herr Professor nicht, was ich meine, ich verstehe es ja selber nicht. Aber ich meine, daß die anderen, die Frauen, meine Schwester und so – die denken, daß sie mal Kinder haben werden und einen Mann, den sie gerne mögen. – Aber ich habe nie so etwas gehabt, Herr Professor! Ich habe mir nie denken können, wozu ich auf der Welt bin. Mein Vater …“
Sie brach ab. Dann: „Herr Professor, denken Sie nicht, daß ich so an junge Soldaten denke, denen man den Kopf hält und Wasser gibt … Nein, ich denke daran, daß ich laufen will und Arbeiten machen, die mir eklig sind, und vom Morgen zum Abend bis zum Umfallen und immer weiter. Und dann, Herr Professor, dann fühl ich vielleicht, daß ich nicht ganz umsonst bin auf der Welt …“ Fast mit einem Schluchzen: „Man möchte doch auch ein bißchen mehr gewesen sein als eine Fliege …“
Eine Weile war es stumm zwischen den beiden. Der Arzt trocknete sich mit langsamen Bewegungen die Hände ab, trat dann auf die Schwester zu, hob ihr den Kopf mit dem weinenden Gesicht, sah ihr in die Augen und fragte milde: „Schwester, glauben Sie, daß ein großes Volk darum in einen solchen Krieg zieht, damit – wie heißen Sie?“
„Sophie Hackendahl …“
„… damit Sophie Hackendahl sich nicht mehr überflüssig vorkommt im Leben?“
„Was weiß ich davon?!“ rief sie fast wild und befreite mit einer ungestümen Bewegung ihren Kopf aus seiner Hand. „Aber das weiß ich, daß ich jetzt einundzwanzig Jahre auf der Welt bin und nicht eine Stunde das Gefühl gehabt habe, ich bin zu irgend etwas nütze!“
„Vielleicht“, sagte der Arzt überlegend, „ist wirklich auch darum dieser Krieg gekommen, daß der Mensch wieder spürt, er ist zu irgend etwas da im Leben. Vielleicht.“ Er sah die Schwester an. „Also, ich will sehen, was ich bei Ihrer Oberin erreiche. Soviel ich weiß, sind Sie bei ihr nicht sehr gut angeschrieben. Aber wie ich jetzt weiß, sind Sie wenigstens in diesem Punkte mit Ihrer Oberin ganz einig …“
Der Arzt lächelte, Sophie lächelte schwach, neigte dankend den Kopf und ging.
Der Oberarzt trat wieder an die Wasserleitung.