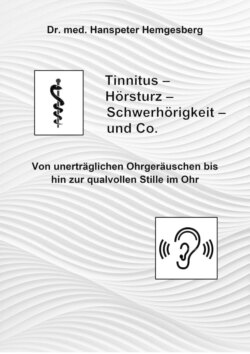Читать книгу Tinnitus, Hörsturz & Co. - Hanspeter Hemgesberg - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Otosklerose
ОглавлениеDie Otosklerose ist eine mit überschießender Knochenbildung einhergehende Erkrankung des knöchernen (Innenohr-)Labyriths () mit Auswirkungen auf Mittelohr und/oder das Innenohr.
Entstehung der Krankheit und Vorkommen
Die Ätiologie der Krankheit ist bis heute (Frühjahr 2021) noch nicht restlos geklärt.
Das ‚knöcherne Labyrinth‘ wird, in der Regel beiderseits, herdförmig aufgelöst und neu gebildet. Dabei kommt es zu einer stets zunehmenden Fixierung der Fußplatte des Steigbügels (stapes – einer der drei Gehör-Knöchelchen) am Ovalen Fenster (fenestra ovalis vestibuli – d.i. die ovale Öffnung in der dem Labyrinth zugewandten Wand der Paukenhöhle) und dadurch zu einer fortschreitenden „Schallleitungs-Schwerhörigkeit“ (s. später).
Das neugebildete Knochengewebe ist funktionell minderwertig und obliegt mit steigendem Alter der Patienten einer verstärkten Kalzifikation (Verkalkung).
Es handelt sich dabei um einen mehrphasigen, unbehandelt fortschreitenden Knochen-Umbauprozess mit Sklerosierung (Verhärtung z.B. von Geweben) des enchondralen Knochens der Labyrinth-Kapsel.
Heute wird davon ausgegangen, dass bei ca. 25% der Kranken ein ‚hereditärer, autosomal-dominanter Erbgang‘ vorliegt.
Frauen sind doppelt so häufig betroffen, ein Einfluss der weiblichen Geschlechtshormone wird zurzeit diskutiert.
Vermutet wird auch eine Virus-Genese (Nachweis von Masern-Virus-Genomen – Genom = einfacher Chromosomensatz einer Zelle, der deren Erb-Masse darstellt in osteoklastischen und otosklerotischen Bereichen), sowie ein Auto-Immunprozess.
Verbreitung und Auftreten
Der Erkrankungsbeginn liegt meist zwischen dem 20. und dem 40. Lebensjahr. Klinisch kommt die Erkrankung bei ca. 10 Fällen/100.000 Einwohner/Jahr vor.
Lokalisation
Am häufigsten ist das knöcherne Labyrinth im Bereich des ovalen Fensters (Kommunikation zwischen Mittelohr und Innenohr) betroffen. Durch Umbau und Verknöcherungen in diesem Bereich kommt es zum Anwachsen des Steigbügels an das ovale Fenster (‚Stapes-Ankylose‘ – Ankylose = vollständige Gelenksteife). Die Funktion der drei Gehörknöchelchen (Amboss, Hammer, Steigbügel) wird dadurch beeinträchtigt.
Seltener ist der knöcherne Anteil der Cochlea (Schnecke, Teil des Innenohrs) betroffen. Die Sinneszellen des Innenohrs werden dadurch in Mitleidenschaft gezogen, die Homöostase () von Perilymphe (lymph-ähnliche Flüssigkeit zwischen häutigem und knöchernen Labyrinth des Innenohrs) und Endolymphe (d.i. eine Kalkium-reiche Flüssigkeit, die für die Funktion des Hörorgans und des Gleichgewichtsorgangs erforderlich ist) wird nachhaltig gestört. Es entsteht eine „Innenohr-Schwerhörigkeit“ (s. später).
Symptome
Eine Otosklerose führt zu einer Reihe von anamnestisch erfassbaren Symptomen/Beschwerden wie:
zunehmende Schwerhörigkeit
fast so etwas wie ein ‚Paradoxon‘: das Hörvermögen ist Lärm subjektiv besser als bei Stille!
Parakusis (tiefe Töne und Geräusche werden nicht wahrgenommen, Sprache besser)
„tiefes Ohrensausen“ (Tinnitus)
Lage-Haltung-bedingter Schwindel
Diagnostik
1. Akribische Anamnese
2. HNO-Untersuchung
3. Hörteste
(vgl. chronische Otitis media)
Merke:
„Wegweisend auf eine Otosklerose ist das Vorliegen einer Schallleitungs-Schwerhörigkeit!“
4. Ton-Audiogramm
[es zeigt im Frequenzbereich 1.000 und 4.000 Hz einen Hörverlust = „Carhart-Senke“]
5. einfache Hörtests
[Rinne-Versuch negativ, im Weber-Versuch erfolgt eine Seitwärtsverlagerung zur betroffenen/kranken Seite hin]
6. Gellé-Versuch
[Prüfung der Beweglichkeit der Gehörknöchelchen = negativ]
7. Impedanz-Prüfung
[Impedanz = akustischer Widerstand]
8. Subjektive Hörprüfungen
8.1 Hörweiten-Prüfung (Sprach-Abstandsprüfung)
8.2 Stimmgabel-Prüfung
9. Objektive Testverfahren
9.1 Tympanometrie (Impedanz-Audiometrie)
9.2 Steigbügel-Reflexmessung (bei Otosklerose nicht auslösbar)
10. Otoskopie (evtl. ist ein „Schwartz-Zeichen“ zu sehen; d.i. eine Hyperämie des Promantoriums und der ovalen Nische als Ausdruck des floriden Prozesses)
11. Computer-Tomogramm Innenohr
Merke:
Eine Beteiligung des Innenohrs oder die ausschließliche Lokalisation der Otosklerose im Innenohr führt zur Innenohrschwerhörigkeit. Diese kann in Kombination mit der Schallleitungsschwerhörigkeit zu stark ausgeprägten pathologischen Befunden führen.
Therapie
Mikrochirurgische HNO-Operation
[Die Therapie der Otosklerose ist in der Regel operativ und wird in Form einer Stapedomie mit Entfernung der Steigbügel-Fußplatte = Methode der 1. Wahl – die OP ist sinnlos, wenn das Innenohr bereits „funktionslos“ ist]
Alternativ können zur Verbesserung des Hörvermögens eingesetzt werden:
Hörgeräte
Implantate