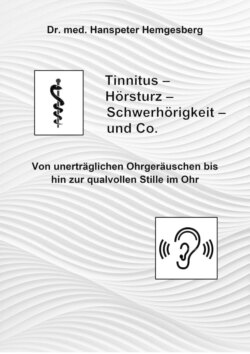Читать книгу Tinnitus, Hörsturz & Co. - Hanspeter Hemgesberg - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Akustikus-Neurinom
ОглавлениеDefinition
Das Akustikusneurinom (AKN) ist ein gutartiger (benigner) Tumor der ‚Schwann’schen Zellen‘ (d.i. eine spezielle Form der Gliazelle [d.i. ein Sammelbegriff für Zellen im Nervengewebe, die sich strukturell und funktionell von den Nervenzellen/Neuronen abgrenzen lassen. Die Schwann’schen-Zellen bilden eine Hüll- und Stütz-Zelle, die das Axon [Neuraxon oder Achsenzylinder – Nervenzell-Fortsatz, ein Neurit, der in einer Hülle von Gliazellen verläuft und zusammen mit dieser Umhüllung als ‚Nervenfaser‘ bezeichnet wird] – Sie bildet eine Hüll- und Stützzelle, die das Axon einer Nervenzelle im peripheren Verlauf umhüllt und bei markhaltigen Fasern durch eine Myelinhülle elektrisch isoliert) des vestibulären Anteils des 8. Hirnnerven – Nervus vestibulo-cochlearis –.
Synonyme:
Vestibularis-Schwannom, Schwannogliom, Oktavusneurinom
Vorkommen
Akustikusneurinome gehören zu den häufigsten ‚intra-kraniellen Tumoren‘. Die Inzidenz [Häufigkeit von Ereignissen – insbesondere von neu auftretenden Krankheitsfällen – innerhalb einer Zeitspanne und Personengruppe] liegt bei ca. 1 Neuerkrankungen je 100.000 Einwohner.
Typischerweise werden die Tumoren nach dem 30. Lebensjahr klinisch auffällig. Die Inzidenz gipfelt im 5. und 6. Lebensjahrzehnt, wobei beide Geschlechter etwa gleich häufig betroffen sind.
Akustikusneurinome treten meist einseitig auf.
Bei Neurofibromatose Typ 2 (NF2 – d.i. neben der NF1 und der Schwannomatose ein ‚hereditäres‘ Tumor-Syndrom aus dem Formenkreis der Neurofibromatose) tritt das Akustikusneurinom hingegen beidseitig auf.
Histopathologie
Das Akustikusneurinom imponiert im patho-histologischen Präparat durch Fibrillen-Bündel, lang-gezogene Zellen mit in sogen. „Palisaden-Stellung“ aufgereihten Nuclei sowie anderen regressiven Veränderungen.
Einteilung
Nach Lage des Akustikusneurinoms unterscheidet man:
1. Intrameatales AKN
Lage innerhalb des Gehörganges – = häufigerer Typ
2. Extrameatales AKN
Lage im Kleinhirnbrückenwinkel – seltener Typ
Krankheitsverlauf
Die klinischen Symptome treten ‚ipsilateral‘ [auf derselben Körperseite oder –hälfte gelegen. – Gegenteil: ‚kontra-lateral‘] auf der vom Tumor betroffenen Seite auf; sie zeigen typischerweise ein langsames Fortschreiten und Zunahme der Beschwerden.
Symptome
Dazu zählen:
Schallempfindungs-Schwerhörigkeit
vor allem für hohe Töne ab 1.000 Hz
Gleichgewichts-Störung
mit unsystematischem diskretem Drehschwindel, inkonstantem Schwankschwindel oder Gangabweichungen
Ohrgeräusche (Tinnitus aurium)
Bei ca. 80% der Betroffenen; er wird zumeist unilateral als hochfrequentes Klingeln oder maschinenartiges Zischen wahrgenommen. Vielmals tritt der Tinnitus rezidivierend auf.
Hitselberger-Zeichen
[d.i. ein Sensibilitäts-Ausfall des hinteren oberen Abschnittes des äußeren Gehörgangs (Meatus acusticus externus), der durch einen Ausfall des ‚Ramus auricularis nervi vagi‘ (Arnold-Nerv - d.i. ein sensibler Ast des N. Vagus = 10. Hirnnerv; er ist der größte Nerv des Parasympathicus und er ist an der Regulation der Tätigkeit fast aller inneren Organe beteiligt) bedingt ist.
Das Hitselberger-Zeichen tritt u.a. im Rahmen eines AKN auf, wobei es am Kleinhirnbrückenwinkel (Angulus pontocerebellaris – d.i. eine nischenartige Vertiefung an der hinteren Hirnbasis, die von den Kleinhirntonsillen und dem kaudalen Brückenrand bzw. verlängerten Mark des Hirnstamms begrenzt ist) zu einer Kompression der versorgenden Nervenfasern kommt. Es besitzt für diese Erkrankung eine hohe Sensitivität, aber nur eine mäßige Spezifität.
Ausfall des N. Facialis
[7. Hirnnerv – Gesichtsnerv (Nervus intermedius)
Aber:
Viele AKN-Patienten zeigen keine vestibulären Symptome, trotz schwerster vestibulärer Unterfunktion bei der thermischen Prüfung. Der Körper kann den vestibulären Ausfall zentral kompensieren.
Komplikationen
Größere Akustikusneurinome können darüber hinaus andere Hirnnerven in Mitleidenschaft ziehen; z.B. in Form einer Kompression des N. Trigeminus (5. Hirnnerv) mit nachfolgenden Sensibilitätsstörungen im Gesicht oder als Irritation des N. Facialis (s.o.) mit der Folge einer Gesichtslähmung und mit sogen. Tic convulsif/Spasmus facialis (= Fazialiskrämpfe).
In schweren Fällen führen die AKN mitunter zur Hirnstamm-Kompression und sie verursachen dann eine intrakranielle Druckerhöhung, die sich durch Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Bewusstseinsstörung manifestiert.
Auch können zerebelläre (Kleinhirn) Symptome hervorgerufen werden wie z.B. Doppelbilder-Sehen, Gangstörung.
Diagnostik
Die Diagnostik sollte erfolgen nach der „Leitlinie Akustikusneurinom“ der
Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie e.V (DGNC) in Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft Akustikusneurinom e.V. (IGAN). Die Leitlinien legen das Procedere fest für Diagnostik und Therapie.
Bewährtes diagnostisches Vorgehen:
1. akribische Anamnese
[bei Kindern und Jugendlichen sollte unbedingt ein Elternteil bzw. ein Erziehungsberechtigter mit hinzugezogen werden – bisheriger Krankheitsverlauf seit den ersten Beschwerden/Störungen, aktuelle Beschwerden]
2. Körperlicher Gesamtstatus
[i.d.R. durch den Hausarzt bzw. bei Kindern & Jugendlichen durch den Kinder- und Jugendarzt]
3. HNO-ärztliche Untersuchung
4. Bildgebende Verfahren
4.1 Zerebrales Computertomogramm/cCT mit Kontrastmittel(verstärkung)
4.2 Zerebrales Kernspintomogramm/cMRT mit KMontrastmittel(verstärkung)
4.3 Doppler-Duplex-Sonographie der intrazerebralen Arterien
5. HNO-fachärztliche Untersuchungsverfahren
5.1 Tonschwellen-Audiogramm
[zur Quantifizierung der Hörminderung]
5.2 Akustisch-Evozierte Potentiale/AEP
[als frühe Akustisch-Evozierte Potentiale/BERA]
5.3 Hirnstamm-Audiometrie
Hinweis:
Durch die Kombination von cMRT mit Kontrastmittel + BERA kann die Diagnose „AKN“ mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gestellt werden!
6. (Ergänzende) Labor-Diagnostik
6.1 Untersuchungen im Blut
Differentialblutbild, unspezifische Entzündungs-Parameter: CRP, BSG/BKS, Serum-Elektrophorese mit Gesamteinweiß; Tumormarker: CEA (Carcino-Embryonales Antigen), Tymidinkinase/TK
6.2 Untersuchungen im 24-Stunden-Sammelurin
Vanillinmandelsäure/VMS, Metanephrine, Homovanillinsäure/HVS
6.3 Untersuchungen im Liquor
(nach Lumbalpunktion/LP)
Hinweis:
LP und serolog. Parameter sollten simultan ausgeführt werden!
Liquor-Diagnostik (Gesamteiweiß, Albumin, IgA, IgM, IgG, oligoklononale Banden, Laktat, Glukose, aktivierte B-Lymphozyten); Tumormarker: CEA, TK
Differential-Diagnostik
Dazu kommen in Betracht:
M. Ménière
Meningeom
Herpes Zoster Oticus
Hirnmetastasen
von einem sonst bestehenden ‚malignen Primär-Tumor‘
Lymphom
[Sammelbegriff für chronische Lymphknotenvergrößerungen beziehungsweise Lymphknotenschwellungen und Tumoren des Lymphgewebes]
Sarkoidose (M. Boeck)
[d.i. granulomatöse Entzündung. Sie kann prinzipiell jedes Organ befallen; am ehesten betroffen die Lunge]
Schwannon
(s.o.) des N. facialis oder anderer Hirnnerven
Therapie
Wie schon für und bei der Diagnostik sollte unbedingt verfahren werden nach der „Leitlinie Akustikusneurinom“.
Mikrochirurgische Entfernung des AKN
= „Methode der 1. Wahl“
Bei frühzeitiger OP können die Hörfunktion und der N. facialis erhalten bleiben.
OP kleinerer AKN
sie werden von der mittleren Schädelgrube aus operiert
OP größerer AKN
Sie werden operiert über einen subokzipitalen Zugang
Alternativen:
Radiochirurgie
Radiotherapie (Strahlentherapie)
Hinweis:
Die Entscheidung für ein „invasives“ oder „Nicht-invasives“ Vorgehen ist unter anderem von der Größe des Tumors, von der Schwere der Symptomatik und vom Lebensalter des Kranken und dem Allgemeinzustand/AZ des Patienten abhängig.
Prognose
Die Prognose ist in der Regel gut.
Bei älteren Patienten ist ein beobachtendes Abwarten – sogen. „watchful waiting" – zu rechtfertigen.