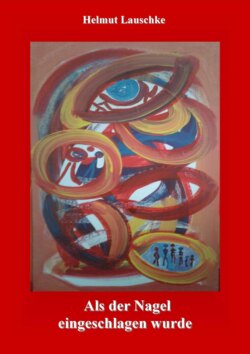Читать книгу Als der Nagel eingeschlagen wurde - Helmut Lauschke - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Dorfbrunner vor der Einstellungskommission in der Ernst Thälmann-Grundschule
ОглавлениеAm nächsten Morgen klopfte Eckhard Hieronymus zehn vor neun an der Sekretariatstür. “Herein!”, rief eine harte Frauenstimme. Er ging hinein und traf auf eine hagere Frau der frühen Fünfziger im weißen KLeid mit roten und gelben Punkten, einem blassen, ausdruckslosen Gesicht mit Stupsnase und dauergewelltem braunen Haar mit grauen Streifen und verbissenen Lippen hinter dem Schreibtisch sitzen. Eckhard Hieronymus erinnerte sich, dass er solche ‘geschlechtslosen’ Wachteltypen mit der ausdruckslosen Gesichtigkeit zu hunderten in der alten, deutschen Zeit in den Sekretariaten angetroffen hatte. “Haben Sie eine Absprache mit Herrn Krautsch?”, fragte sie in der Sprache des Grundschulneutrums unverbindlich hart und weltenweit vom Funken eines Charmes entfernt. Eckhard Hieronymus bejahte die Frage und sagte, dass er sich pünktlich bei ihm melden solle. “Dann warten Sie, bis er kommt!”, sagte sie barsch und ohne jede sprachliche Politur. Er wartete, und das noch länger, bis es neun Uhr vorbei war. Eckhard Hieronymus fragte sie, ob sie nicht nachschauen könne, wo Herr Krautsch ist. “Was sind das denn für Allüren, noch nachsehen, wo der Rektor ist!”. Das war die Spitze einer kurzen sekretärialen Steigerung morgens gegen neun in der Ernst Thälmann-Grundschule.
Die Tür ging auf, Herr Krautsch kam raus: “Sind Sie der Herr Dorfbrunner?” E.H.: “Ja, der bin ich.” Rektor: “Wo bleiben Sie denn? Ich habe ihnen doch am Telefon gesagt, sich pünktlich bei mir zu melden.” E.H.: Seit zehn vor neun stehe ich in ihrem Sekretariat.” Der Rektor warf der Sekretärin einen scharfen Blick zu, die ihren Mund geschlossen und ihr Gesicht über dem Schreibblock gesenkt hielt und sich auf die altbekannte Weise der Verantwortung entzog. Rektor: “Kommen Sie mit, die Leute von der Kommission warten schon.” Sie gingen den langen Flur mit der Fensterfront zur Straße und betraten das letzte Klassenzimmer mit seinen drei Fenstern zum Schulhof. Die niedrigen Schulbänke und Stühle waren ans hintere Ende des Klassenraumes zusammengeschoben. Ein langer Tisch stand am anderen Ende, wo die Tafel an der Wand war. Hinter dem Tisch saßen vier Herren, zu denen sich der Rektor als Fünfter hinzusetzte und seinen Platz rechts außen einnahm. In der Mitte des Fünferrates saß offenbar der Vorsitzende der Befragungskommission, ein Mann der Vierziger mit dem neuen ovalen Parteiabzeichen an seiner grauen Jacke. “Nehmen Sie Platz!” Das war leichter gesagt als getan, denn für Eckhard Hieronymus gab es gar keinen Stuhl. Die niedrigen Stühle, die mit den Bänken nach hinten gerückt waren, um Platz für den Tisch und den Fünferrat zu bekommen, waren zu klein. So schob er eine Schulbank, hinter der gewöhnlich zwei Schüler beim Unterricht zu sitzen haben, von hinten nach vorn und setzte sich auf die Bank. Keiner von den Fünfen hatte seine Hilfe zum Tragen der Schulbank angeboten, geschweige denn war aufgestanden und hatte die sozialistische Bruderhilfe geleistet.
Vorsitzender: Name? E.H.: Dorfbrunner.
Vorsitzender: Vorname? E.H.: Eckhard Hieronymus.
Vorsitzender: Alter? E.H.: 54 Jahre.
Vorsitzender: Beruf? E.H.: Pfarrer der evangelisch-lutherischen Kirche.
Vorsitzender: Stellung zuletzt? E.H.: Superintendent in Breslau.
Vorsitzender: Familienstand? E.H.: Verheiratet.
Vorsitzender: Kinder? E.H.: Eine Tochter; ein Sohn, an der Front verschollen.
Vorsitzender: Gegenwärtiger Wohnort? E.H.: Hof Pommern. Ein Beisitzer machte ein ungläubiges Gesicht: “Was sagen Sie da? Pommern ist doch polnisch!” E.H.: Ich meine den Bauernhof im Dorf Pommern (allgemeines Schmunzeln).
Vorsitzender: Arbeiten Sie in der Landwirtschaft? E.H.: Ja, wenn Not am Mann ist (ungläubige Blicke)
Vorsitzender: Wer ist Ernst Thälmann? E.H.: Ein Führer der Kommunistischen Partei, der wie Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg ermordet wurde.
Vorsitzender: Was ist Materialismus? E.H.: Materialismus ist die Wissenschaft zum Anfassen.
Vorsitzender: (mit verstörtem Gesicht) Wie meinen Sie das? E.H.: Es ist die Betrachtung der Welt, die sich um die Materie dreht. Die Eisenkugel wird angeschaut, vermessen, gewogen, ins Rollen gebracht oder in die Luft gestoßen, wo die Entfernung der nach dem Wurf auf den Boden aufschlagenden Kugel zum Kugelstoßer gemessen, die Formel der Wurfparabel aus der photographischen Verlaufsaufnahme berechnet wird.
Vorsitzender: Was ist dialektischer Materialismus? E.H.: Das ist Materialismus in der sublimierten Form.
Vorsitzender: Was ist das für eine Form? E.H.: Das ist die verfeinerte Form des Materialismus in die einzelnen Bestandteile der betrachteten Materie. Hier richtet sich das Denken nach der Vorgabe und Betrachtungsweise der Materie. Bleiben wir bei der Eisenkugel: die Richtungskräfte sind zu bestimmen, welche Widerstände wo und wie zu überwinden sind, damit die Kugel ins Rollen kommt oder ihre Wurfbahn durch die Luft nimmt. Dialektik ist das Denken in den Gegensätzen, in der positiven und negativen Beschleunigung, in den unterschiedlichen Aggregatzuständen, in physikalischen und chemischen Vorgängen, ihren Kopplungen und Rückkopplungen, in den Wärmegesetzen und Halbwertszeiten.
Herr Krautsch, Rektor der Ernst Thälmann-Grundschule, war von den Antworten sichtlich angetan. Er lächelte dem auf der Schulbank sitzenden Prüfling zu.
Vorsitzender: Was ist Revolution? E.H.: Revolution ist der Umlauf eines Himmelskörpers um sein Zentralgestirn. Sie ist die gewaltsame Unterbrechung oder der abrupte Abbruch der Kontinuität im Verlauf einer Entwicklung. Revolution ist das andere Ende zur Evolution. Sie ist der Umsturz in einer Klassengesellschaft. Es kommt zum Kopfstand, anders gesagt, die Gesellschaft steht auf dem Kopf, wobei nach oben kommt, was unten war, und umgekehrt.
Vorsitzender: Eine letzte Frage: Was ist Sozialismus? E.H.: In der Theorie oder in der Praxis?
Vorsitzender: Beginnen Sie mit der Theorie. E.H.: Sozialismus ist der Lehre gegen die wirtschaftliche Ausbeutung der Arbeiter und Bauern. Sie lehrt die Gleichheit, wenn es um die Verwendung der Produktionsmittel und die Verteilung der materiellen Güter, zum Beispiel die Verteilung von Nahrungsmitteln geht. Alle sollen gleichviel zu essen bekommen. Keiner soll hungern, frieren oder sonstwie benachteiligt werden, besonders die Kinder nicht. Das ist zu erreichen durch das sozialistische Bewusstsein mit der Verantwortung, wenn die Theorie in die Praxis umgesetzt wird. Im Sozialismus sollte sich keiner überfressen, wenn andere nicht genug zu essen haben. Keiner sollte mehr Kohle als der andere bekommen, um seine Zimmer zu heizen. Viele Beispiele wären zu erwähnen, bei denen gravierende Ungleichheiten korrigiert werden müssten.
Vorsitzender: Und Sozialismus in der Praxis? E.H.: Das hängt davon ab, wieweit die Menschen die Theorie des Sozialismus verstanden haben und sich in Selbstdisziplin mit dem Verantwortungsbewusstsein gegenüber ihren Mitmenschen fordern und üben. Es muss sich noch zeigen, ob die Menschen dazu fähig sind, ohne Profithascherei die Produktionsmittel gemeinsam zu verwenden und die Güter, wie Kohle und Nahrungsmittel gleichmäßig und gerecht zu verteilen. Wenn nicht, dann bleibt der Sozialismus ein leeres Lippenbekenntnis, weil die Menschen es nicht lassen können, ihren Vorteil zu suchen und sich auf Kosten anderer zu bereichern. Die Zeit wird es zeigen, wieweit es die Menschen mit dem Sozialismus ernst meinen, der ja viel mehr sein soll als die Gleichheit in der Faulheit. Sehen Sie, Herr Vorsitzender, ein kleines Beispiel, dass der Sozialismus noch nicht ganz verstanden ist, von der fehlenden Höflichkeit will ich nicht sprechen, hat sich eben noch vor ihren Augen abgespielt, als ich die Schulbank allein von hinten nach vorn bringen musste, um mir eine Sitzgelegenheit zu verschaffen, als Sie sagten, ich solle mich setzen. Keiner ihrer Herren hat auch nur im Geringsten erkennen lassen, dass er die Theorie des Sozialismus in die Praxis dadurch umgesetzt hätte, indem einer von ihnen mir beim Vorbringen der Schulbank geholfen hätte. Sehen Sie, da haben Sie ein frühes Beispiel unmittelbar vor ihren Augen gehabt, dass die Lehre des Sozialismus eine gute Lehre für mehr Gleichheit und Gerechtigkeit ist, die aber nicht zieht, ich will sagen, die Sie vergessen können, wenn die Theorie nicht die Tat motiviert und in die Tat umgesetzt wird, weil es die Tat ist, die letztlich entscheidet und überzeugt. (Einige bekamen einen roten Kopf, andere pressten die Lippen zusammen, alle schauten grimmig drein.)
Vorsitzender: Herr Dorfbrunner, bei ihrer letzten Ausführung schließe ich die Möglichkeit nicht aus, dass sie über das Ziel hinausgeschossen sind. Das ist alles von meiner Seite.
Eckhard Hieronymus ließ diese Bemerkung kommentarlos durch den Raum schweben, weil ihn die Vermutung nicht losließ, dass die Menschen für den praktizierten Sozialismus mit dem gerechten Teilen nicht reif genug, dagegen viel zu gierig und zu neidisch sind.
Nun ging der Mittelinksbeisitzer in vornüber gebeugte Stellung, ein junger Mann mit leichtem Schielfehler, der mit rotem Hemd und offenem Kragen und hochgekrempelten Ärmeln dasaß und die Arme vor sich überkreuzt hielt. Auch ihm steckte das neue, ovale Abzeichen mit dem Händeschluss an.
Linksbeisitzer: Haben Sie schon einmal Steine geputzt? E.H.: Ich verstehe nicht, was Sie mit Steineputzen meinen.
Linksbeisitzer: Von Steinen den Zement abklopfen, das ist Steineputzen. E.H.: Nein, das habe ich noch nicht getan.
Linksbeisitzer: Wenn Sie hier Lehrer werden wollen, dann wird ihnen hierzu reichlich Gelegenheit gegeben. Denn Sie haben es sicherlich gesehen, dass die Schule einige Treffer abbekommen hat. Die Löcher in den Wänden müssen zugemauert, einige Wände geschlossen und andere neu hochgezogen werden. Dazu sind Ziegel nötig, die aus den eingestürzten Wänden herausgeschlagen und geputzt werden. Wie gesagt, Sie werden genügend Gelegenheit haben, sich mit den Schülern der Klasse, die ihnen Herr Krautsch zuteilen wird, aktiv am Wiederaufbau der Schule zu beteiligen. Auch das ist praktizierter Sozialismus.
E.H.: Dagegen ist nichts einzuwenden, solange auch hier das Prinzip der Gleichheit zur Anwendung kommt und eingehalten wird.
Linksbeisitzer: Kommen wir nun zu ihren fachlichen Qualitäten. Sie sagten, dass Sie Pfarrer in Breslau waren und zuletzt die Stellung eines Superintendenten innehatten. Doch mit Religion ist auch an dieser Schule kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Ich frage Sie deshalb, was Sie als Lehrer an der Ernst Thälmann-Grundschule bieten können. Verstehen Sie mich richtig, wir sind da nicht engstirnig, solange garantiert ist, dass den Schülern ein Wissen vermittelt wird, das den Anforderungen der neuen Gesellschaft entspricht und gerecht wird. Das geht vom Rechnen mit dem kleinen Einmaleins, über das Lesen und Schreiben der Muttersprache, den ersten Grundkenntnissen in den naturwissenschaftlichen Fächern bis zum Russisch als erste Fremdsprache. Was haben Sie da zu bieten?
E.H.: Außer Russisch können Sie es bei den von ihnen genannten Fächern belassen, in denen ich imstande wäre, als Lehrer den Kindern die notwendigen Grundlagen zu vermitteln.
Linksbeisitzer: Wie ist es mit der Geschichte der russischen Revolution und der kommunistischen Partei Deutschlands, den deutschen Sozialisten und Sozialdemokraten. Können Sie den Kindern erklären, wie es zur Bildung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands kam und was das für die antifaschistische und antikapitalistische Bewegung in der neuen Gesellschaft bedeutet? E.H.: Ich glaube schon, dass ich das kann.
Linksbeisitzer: Mit “glaube” kommen wir da nicht weit. Können Sie es, oder können Sie es nicht? E.H.: Ich kann es.
Linksbeisitzer: Das werden wir dann sehen. Das ist alles von meiner Seite.
Rektor Krautsch machte noch ein paar allgemeine Bemerkungen. So sagte er, dass bei dem bestehenden Lehrermangel damit gerechnet werden muss, dass eine Lehrkraft von einem Tag auf den andern in einer anderen Klasse zu unterrichten hat. Auch müsse der Lehrer flexibel sein, in allen Fächern den Unterricht zu halten. Ein Grundschullehrer ist universal ausgerichtet im Gegensatz zum Lehrer an der Oberschule. Damit war die Befragung vor der Einstellungskommission beendet. Der Vorsitzende entließ Eckhard Hieronymus, und Herr Krautsch fügte an, dass er im Sekretariat auf ihn warten solle. Er ging den langen Flur zurück an den Jungen und Mädchen in der gestopften und geflickten, meist ärmlichen Kleidung der ersten Nachkriegszeit vorbei, die aus den Klassen kamen, um sich die Pause auf dem Schulhof zu vertreten, der auch ein Bauhof war, auf dem die geputzten Steine zu Blöcken aufgeschichtet waren.
Nach dem Klopfzeichen an die Tür hörte er das hart gesprochene “Herein!”, und nach Öffnen der Tür sah er das blasse, ausdruckslose Gesicht der hageren Sekretärin mit der Stupsnase und den verbissenen Lippen hinter dem Schreibtisch sitzen. Er sagte, dass er auf Herrn Krautsch zu warten habe. Die Sekretärin sah mit einem Stift in der rechten Hand auf irgendwas auf dem Schreibtisch und hörte sich das, was Eckhard Hieronymus ihr sagte, kommentarlos an. Sie fummelte weiter an einem Papier herum und war mehr mit sich beschäftigt als mit dem anderen, dem sie als Sekretärin die Aufmerksamkeit zu geben hatte. Eckhard Hieronymus seinerseits machte sich Gedanken über die eben beendete Prüfung, die in Form und Fragestellung die ungewöhnlichste seines Lebens war. Er machte sich nichts vor, als er sich kritisch gegenüber blieb und meinte, dass er die Prüfung alles andere als mit Bravour bestanden habe. Dabei war er sich nicht einmal klar, ob er sie überhaupt bestanden hatte. Zu strickig waren manche Fragen, als dass sie auf der Grundlage des allgemeinen Wissens bei Anwendung des normalen Menschenverstandes im unverbildeten Geradeausdenken zu beantworten gewesen wären.
Der Rektor trat ins Sekretariat, warf einen Blick auf den Schreibtisch und das Gefummel der hinter dem Schreibtisch sitzenden Sekretärin, nahm Eckhard Hieronymus mit in sein Zimmer und schloss die Tür. “Herr Dorfbrunner”, sagte er, “ich hoffe, Sie haben die Prüfung gut überstanden. Beim Resultat standen Sie dann doch auf der Kippe. Da sprang ich für Sie ein und bewahrte Sie vor dem Prüfungsabsturz. Daraufhin hat die Kommission beschlossen, Sie als Lehrer an der Ernst Thälmann-Grundschule mit einer einjährigen Probezeit einzustellen. Dafür meinen Glückwunsch!” Eckhard Hieronymus nahm es ohne Erwiderung hin, dachte an die Probezeit als frisch eingestellter Pfarrer, die ihm Konsistorialrat Braunfelder in Burgstadt für ein Jahr aufgebrummt hatte, war dann mit den Gedanken beim Abschiedsgespräch mit dem jungen Pfarrer Rudolf Kannengießer in der Deutschstraße 25 in Breslau, der von der deutschen Schuld und dem kläglichen Versagen der Kirche sprach, die ihren Auftrag nicht erfüllt habe, das Unrecht laut und deutlich anzuprangern und den armen, verfolgten und gequälten Menschen zu helfen. Er sagte, dass das, was in den Konzentrationslagern geschehen ist, vor der Welt unentschuldbar bleibt, wofür die kommenden deutschen Generationen zu büßen haben werden.
Herr Krautsch sah die Abwesenheit des frisch eingestellten Lehrers. “Herr Dorfbrunner”, sagte er, “sind Sie noch da?” Eckhard Hieronymus schaute den Rektor aus erschrockenen Augen an: “Ja!, was ist?” “Sie können in der nächsten Woche hier anfangen. Sind Sie Montag pünktlich um acht Uhr im Sekretariat. Ich werde ihnen eine der oberen Klassen zuteilen, denn das Unterrichten in den Anfängerklassen dürfte für Sie zu schwierig sein”, setzte Herr Krautsch aus seiner Unterrichtserfahrung und Einschätzung der Persönlichkeit des eingestellten alten Neulehrers hinzu. Nachdem sich Eckhard Hieronymus Dorfbrunner von ihm verabschiedet hatte, setzte sich Herr Krautsch an seinen Schreibtisch und legte die Personalakte “Dorfbrunner” an, in die er neben den üblichen Daten zur Person den Prüfungsverlauf und das geprüfte Ergebnis ebenso notierte wie seine persönliche Einschätzung zur Persönlichkeit des Neulings. Da vermerkte er: intelligent, nicht einfach, rebellisch, neigt zu gedanklicher Abwesenheit. Dahinter setzte er das Geheimzeichen [K], das ihn beim Lesen der Akte erinnern soll, dass im Fall Dorfbrunner der Kommandant mit dabei war beziehungsweise seine Hände im Spiel hatte.
“Das ist eine erschütternde Geschichte. Und dieser Dorfbrunner hat dann auch an der Ernst Thälmann-Grundschule unterrichtet”, sagte Heinz Töpfer.
“Ja, das stimmt”, erwiderte ich. “Eckhard Hieronymus war der älteste Lehrer an dieser Schule. Er unterrichtete Deutsch und Mathematik in der fünften und die Naturwissenschaften Biologie und Physik sowie Gesellschaftskunde in der siebten Klasse. Die Umstellung von der Sütterlinschrift in die lateinische Schreibweise hatte ihm anfangs Schwierigkeiten gemacht, die er durch abendliche Schreibübungen in der kleinen Stadtwohnung schnell gelöst hatte. Das größere Problem war die Gesellschaftskunde, die er unterrichten musste, wenn er seine Stellung nicht schon nach dem Probejahr verlieren wollte.
Es war die Zeit, als die Straßen und Plätze dreisprachig in Russisch, Deutsch und Sorbisch ausgeschildert waren. Um zu verstehen, was Gesellschaftskunde im Arbeiter- und Bauernstaat bedeutete, las Eckhard Hieronymus das Kommunistische Manifest und das ‘Kapital’. Es war der Gesellschaftskundeunterricht, dem Rektor Krautsch seine besondere Aufmerksamkeit gab und einige Male dem Unterricht beiwohnte. Einmal kam er sogar mit dem Schulrat. Das war im Rahmen einer offiziellen Inspektion. Da schloss sich dem Unterricht eine gesellschaftskritische Diskussion im Rektorzimmer an, die Eckhard Hieronymus mit Mühe überstand, weil da wie beim Prüfungsgespräch vor der fünfköpfigen Einstellungskommission vernetzt und versiegelt gefragt wurde. Die Fragen vom Schulrat und Rektor bei der anschließenden Unterrichtsdiskussion waren als Fangfragen ausgelegt, um dem Lehrer klarzumachen, dass er für das neue Fach wenig geeignet ist, weil er im alten feudalistisch-kapitalistischen Denken steckengeblieben war. Das hätte bedeutet, dass er den gestellten Erwartungen im Probejahr nicht entsprochen hätte und ihm die weitere Lehrtätigkeit an der Ernst Thälmann-Grundschule entzogen worden wäre. Das Unterrichten in den anderen Fächern gab ihm dagegen Zufriedenheit, weil er sah, wie das Interesse der Schüler geweckt und geformt wurde, die dann mündlich wie schriftlich bessere Leistungen zustande brachten.
Dagegen schwieg sich Superintendent Bosch weiter aus. Nicht ein Wort kam von ihm, obwohl Eckhard Hieronymus ihm mitgeteilt hatte, dass er mit seiner Frau eine kleine Wohnung in der Altstadt bezogen habe. Es war so, dass er sich auf so einen Amtsbruder nicht verlassen konnte, wenn es um eine erbetene Hilfe ging. Wieder dachte er an die Worte des Breslauer Pfarrers Kannengießer und die Worte des Namensvetters Reinhard Dorfbrunner und des Sowjetgenerals Tscherebilski, die sich darin einig waren, dass auf Kirchenleute kein Verlass ist, wenn man sie braucht, und es darum geht, Menschen in Not zu helfen beziehungsweise ihnen aus der Not heraus zu helfen. Dieser Superintendent, an dessen Hauseingang wiederholt kurze Türspaltgespräche mit der Frau stattgefunden haben, gehörte der großen Partei der Schweiger an, weil auch diesem Kirchenmann das Verschweigen mit dem Ausschweigen am opportunsten war im Sinne des stillen Mitläufertums. Eckhard Hieronymus erinnerte sich schmerzlich an das opportunistische Verhalten des Konsistorialrates Braunfelder in Burgstadt und des Bischofs Rothmann in Breslau, die sich auch dann ausschwiegen, als die Gestapo unschuldige Menschen, darunter Pastöre, in die Verhörskeller schleppten und dort folterten, und vor den Augen der Kirche Juden aus ihren Häusern und Geschäften prügelten, auf offene Lastwagen luden und mit anderen nichtkonformen Mitbürgern in Güterzügen hinter verriegelten Schiebetüren in die Konzentrationslager zur Zwangsarbeit und anschließenden Vernichtung deportierten.
Alle Kirchenleute sahen es, doch nur wenige sprachen das Wort der Abscheu. Dazu gehörten allerdings nicht die Kirchenmänner aus der höheren Hierarchie mit den Metallkreuzen vor ihren Brüsten. Und weil sie es damals schon nicht taten mit dem mutigen Reden zur rechten Zeit, tun sie es nun auch nicht. Sie schweigen weiter, obwohl sie schreien müssten. Was sie auch beten mögen, die hohen Kirchenleute, es bleibt die traurige Tatsache, die Ausdruck einer gefalteten Lieblosigkeit ist. Dahinter kann sich keiner verstecken! Was sonst sind die Aufgaben der ‘Vertreter’ Gottes. Ihr Auftrag war doch klar vorgegeben, der zu befolgen und nicht wegzuschieben war. Die guten Beispiele im Vorleben als Christ in der tätigen Nächstenliebe gab es wie den großen Apostel Paulus (“Ihr möget säen; ob ihr die Früchte eurer Saat ernten werdet, das, allerdings, steht in der Allmacht Gottes.” “Denn das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in der Kraft.” 1.Kor.4). Auch in jüngster Zeit gab es die mutigen Christen wie den Pfarrer Paul Schneider aus dem Hoxtbachtal im Hunsrück, “der Prediger von Buchenwald”, oder den Berliner Dompropst Bernhard Lichtenberg: der öffentlich für die KZ-Gefangenen und Juden (Auschwitz) betete, Pfarrer Kolbe (Auschwitz), Dietrich Bonhoeffer, Leiter des Predigerseminars der Bekennenden Kirche in Finkenwalde (Flossenbürg), Schwester Teresia Benedicta (Dr. Edith Stein), Philosophin und Karmelitin (Auschwitz), Schwester Magdalena Dominica (Dr. Meirowsky), Tertiarin des III. Orden vom hl. Dominikus (Auschwitz: “Ich betrachte es als eine Gnade und Auserwählung, unter diesen Umständen weg zu müssen und so einzustehen für das Wort unserer Väter und Hirten in Christus” [aus ihrem letzten Brief vom 6. August 1942 an ihren Beichtvater in Tilburg]), und manche andere tapferen Prediger und Ordensfrauen, die ihren Auftrag lebten.
“Apropos Kirchenleute”, bemerkte Heinz Töpfer, “da gibt es die Geschichte eines Spätheimkehrers und mutigen Pfarrers, die ich Jahre später als Zeitzeuge mitverfolgte”: