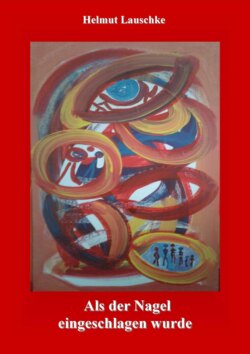Читать книгу Als der Nagel eingeschlagen wurde - Helmut Lauschke - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Von Erlebnissen und Erschütterungen
ОглавлениеEs gab den milden Frühling im Jahre 2014. Ein alter Mann lehnte sich an einem Mittwochnachmittag aus dem Parterrefenster eines dreistöckigen Hauses, das an einer ruhigen Straße nahe dem Bahnhof in einer sächsischen Stadt in der Oberlausitz lag, und beobachtete das Kommen und Gehen der Passanten. Einigen nickte er den Gruß zu. Das waren meist ältere Männer und Frauen, mit denen er vielleicht die Schulbank gedrückt hatte. Da er das auch bei mir und das wiederholt tat, wo ich doch meine besten Jahre hinter mir hatte, blieb ich stehen, schaute ihm in sein von tiefen Furchen durchzogenes Gesicht und fragte Ihn nach seinem Wohlergehen.
“Sie können es mir doch ansehen, dass mir die Gegenwart nicht glatt heruntergeht. Ich mache mir Sorgen, und das kann Sie doch nicht wundern, denn viel jünger sind Sie doch auch nicht, wie unsere Kinder durch die Zukunft kommen, kommen sollen beziehungsweise kommen können.” Ich schwieg – und das länger als gewöhnlich – und schaute dem alten Mann ins Gesicht. Dabei sah ich, dass sein rechtes Auge getrübt war und sein linkes Auge leicht nach außen schielte. Der einseitige Schielblick fesselte meine Gedanken für einen Augenblick, während ich dieser Blickschiene anhing, die doch eine ungewöhnliche war und deshalb auch eine ungewöhnliche Zukunft anvisieren konnte.
Fast hatte ich mich auf dieser Blickschiene verloren, war auf ihr weit vorausgeeilt, ohne allerdings mehr Licht in meine Vorstellungen im Tunnel der Zukunft zu bekommen, als ich dem alten Mann, der sich aus dem Fensterrahmen leicht vornüber beugte, sagte, dass ich im fernen Afrika lebe, wo es um diese Jahreszeit dem Winter entgegengeht, und ich die europäische beziehungsweise sächsische Milde des Frühlings als sehr angenehm empfinde. “So, dann kommen Sie von weit her und besuchen ihre Verwandten.” Das sagte der alte Mann nicht ohne dem Schmunzeln der Neugier, indem er die Blickschiene des linken Augen geradeaus auf mich richtete, wobei das getrübte rechte Auge blicklings nach außen wegrutschte, als visierte es den rechten Fensterrahmen an, denn auf dem Bürgersteig zu dieser Seite bewegte sich momentan nichts. Ich sagte dem Blickenden, dass ich einige Jahre meiner Kindheit in dieser Stadt zugebracht hätte. “Das muss aber schon längere Zeit her gewesen sein”, erwiderte der alte Mann folgerichtig aus der ersten Blickanalyse. Dabei wiederholte er seine Feststellung, die er aufgrund seiner Erfahrung von Gesichtern und ihren näheren Betrachtungen anstellte, dass ich doch so jung auch nicht mehr sei, als seien diese Kinderjahre erst unlängst in dieser Stadt zugebracht worden. “Sind Sie denn hier auch in die Schule gegangen?”, setzte er fragend nach, um der ersten Blickanalyse die Verlaufsanalyse Richtung Grund und Boden hinzuzufügen.
Ich erzählte Ihm die Geschichte von den Bombennächten über Köln, und dass die Bomben, die im immer dichteren Hagel vom Nachthimmel fielen, dann auch die Wohnung der Eltern zerstört hatten, während mein jüngerer Bruder und ich für einige Monate auf einem großen Gut im damaligen Ostpreußen verbrachten, um ungestört schlafen zu können. Dort erfreuten wir uns an den Weiten der satten Wiesen, tragenden Felder mit den Seen und duftenden Wäldern in einer friedvollen Stille und der guten Kost, die es in Köln schon lange nicht mehr gab. Ich erzählte von der ersten Banane beim nächtlichen Kurzaufenthalt in Danzig, deren Form, Inhalt und Geschmack uns die Mutter erklärte, während sie die Schale Stück für Stück zurückzog und den Inhalt zwischen meinem anderthalb Jahre jüngeren Bruder und mir aufteilte und stückweise zum Abbeißen in den Mund steckte. “Das ist ja noch weiter zurück, als ich gedacht habe”, sagte im linksäugigen Geradeausblick der alte Mann, “denn das war noch in einer Zeit, als das 3. Deutsche Reich existierte.” Ich ergänzte aus meiner Kinderbeobachtung, dass auf den Briefmarken mit dem Hitlerkopf im Profil außer “Protektorat Böhmen-Mähren” auch “Großdeutschland” zu lesen war. “Darf ich fragen, wo Sie in dieser Stadt gelebt haben?”
Ich nannte den Albertplatz, wo das Haus gegenüber der Maria Martha-Kirche an der Ecke zur Bahnhofstraße stand, wo es heute noch steht. Es ist das Haus mit der Nummer 14. Dort betrieb der Vater als Arzt, und er war ein motivierter und fleißiger Arzt, eine kleine Frauenklinik. Das Haus bekam im April 1945 von einem russischen Panzer einen Mauerdurchschuss verpasst, der notdürftig und ohne Außenputz geflickt wurde. Die Stelle des Durchschusses ist nach dem später erfolgten Außenputz und dem Neuanstrich über dem linken Eckfenster des Obergeschosses noch zu erkennen. Nach Kriegsende bekamen Platz und Straße den Namen August Bebel, jenem Sozialdemokraten der Weimarer Republik. “Nu! Dann errate ich ihren Namen, denn für ihren Vater habe ich einige Botengänge erledigt. Aber darüber müssen wir uns ausführlicher unterhalten, was wir nicht durch das Fenster tun sollten.” Dieser Bemerkung nickte ich zu und fragte den alten Mann, ob wir uns an einem der nächsten Tage in einem Café treffen können, denn länger als drei Tage könnte ich nicht bleiben. Der Mann stimmte zu, schlug den nächsten Tag um ½ 4 im Café vor dem Rathaus vor, zog den Kopf zurück und schloss das Fenster.
In der Nacht verfolgte mich der Kölner Kindertraum: Das Brummen der Motoren der anfliegenden Bomberverbände wurde lauter. Es wuchsen Angst und Sorge der Menschen in den Luftschutzräumen. Kinder begannen zu weinen. Die Kleinen klammerten sich um die Hälse ihrer Mütter. Die Erwachsenen bekamen fahle Gesichter, als die Motoren über der Stadt kreisten, röhrten und dröhnten. Die Bomber entluden ihre Ladungen, die herabsausten und in die nächsten Häuser der Straße einschlugen. In der Ferne ratterten die Flakgeschütze, die bei dem höllischen Dröhnen einer Übermacht von Bombern sich wie heiser bellende Hunde ausnahmen und bald aus Mangel an Munition schwiegen. Es gab laute Detonationen, die den Menschen im Keller die Luft nahmen. Die Bomberverbände kamen in drei Schüben und entluden erbarmungslos ihre tödliche Fracht über der wehrlosen Stadt.
Nach mehr als einer halben Stunde, die eine Ewigkeit des Schreckens war, zog der letzte Verband ab, und die Sirenen heulten die Entwarnung. Ich folgte meinem Vater mit dem dreiviertel gefüllten Eimer mit Sand und half ihm mit klopfendem Herzen beim Unschädlichmachen einer bis in den Keller eingeschlagenen Brandbombe. Die Sirenen hatten sich ausgeheult, und der Strom war ausgefallen, als die Eltern mit Taschenlampen uns Kindern und einigen Nachbarn aus dem Keller leuchteten. Die Luft im Treppenhaus war von Mörtelstaub des rausgebrochenen Wand- und Deckenputzes durchsetzt und beklemmte den Atem in furchterregender Weise. Größere Mörtelstücke lagen auf den Stufen. Das Treppensteigen ging schweigend mit dem Gefühl der Vorahnung des Grauens vor sich. Harte Einschläge und Detonationen durch Sprengbomben hatten Häuser in der nächsten Nachbarschaft zerstört. Fensterscheiben der Wohnung im ersten Stock waren zerborsten.
Es war ein sternenklarer Himmel mit der vollen Mondscheibe. Beim Blick aus dem Fenster war die Straße mit Steinbrocken und vielem Trümmerzeug übersät. Bomben haben tiefe Krater in die Straße gerissen und Straßenbahnschienen verbogen. Die Straßenlampen waren ohne Licht, und dunkel waren die Fenster an den Häusern. Flammen kamen aus Dächern, Fenstern und Türen und züngelten an den Wänden auf und ab. Sie verzehrten, was Häuser wohnlich machte. Obere Stockwerke stürzten auf die unteren. Etagenböden brachen, Brocken fielen in die Tiefe und füllten die Keller. Die wenigen Feuerlöschzüge richteten in dem Inferno so gut wie nichts mehr aus. Der Traum mit den Detonationen und wellenden Flammenfeldern endete auch diesmal damit, dass es der nächste Morgen war, an dem sich die Sinnlosigkeit und Grauenhaftigkeit vor den erschrockenen Augen ausbreiteten, wenn sie von der Straße aus alte Menschen betroffen und stumm an Küchentischen von zerbombten Häusern sitzen sahen, deren Außenwände weggebrochen waren.
Nach einem Frühstück ohne Appetit brachte mich ein Taxi in das nicht weit entfernte Kamenz, wo ich das bescheidene Geburtshaus von Gotthold Ephraim Lessing besuchte. Mit 16 Jahren hatte ich schon einmal eine Radtour über Kamenz, Hoyerswerda, Großdubrau und zurück gemacht. Doch nun unter der Last der gemachten Lebenserfahrungen erinnerte ich mich an den kritisch-freidenkerischen und kämpferischen Dichter, der als Bibliothekar in Wolfenbüttel mit dem hamburgischen Pastor Goetze im literarisch-theologischen Clinch lag. Es war der seinerzeitige Kabinettsbeschluss, der Lessing jedweitere Auseinandersetzung und Publikation seiner Schriften untersagte. So schrieb Lessing am 6. September 1778 an Elise Reimarus: “Ich muss versuchen, ob man mich auf meiner alten Kanzel, auf dem Theater, wenigstens noch ungestört wird predigen lassen.” Nun entstand nach der Vorlage aus Boccaccio’s “Decamerone” Lessings “Nathan der Weise”, eine Kampfansage gegen die geistige Beengtheit, das Spießbürgertum und jegliche Art der geistigen Arroganz. Nach einjähriger Arbeit ging das Werk als ein groß angelegtes, in fünf Aufzügen verfasstes fünffüßiges Jambengedicht 1779 in Druck und wurde schon 1781 ins Englische und Niederländische und 1783 ins Französische übersetzt. Lessing (1729-1781) selbst erlebte die Aufführung seines Werkes nicht mehr. Erst nach Schillers Bearbeitung kam “Nathan der Weise” am 28. November 1801 in Weimar zur Aufführung und wurde ein Erfolg. Das große dramatische Gedicht, von dem Goethe sagte: “Möge das darin ausgesprochene göttliche Duldungs- und Schonungsgefühl der Nation heilig und wert bleiben!”, wurde am 11. September 1888 zur Einweihung des Lessing-Theaters in Berlin aufgeführt.
Kurz vor ½ 4 fand ich mich vor dem Café vor dem Rathaus ein, das sich auf Stadthöhe befand unweit der Ortenburg auf einem Platz zum Petridom, dessen Kirchenschiff durch ein schmiedeeisernes Gitter getrennt ist, links für die Lutheraner und rechts für die Katholiken mit separaten Altären, Kruzifixen und Orgelstühlen. Der alte Mann von der Inneren Lauenstraße kam pünktlich. Nachdem wir uns die Hand gegeben hatten und ich meinen Namen genannt hatte, stellte sich der Ältere mit Heinz Töpfer vor. Wir betraten das Café, in dem genügend freie Tische waren. Wir setzten uns an den letzten Tisch in der Ecke, und jeder bestellte sich eine Tasse Kaffee, Herr Töpfer mit Milch und Zucker.
“Was tun Sie und was treibt Sie in die Oberlausitz?” Ich erzählte Herrn Töpfer die Geschichte, dass ich seit 1985 in Namibia lebe, wo ich in den letzten Jahren der weißen Apartheid bis in die frühen Jahre der Unabhängigkeit Namibias im Norden des Landes unweit der angolanischen Grenze als Arzt, Chirurg und Traumatologe an einem Hospital gearbeitet habe, das während des Freiheitskampfes im Kriegsgebiet lag. “Dann war das auch noch eine gefährliche Arbeit für Sie.” Ich schilderte ihm das Hospital in seinem heruntergekommenen Zustand und die Massen von Patienten und Verletzten, die täglich unter den schwierigen Bedingungen der vielen Mängel versorgt wurden. Ich erwähnte die Granateinschläge bis nahe ans Hospital mit den Detonationen, dass Böden und Wände zitterten und Instrumentiertische mit den auf und ab springenden Instrumenten von den OP-Tischen wegrollten. Eine Granate hatte den “Wasserkopf” des Wasserturms auf dem Hospitalgelände leckgeschlagen, dass das Wasser auslief und hinter dem Hospital einen knöcheltiefen See gebildet hatte, dass die drei Ärzte und die Schwestern aus den umliegenden Wohnstellen mit der klapprigen, schrottreifen Ambulanz zur Arbeit und wieder zurück gefahren wurden. Fünf Tage gab es kein Wasser, was die Versorgung der Patienten und Verletzten extrem erschwerte. “Dann war das eine aufreibende Tätigkeit, wo Sie unter den Gefahren des Krieges ihr eigenes Leben riskierten.” Dieser Feststellung stimmte ich zu und nahm einen Schluck Kaffee.
“Aber schon ihr Vater war ein fleißiger Arzt, dessen Gewissenhaftigkeit von den Menschen geschätzt wurde”, sagte Herr Töpfer, nachdem er seine Tasse zurückgesetzt hatte. “Und woher kennen Sie meinen Vater?”, das wollte ich wissen. “Ich habe ihrem Vater für die Entnazifizierung 1946 ein günstiges Schreiben gegeben, dass er ein harmloses NSDAP-Mitglied gewesen ist und keinem Menschen einen Schaden zugefügt hatte. Später, das war im Jahre 1951, so weit ich mich recht erinnere, war ich ihrem Vater mit den Formularen behilflich, die den unzeitgemäßen, weil völlig unglaublich gehaltenen Rückzug in den Westen, es war doch Köln, stimmt’s?, betraf. Da war es insbesondere die Liste seiner Bücher, die als politsch neutral und damit nicht als gegen die DDR und den Sozialismus jener Zeit gerichtet aufgefasst werden konnten. Ich weiß noch gut, welches Aufsehen dieser Rückzug mitsamt der Klinikeinrichtung in den Westen ausgelöst hatte. Das Aufsehen und die damit verbundenen Gespräche unter den Menschen der Stadt hielt über ein ganzes Jahr an.”
“Dann waren Sie ein Anhänger und eingeschriebenes Parteimitglied des Sozialismus, was mein Vater nach den schlechten Erfahrungen der Zeit davor nicht gewesen war. Er war ein Verfechter der Parteilosigkeit geworden und hat es gegenüber meiner Mutter oft bedauert, dass er ein Mitglied der nationalsozialistischen Partei geworden war, und das schon 1934. Diese Parteizugehörigkeit musste nach meinem Verständnis etwas mit dem Ersten Weltkrieg, seinem Ausgang und dem für die Deutschen so bitteren Friedensdiktat von 1919 zu tun gehabt haben, von dem der italienische Ministerpräsident Francesco Nitti 1924 sagte: “Noch nie ist ein ernster und dauerhafter Friede auf die Ausplünderung, die Quälerei und den Ruin eines Besiegten, geschweige denn auf den eines besiegten großen Volkes gegründet worden. Und dies und nichts anderes ist der Vertrag von Versailles!” Ich glaube, dass viele Menschen nach dem Ersten Weltkrieg eine ähnliche Einstellung zum Versailler Diktat und seinem Sadismus mit der Entwürdigung des bereits am Boden liegenden deutschen Volkes hatten und deshalb so gehandelt haben wie mein Vater, was Hitler und die Partei betraf. Denn viele Deutsche brauchten und schöpften durch ihn die neue Hoffnung.”
Herr Töpfer führte die Tasse zum Mund, nahm einen Schluck, setzte sie zurück und schwieg eine längere Zeit. Dann sagte er, dass er wenig aus dieser Zeit wisse, weil sein Vater als Lokomotivführer in einem Unfall früh verstorben sei, als er selbst noch keine sieben Jahre alt war. Er, Heinz Töpfer, sei auch in der Hitlerjugend gewesen, weil es ein Muss war, wenn man nicht unangenehm auffallen und die zwangsläufig aufkommenden Schikanen erleiden wollte, die schon in der Schule begannen. Sein älterer Bruder Erwin sei im Kampf um Stalingrad gefallen, und sein anderer Bruder Horst kam nach sieben Jahren Arbeitslager in Sibirien mit Erfrierungen an den Händen und Füßen zurück und verstarb mit nicht dreißig, wobei die Todesursache nie festgestellt wurde. Nach dem Krieg sei er früh Mitglied der FDJ geworden, um nach der Wende nicht unangenehm aufzufallen. “Ich wollte mir das Leben nicht unnötig schwer machen, wollte doch im Beruf als Sattler und Wagenbauer weiterkommen”. So etwa fasste Heinz Töpfer seine zeitliche und aktive Kehrtwendung, was die Einstellung zum Staat, seiner Führung und Politik betraf, zusammen.
Es wunderte, dass Herr Töpfer den Namen Isidor Witkowsky kannte, dem einstigen Oberbürgermeister Posens, der unter dem Pseudonym Maximilian Harden ein Kriegshetzer in der Bosnischen Krise gewesen war und seit 1916 Waffen gegen Deutschland an die Entente geliefert hatte. Er war vom Opportunismus durchtrieben. So schrieb er im November 1918 an den US-Prädenten Woodrow Wilson sein Pamphlet gegen Deutschland, stellte dieses Land und sein Volk als den Hauptschuldigen hin und gebrauchte Worte wie: “Niederträchtige Tücke der österreichischen und deutschen Regierung”, “vorbedachtes Verbrechen”, “niederträchtiger Rechtsbruch”, und “Deutschland gleicht der Hure Babylon”.
Dagegen war für Töpfer die folgende Bemerkung Herbert Hoovers als einem der Konferenzteilnehmer von Versailles neu: “Am Tisch der Friedenskonferenz saßen zerstörerische Kräfte. Die Gefühle des Hasses und der Rache tobten auch daheim in den Völkern wie ein Fieber. Ihre Staatsmänner wurden durch die böswilligen Kräfte gehemmt. Keiner von ihnen besaß freie Hand, einen Frieden gemäß den 25 Punkten [Wilsons] abzuschließen, auch wenn er es gewollt hätte.”
Erstaunt war Töpfer, als ich ihm zum Beleg, dass die russische Revolution ein jüdisches Werk war, Baruch Levy zitierte, der an Karl Marx schon 1879 schrieb: “Durch Aufrichtung einer Weltrepublik und durch den Sieg des Proletariats werden die Verheißungen des Talmud in Erfüllung gehen. Wenn die Zeiten des Messias gekommen sind, dann werden die Juden die Schlüssel zu den Reichtümern aller Völker in ihren Händen haben.” [in: La Revue de Paris, juin 1, 1928, p. 54]
“Aber die russische Revolution war doch erst 1917”, entgegnete Heinz Töpfer. Ich erklärte ihm, dass die erste Revolution 1905 nach dem verlorenen Krieg gegen Japan fehlgeschlagen ist. Dann zitierte ich den amerikanischen Historiker George Pitter-Wilson in Bezug auf den 1. Weltkrieg: “Deutschland schien den Krieg in den Jahren 1916/17 militärisch zu gewinnen, da es durch die Rothschilds stärker finanziert wurde als Frankreich, Italien und England zusammen. Der Grund der Bevorzugung war Rothschilds Gegnerschaft zum russischen Zaren, der auf Seite der Entente stand. Die Abkehr Rothschilds und seiner finanziellen Unterstützung trat am 12. Dezember 1916 ein, nachdem der deutsche Kaiser England den Waffenstillstand ohne Forderungen nach Reparationen angeboten hatte. England prüfte das deutsche Angebot, während Rothschild seine ganze Macht aufbot, dass England das Angebot ablehnt. Sein Agent, der Ashkenazi Jew Louis Dembitz Brandeis, der am 4. Juni 1916 Richter am US-Supreme Court geworden war, sandte eine große Zionisten-Delegation nach England, um seine Botschaft zu übermitteln, dass er, Rothschild, England im Krieg gegen Deutschland finanzieren werde, wenn er dafür Palästina von England bekommt. Die Engländer stimmten diesem Angebot zu. Die amerikanischen Medien wurden über Nacht Deutschland-feindlich, und Amerika erklärte am 7. April 1917 Deutschland den Krieg. Das tat Wilson als der 28. US-Präsident entgegen seinem Wahlversprechen von 1913: “Re-elect the man who will keep your sons out of the war”, dass er keine amerikanische Söhne in den europäschen Krieg schicken werde. Damit war die militärische Niederlage Deutschlands im 1. Weltkrieg vorprogrammiert und wurde im Versailler Friedensdiktat vom 28. Juni 1919 endgültig besiegelt. Dafür bekam Rothschild Palästina, aus dem 1948 nach Besiegung Deutschlands im 2. Weltkrieg und den ihm erneut aufgebürdeten enormen Reparationsforderungen, die der Plünderung gleichkamen, der Staat Israel hervorging und von deutscher Seite die riesigen finanziellen Zuwendungen erhielt.
Es war die militärische Situation an der russischen Front, dass der deutsche Kaiser und seine Generäle es für vorteilhaft hielten, Wladimir Iljitsch Lenin aus dem schweizerischen Exil im geschlossenen Wagen nach St. Petersburg bringen zu lassen, um das zaristische System zu stürzen, die 2. russische Revolution ins Rollen zu bringen und auf diese Weise den Waffenstillstand an dieser Front zu bewirken. Es war Rothschilds Order, dass die Bolschewiken die Macht übernahmen und den Zaren Nikolaus II samt seiner Familie umbrachten, obwohl der Zar am 2. März 1917 bereits abgedankt hatte. Es war Rothschilds Rache für Zar Alexander I, der den Plan zur Bildung einer Weltregierung 1815 beim Wiener Kongress blockierte, und für Zar Alexander II, der 1864 mit Präsident Abraham Lincoln zusammentraf.”
“Nun verstehe ich den tieferen Zusammenhang. Doch der Oktoberrevolution mit dem Bolschewismus und dem angehängten “Weltproletariat” folgten die grausamen “Säuberungen” unter Lenin und Stalin, denen Millionen unschuldiger Menschen zum Opfer fielen. Die kommunistische Diktatur brachte den kalten Frieden mit der Teilung Europas in West und Ost durch den Eisernen Vorhang mit der Mauer, dem ausgerollten Stacheldraht und Todesstreifen quer durch Berlin und Deutschland und den Kalten Krieg mit der Aufrüstung nuklearer Waffenarsenale auf beiden Seiten.” Das sagte Töpfer, und ich ergänzte seine Bemerkung zum bisher kostspieligsten Wahnsinn mit dem Leiden der Völker durch den Verlust der Freiheit und dem Nachteil auf unabsehbare Zeiten durch die brutalen Stellvertreterkriege in Angola zwischen José Eduardos dos Santos von der MPLA [Movimento Popular de Libertação de Angola] und Jonas Savimbi von der UNITA [União Nacional para Independência Total de Angola], oder im ehemaligen Zaire unter dem multibillionären Diktator Mobutu Sese-Seko mit der MPR [Mouvement Populaire de la Revolution] mit der Ermordung von Patrice Lumumba am 17. Januar 1961, des ersten Ministerpräsidenten nach der Unabhängigkeit des Kongo – und den Kriegen im Nahen, Mittleren und Fernen Osten sowie in den zentralamerikanischen Ländern und auf Kuba samt den Antillen.
Wir zahlten den Kaffee und verließen das Café. Ein Gang durch die Stadt schloss sich an, der ein nachdenklicher Erinnerungsgang war. Wir setzten uns auf eine Bank vor der Ortenburg nahe dem steilen Abhang über dem tiefliegenden Flusstal der Spree mit Blick auf den Rundturm der Alten Wasserkunst. Beim Blick über das Spreetal mit seinen Kurven sprachen wir über das, was sich nach Kriegsende verändert hatte. So ist es mit der allierten Besetzung und Teilung des deutschen Bodens mit Wegnahme eines großen Teiles des ehemaligen deutschen Reichsgebietes und dem Verlust der Ostgebiete auch zu einer Verfremdung in der deutschen Sprache gekommen. Das alte Sprachempfinden, das wir als junge Menschen hatten, war nach dem Krieg in seiner Tiefe zersplittert und in seinem Wesen verflacht und zerstückelt. Die Aufweichung im Kern und die sprachliche Verflachung gingen auch in die Musik und in die anderen Kulturbereiche hinein.