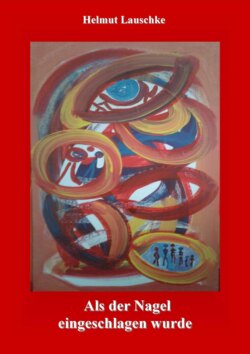Читать книгу Als der Nagel eingeschlagen wurde - Helmut Lauschke - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Von den Dorfbrunners und vom Spätheimkehrer Klaus Hansen
ОглавлениеDas Deutsche, dass in Wort und Ton einst groß, fein und tiefgründig aus dem deutschen Boden kam, hat Schaden erlitten. Das einst so tief empfundene Deutschtum war gestorben beziehungsweise nicht wiederzuerkennen. Die Voraussage, dass dieser Verlust, der doch ein schwerer ist, kommen wird, wenn Deutschland den Krieg verliert, machten Menschen mit Bildung und dem tiefen Bezug zur deutschen Geschichte und Kultur, die doch weit mehr als nur kriegsbezogen war. Damals in den letzten Wochen vor dem Ende des Krieges, als russische Panzer bereits Breslau stürmten, war es der Obersturmführer Reinhard Dorfbrunner, der von dem großen Verlust als dem deutschen Wegrutsch sprach, was ihm aufgrund der Uniform keiner zugetraut hatte. Da drückte der Cousin und ehemalige Breslauer Superintendent Eckhard Hieronymus Dorfbrunner seinen Schmerz darüber aus, dass die Einsicht, die deutsche Kultur auf ihrer Höhe zu halten, nicht schon früher gekommen sei. Er sagte es so: “Man muss der Staatsführung den Vorwurf der Bildungslosigkeit machen, dass sie die großen Kulturgüter von Anfang an in Gefahr brachte, sie in den Niederungen der Machtgreifereien schlichtweg aufs Spiel setzte. Wäre etwas Bildung dagewesen, dann hätte es Anstand und Respekt vor den Menschen und ihrer Leistung gegeben, die das Deutschtum zu jener Höhe gebracht hatten.
Heinz Töpfer führte den Faden fort: “Statt dessen wurden Völker überrannt, Kriege angezettelt und hinter den Fronten gefoltert und gemordet. Es sind Dinge abgelaufen, die der Achtung abträglich und der deutschen Kultur unwürdig waren und ihr schweren Schaden zugefügt haben. Deutsche Köpfe haben fürchterliche Dinge ausgedacht, und deutsche Hände haben fürchterliche Dinge getan, die gegen alle Regeln der Zivilisation waren. Nun komme die deutsche Einsicht zu spät, weil zu den Gräueltaten zu lange geschwiegen wurde. Dieses Versäumnis lässt sich nicht ungeschehen machen.”
“Der Krieg wurde verloren, und die deutsche Kultur brach vom einstigen Hochstand herab und in Stücke. Dann kamen die anderen und hielten uns den Spiegel unserer Taten in all den Jahren vor Augen. Da klaffte der Spalt zwischen Größe und Gemeinheit, zwischen deutscher Empfindsamkeit und barbarischer Brutalität, zwischen deutschem Soll und Haben, der sich mit einfachen Worten nicht erklären und auch nicht füllen lässt.” Töpfer sagte: “Würden die Deutschen die Sieger sein, sie würden weiter zu ihren Gräueltaten schweigen. Sie würden totschweigen, was sie getan haben, würden es aber brandmarken, wenn es die anderen getan hätten. Das ist die Gewissenlosigkeit, mit der der Moloch der Grausamkeit aus dem Spalt steigt, dem millionenfach der Opportunismus nachlief, der blind für die Gequälten und taub für die Folter- und Kinderschreie war. Wie gesagt, die Einsicht in die Dimensionen der großen deutschen Kultur wurde verbrüllt und verjagt, als die Staatsführung auf die Bildungslosigkeit setzte. Die Einsicht hinterher kam zu spät. Der Krug war zerbrochen, Breslau mit seinen fleißigen Menschen und die deutschen Ostgebiete gingen verloren. Die großen Städte waren zerbombt. Was sollte da noch zu retten sein?”
Der Verlust war unwiederbringlich und ging an die Nieren. Da wischte sich Luise Agnes Dorfbrunner, die Ehefrau des Breslauer Superintendenten, mit der Hand über die verweinten Augen, und Anna Friederike, die Tochter, schaute herab, während die Bäuerin Dorfbrunner ein ernstes Gesicht machte, Eckart, ihr Sohn, sich räusperte, und der Namensvetter mit Hemd und offenem Kragen sich die Zigarette anzündete.
Es war wenige Tage vor Kriegsende, als der Obersturmführer eine Rauchspirale in die Luft blies und dem Kirchen-Vetter erwiderte: “Nun hast du uns eine ernste Predigt gehalten, sag, was hat die Kirche denn getan, um der Bildungslosigkeit, wie du es nennst, entgegenzuwirken? Hat sie nicht kläglich versagt?” Eckhard Hieronymus machte ein nachdenkliches Gesicht: “Ja, auch die Kirche hat versagt, ich muss es bekennen. Sie hätte weniger versagt, wenn ihr die Möglichkeit geblieben wäre, die Wahrheit zu sagen, warum es mit dem Glauben und der Achtung vor Gott und den Menschen schlecht bestellt war, wenn nicht so viele Pastöre von den Kanzeln herunter und aus anderen Diensten an der Gemeinde weggeholt, von der Gestapo verhört, gefoltert und schließlich in die Arbeitslager verschleppt worden wären. Der Moloch der Gemeinheit machte kein Pardon, er griff zu und riss heraus, was ihm nicht passte. Sag du, wie sich die Kirche hätte wehren und verwahren sollen.”
Darauf sagte der Namensvetter: “Ich gebe zu, dass ihr Kirchenmänner einen schweren Stand habt in einem System, das den Führer und nicht Gott an der Spitze hat. Wie hast du doch beim Mittagessen gesagt, als du Sokrates zitiertest?…” Eckhard Hieronymus: “Niemand sei seines Lebens sicher, der der Volksmasse offen und ehrlich begegnet. Daher müsse der, wer ein Kämpfer für das Rechte sein und trotzdem eine kurze Zeit am Leben bleiben wolle, sich auf den Verkehr mit den Einzelnen beschränken.” Das hat Sokrates in seiner Apologie im Prozess gesagt, der ihm von der Demokratie in Athen wegen der angeblichen Gottlosigkeit gemacht wurde.” Der Namensvetter erwiderte: “Ich gebe weiter zu, dass sich die Kirche auch nicht bei dem Einzelnen aufhalten kann, sondern ihre Tätigkeit auf die Masse des Volkes ausrichtet. Aber sie hätte am Anfang, als das Lebensrisiko für den Kirchenmann noch nicht bestand oder nur gering war, ihren Mund klar und deutlich auftun sollen. Dann, davon bin ich überzeugt, wären viele Dinge anders gelaufen. Sieh doch, wie das Papstwort auf den Führer eingeschlagen hat, dass es mit den Euthanasien aufhörte. Was ich meine, ist, dass das klare Wort am Anfang nicht gesprochen, sondern sich in geschwollenen Phrasen ergangen wurde. Doch Phrasen, wenn sie wie Schlingpflanzen wuchern und bis zur Unkenntkichkeit verzopft werden, bringen die Wirkung des klaren Wortes nicht; sie geben höchstens Anlass zum kopfschüttelnden Gelächter. Das klare Wort hat nur der Mutige. Das hat euch Kirchenmännern von jeher gefehlt. Da dürft ihr euch jetzt über das Ende auch nicht wundern und solltet nicht das, was ihr versäumt habt, nämlich zur rechten Zeit das klare Wort zu sprechen, nun zu spät mit euren Sprüchen, mögen sie heilig oder scheinheilig sein, versehen und weiter zur Unkenntlichkeit verzopfen.”
Ich setzte die Geschichte fort: Die Reaktion war stille Betroffenheit. Auch Eckhart Hieronymus schwieg. Bäuerin Dorfbrunner goss den Kaffee nach. “Nun will ich euch etwas Lustiges erzählen”, sagte der Namensvetter, “es ist lustig, weil es paradox erscheint. Als ich in der Oberprima war, wollte ich entweder Medizin oder Theologie studieren. Jetzt mögt ihr lachen {was keiner tat}, weil das zu meiner Uniform nicht passt. Ich hatte mir vorgenommen, mein Leben für die Menschen einzusetzen, den Notleidenden zu helfen und den Beruf dafür zu wählen. Das Abitur in Grimma hatte ich als Drittbester passabel abgelegt. Ich konnte den Beruf nach meiner Neigung und Begabung wählen. Meine Eltern hatten mir die freie Wahl gelassen. Die Theologie habe ich dann nicht gewählt, weil mir die Sache mit dem lieben Gott zu riskant war, ich meine die Tatsache, dass sich die meisten Menschen für ihn nicht mehr interessierten. So begann ich das Studium der Medizin und belegte in den ersten Semestern im Rahmen des ‘Studium generale’ auch geisteswissenschaftliche Fächer wie Mathematik und Philosophie. Hier erkannte ich bald, dass mir die abstrakten Denkwissenschaften doch nicht auf den Leib geschrieben waren, wenn sie mich anfangs auch faszinierten. Mit der Medizin hielt ich bis zum Physikum durch, wo ich die Prüfung in physiologischer Chemie zu wiederholen hatte.
Das Heilfach habe ich dann gegen den Rat meines Vaters, der ein Geschäft zur Herstellung von Arm- und Beinprothesen führte, an den Nagel gehängt, als die Weimarer Republik mangels Volk untergegangen war und die Ära mit dem Heilsgruß ins zweite Jahr ging. Es waren zwei Dinge, dass ich aus freien Stücken der Waffen-SS beigetreten war; erstens: es sollte eine vorbildliche Kampftruppe von hoher Moral und Disziplin sein, das schien mir bei dem politischen Fiasko und Durcheinander nach dem verlorenen Krieg die große Herausforderung, deren Notwendigkeit zur Herstellung von Recht und Ordnung mich damals überzeugte, heute nicht mehr; zweitens: ich wollte die Sprossen der Offizierslaufbahn bis zur Leitermitte steigen, aber nicht bis oben hin, da es ganz oben zu politisch wurde und ich das absolute Gehör der Hörigkeit und die Spürnase für die analen Abgase des Höchsten nicht hatte und auch nicht haben wollte. In der Leitermitte war dagegen Platz für mich, wo ich mich für die Umsetzung der Moral und Disziplin bei der Truppe in die Praxis einsetzen konnte und auch einsetzte. Ich darf sagen, dass diese Tugenden in meiner Kampftruppe bis auf den Tag den hohen Stellenwert behalten hat. Bis auf einen hat sich keiner meiner Leute an wehrlosen Menschen vergriffen. Statt dessen haben sie alten und gebrechlichen Menschen und Müttern mit ihren Kindern geholfen. Der eine war das schwarze Schaf, er hatte sich an einem Mädchen vergriffen. Dafür bekam er eine Woche Bunker und zwei Jahre Strafbataillon bei den schweren Pionieren, zuletzt vor Stalingrad. Bei der Heilsarmee hätte ich es, wenn ich es rückblickend bedenke, wahrscheinlich weiter gebracht. Aber die war zu jener Zeit in Auflösung begriffen.”
Diese Bemerkung löste ein Schmunzeln aus. “Dann warst du, wenn ich dich richtig verstanden habe”, kommentierte Eckhard Hieronymus, “das weiße Lamm im schwarzen Wolfspelz.” “Nicht ganz”, erwiderte der Namensvetter, denn eine blütenweiße Weste habe ich nicht. Auch ich habe zu Dingen geschwiegen, zu denen ich nicht hätte schweigen sollen. Ich werfe mir vor, einen Sturmführer einer anderen Einheit nicht erschossen zu haben, der ein Massaker an wehrlosen Männern, Frauen und Kindern in einem Dorf unweit von Kiew veranstaltete. Diese Schuld muss ich neben anderen kleineren Schulden mit in mein Grab nehmen.”
Die Dämmerung setzte ein, und der Namensvetter zog sich die schwarze Uniformjacke an. Beim Gang auf den Hof fragte er, wo der Schlafplatz der drei Breslauer sei. “Zeigt mir mal euer Schlafzimmer. Ich will sehen, ob ihr da Platz genug habt.” Sie gingen an der Lmousine mit dem wartenden Fahrer vorbei. Eckart ging voraus, schob das Scheunentor weit auf und stieg die Leiter zum linken Heuschober hoch. Der Obersturmführer folgte ihm Sprosse für Sprosse. Oben betrachtete er die drei Liegeplätze und sagte schmunzelnd: “Platz habt ihr ja mehr als genug, doch wie in einem weichen Bett liegt ihr da nicht.” “Aber dafür haben wir ein Dach über dem Kopf, und das ist uns die Hauptsache”, sagte Luise Agnes. “Und wo ist die Toilette und das Bad?”, fragte der Namensvetter. Nach einem flüchtigen Blick zum rechten Schober, wo außer Heu nichts weiter zu sehen war, stieg er die Leiter herunter, gefolgt von Eckart. Sie zeigten die Waschküche, wo der Badebottich stand, in den der Brausekopf, den Eckart ergattert hatte, hineinhing und über einen Schlauch mit dem Kran verbunden war. “Aber warmes Wasser habt ihr hier nicht”, bemerkte der Namensvetter zutreffend. “An das kalte Wasser werden wir uns noch gewöhnen”, meinte Anna Friederike. Schließlich zeigten sie ihm noch das Plumpsklo. “Friert ihr da nicht fest?”, fragte er lachend und sagte: “Da nehme ich doch den Hut vor euch ab…” Eckhard Hieronymus fasste es ironisch: “Du brauchst den Hut, den du nicht auf hast, auch nicht abnehmen..” Der Namensvetter lachte und sagte, dass er soviel Willenskraft einem Kirchenmann und seiner Familie nicht zugetraut hatte. “Meldet euch, wenn ihr etwas braucht. Ihr wisst, dass ein Dorfbrunner hilft, wenn ein anderer Dorfbrunner die Hilfe braucht. Macht’s gut!” So jovial, wie er bei der Ankunft die Hand gegeben hatte, gab er sie zum Abschied. Er setzte sich ins Auto, winkte den Herumstehenden mit lockerer Hand, kniepte Anna Friederike mit dem rechten Auge zu und ließ sich zur Standortkommandantur Ost zurückfahren.
Eckart schob die Torflügel der Ausfahrt zu und legte die Eisenstange quer ein. Dann eilte er mit den anderen zum Holzhäuschen, um Klaus und Heinz aus dem Verschlag zu befreien. Nachdem er die Nägel aus den Brettern gezogen hatte, die quer über der Tür angenagelt waren, drückten Klaus und Heinz die Tür von innen auf. Sie waren erleichtert, den Blitzbesuch unbemerkt überstanden zu haben und die anderen in gelockerter Stimmung anzutreffen. Sie gingen in die warme Küche, aus der ein köstlicher Duft entgegenkam. Bäuerin Dorfbrunner setzte den Wasserkessel über das Herdfeuer und brühte zur Freude aller noch einmal richtigen Bohnenkaffee auf. “Man muss die Beziehungen haben, dann gibt es richtigen Kaffee, den es auf Marken nicht gibt”, sagte sie und bereitete das Abendbrot vor.
“Das bleibt eine fesselnde Geschichte fürs Leben. Und wieviele hätten solche und ähnliche Geschichten zu erzählen”, sagte Heinz Töpfer mit nachdenklichem Gesicht.
“Am nächsten Morgen”, setzte ich die Geschichte fort, “brachte Eckart Dorfbrunner Anna Friederike in die Stadt, wo er sie mit ihrer Tasche vor der kleinen Frauenklinik am Albertplatz 14 absetzte. Luise Agnes und Eckhard Hieronymus waren mitgekommen. Sie verabschiedeten sich am Tor der Klinik und wünschten der Tochter einen guten Beginn. Sie winkte den Eltern auf dem fahrenden Wagen hinterher. Dann ging sie durch die schmale Einfahrt, nahm die Stufen zum Eingang und verschwand im Haus. Luise Agnes soll ihre Zufriedenheit darüber ausgedrückt haben, dass wenigstens einer aus der Familie Arbeit gefunden hat.”
Am 13. und 14. Februar 1945 stand Dresden in Flammen. Rot glühte das Inferno am Himmel in die Oberlausitz hinein. Dunkle Rauchwolken mit dem süßlichen Fleischgeruch drückte der Westwind über fünfzig Kilometer weit nach Osten. Es waren die todbringenden Tausendgeschwader, die sich in zwei Wellen über dem wehrlosen ‘Florenz an der Elbe’ entluden. Erst wurde gesprengt, dann wurde mit Phosphorbomben verbrannt. Zerhackt und verglüht lag die mit schlesischen Flüchtlingen vollgestopfte Stadt am zweiten Tag in Schutt und Asche, als der Krieg schon entschieden war. Mehrere Tage züngelten Flammen aus Dächern, Türen und Fenstern. Dachstühle und Ruinen rauchten sich zu Ende, bis sie endgültig verbrannten und die oberen Stockwerke in die unteren einbrachen und mit den geborstenen Wänden nach innen oder aussen stürzten. Hunderttausende von Leichen wurden zusammengekarrt und zu riesigen Leichenbergen aufgeworfen. Sie wurden auf trümmer- und scherbenüberschütteten Plätzen und Straßen verbrannt, um der Verseuchung des Trinkwassers vorzubeugen. Es war wohl das größte Freiluftkrematorium in der Geschichte der Menschheit, das in einer europäischen Stadt über Wochen in Betrieb gehalten wurde. Es brannte und rauchte in allen Bezirken. Es qualmte an allen Ecken und Enden. Es stank entsetzlich, und die Menschen hatten sich feuchte Tücher und Schals über Mund und Nase gebunden. Der Leichengeruch war penetrant, er drang durch Löcher und Ritzen und noch mehr durch zersplitterte Fenster und Türen; er kam von oben und kam von unten, drang in die Küchen und in Bettbezüge und an die Esstische der noch bewohnbaren Etagen. Dieser Geruch ging durch die Kleidung und klebte hartnäckig an der Haut der Überlebenden.
Nachdem die Leichenberge niedergebrannt waren, wurde die Asche auf Lastwagen aus der Stadt gefahren und abgekippt. Das flammende Höllenmeer, in dem Dresden verbrannte und erstickte, kam dem Kriegsende um nur wenige Wochen zuvor. Ob es nötig war?, fragten sich die Menschen. In der Antwort waren sie sich einig: Nein!, es war nicht nötig; es war barbarischer Mord. Unter den Toten waren Mutter Dorfbrunner, ihr Sohn Friedrich Joachim, der Bruder von Eckhard Hieronymus, und Onkel Alfred, der Bruder der Mutter. Auch ihre Leichen wurden verbrannt und ihre Asche auf Lastwagen geschaufelt. Eckhard Hieronymus, Luise Agnes und Anna Friederike weinten, weil sie an ein Wiedersehen geglaubt hatten. Nun waren sie bestürzt, dass das Höllenfeuer die geliebte Mutter und Oma wie die vielen anderen Menschen auf so grausame Weise getötet hat. Der sehnlichste Wunsch nach einem Wiedersehen verglimmte wie ein Fetzen Papier. Untröstlich blieb ihr Tod ohne Begräbnis.
“Haben Sie das auch gesehen?”, fragte Heinz Töpfer, und erzählte die Geschichte eines kalten Morgens im April. “Über Nacht hatte es geschneit. Ein Zug abgemagerter Häftlinge in blauweiß gestreiften Jacken und Hosen mit zerrissenem Schuhwerk, in denen die Füße ohne Socken oder mit Fußlappen umwickelt waren, zog durch die Bahnhofstraße. Einige hinkten, und ihre Füße schlürften. Ihre Köpfe waren geschoren, und ihre Augen waren eingefallen. Ihre Blicke waren starr und hoffnungslos. Der Zug, der von SS-Männern mit umgehängten Karabinern begleitet wurde, führte einen großen Leiterwagen mit, der von Häftlingen gezogen und geschoben wurde, auf dem jene gefahren wurden, die nicht mehr laufen konnten und da oben zusammengefallen und leblos saßen. Der Zug ging zur Stadtmitte und vom Kornmarkt weiter Richtung Spreebrücke und Stadtausgang. Das Schicksal war diesen Menschen gewiss, die mit einem menschlichen Erbarmen nicht rechneten. Das war wenige Wochen vor dem Ende des Krieges. Die Menschen, die es sahen, traf das Entsetzen. Sie fragten sich, wie so etwas möglich war und möglich sein konnte, und fürchteten die Revanche der Russen, die nicht mehr weit weg waren.”
Beiden war es bekannt, und Heinz Töpfer war einer von ihnen: Männer zwischen 18 und 50 wurden zum Volkssturm eingezogen. Sie sollten den Bolschewismus mit der Panzerfaust oder der eigenen, mit Flinte oder Spaten oder Stöcken zum Stehen bringen. Beim Kampf in letzter Minute, der nicht sinnloser sein konnte, aber von der Partei und dem Stadtkommandanten befohlen wurde, verloren viele ihr Leben, unter ihnen auch jene, die den Fronteinsatz mit der Verwundung überlebt hatten. Sie waren schlecht bewaffnet und die meisten von ihnen im Schießen ungeübt. Es war unmöglich die anrollenden Panzer aufzuhalten. Die Männer der letzten Verteidigung, viele in ziviler Kleidung, wurden von den Russen wie umherspringende Hasen “abgeknallt”. Das Ende des Krieges, auf die Minute genau, das erlebten die Menschen mit Angst und Schrecken und der größten Trauer. Viele waren auf der Flucht und erreichten das Ziel, zu den Amerikanern zu kommen, nicht. Frauen fürchteten sich, vergewaltigt zu werden. Sie versteckten sich auf Dachböden, in Kellern und in Schränken.
Mit der russischen Besetzung begann die Jagd auf die Nazis, die über Nacht so gut wie verschwunden waren. Das Verschwinden, als hätte es keinen Nazi gegeben, wollten die russischen Besatzer nicht glauben. “Du Nazi!”, riefen oder schrien sie den Männern auf die Köpfe zu und setzten ihnen die Pistole auf die Brust, wenn ihnen ein deutscher Mann über den Weg lief, oder sie bei der Hausdurchsuchung zwecks Plünderung auf einen trafen. Viele wurden im Brüllkommando “Mitkomm!” aus ihren Häusern gezerrt und von Plätzen und Straßen zur Kommandantur verschleppt und dort unter Androhung von Schlägen und “Sibír!” verhört. Berlin war besetzt, und der Krieg war aus. Die Uhren mochten noch großdeutsch ticken, als die Besatzer schon vor der bedingungslosen Kapitulation auf der Jagd nach den Nazis waren, die nicht alle verschwunden sein konnten, und ihr grausames Exempel statuierten.
Unweit der Stadt, es war im April 1945 im Dorf Niederkaina, trieben russische und polnische Soldaten deutsche Männer im Alter von 18 bis 50 Jahren in eine Scheune und brannten die Scheune nieder. Nun bekamen die Menschen noch mehr Angst, was die Besatzer bezweckten und ihr System der Bespitzelung und Denunziation aufbauten, um erfolgreicher die versteckten Nazis aufzuspüren. Es sei angemerkt, dass sich auch von den Deutschen viele wunderten, wie schnell die ‘Nazidecke’, die bis vor kurzem und über so viele Jahre dick auf den Gesichtern lag, sich verdünnt hatte, ja verflogen war, dass man es selbst von den ‘Eingefleischten’ nicht glauben konnte. Russisch war die Amtssprache der Verhöre und Genehmigungen; russisch war auch die Sprache, in der geplündert und vergewaltigt wurde. Das Deutsch kam nur gebrochen weg. Dolmetscher wurden den Verhören und Verhandlungen beigesetzt, die von russischer Seite oft jüdische Offiziere waren, die vor oder mit Machtantritt des NS-Ungeheuers, als politische Quer- und Andersdenker (Kommunisten, Sozialisten und Sozialdemokraten) emigrierten oder von den Eltern oder noch davor außer Jiddisch etwas Deutsch gelernt hatten. Die Kommandantur zog auch von deutscher Seite Dolmetscher heran; das waren oft Männer, die ihr Russisch an der Front oder als Antifaschisten bei der Ausbildung in Moskau oder an einer sowjetischen Universität erlernt hatten.
Das Haus am Albertplatz hatte einen Granateinschuss abbekommen. Anna Friederike und ihre Freundin Angelika erlebten mit Todesangst den wuchtigen Einschlag und danach den Zeitpunkt ‘0’ in ihrem Dachzimmer, in das sie sich eingeschlossen hatten. Sie hatten es vorher nicht geschafft, auf den Hof nach Pommern zu kommen, weil in östlicher Richtung zu dieser Endzeit nichts mehr ging. Beide wurden in der ersten Besatzungswoche von je zwei Sowjetsoldaten auf dem Dachboden vergewaltigt. Bei Anna Friederike richteten die beiden brutalen Stoßer, die wie Hunnen auf ihr ritten, ein vaginales Blutbad an, weil sie menstruierte. Blutverschmiert steckten sie ihr Gehänge in die Hosen zurück und ließen Anna Friederike in der Blutlache liegen. Die Klinik war außer Betrieb.
Der Arzt war zum Volkssturm eingezogen worden und nicht zurückgekehrt. Ob er noch lebte, niemand wusste es. Mit einem Bus, den ein einflussreicher NS-Mann zur Flucht seiner Frau beschafft hatte, wurde sie als Patientin getarnt mit den richtigen Klinikpatienten, unter denen auch eine Schwangere war, die vor der Entbindung stand, und einer Hebammenschwester Richtung Westen gefahren, um zu den Amerikanern zu kommen. Die Arztfrau fuhr mit ihren drei Söhnen und Gepäck im kleinen DKW dem Bus hinterher. Die Fahrt sollte über Pirna dann durch Böhmisch-Mähren nach Thüringen gehen. Es kam die Nachricht, dass der Bus bei einem Tieffliegerangriff in Pirna getroffen wurde, die Insassen aber in einem Behelfsbunker überlebt hätten. Die Frau des Arztes hatte im nahe gelegenen Bergishübel ein Notentbindungsheim eröffnet, nachdem sie mit ihren Söhnen die Fahrt fortgesetzt, aber hinter Aussig vor den aus Thüringen anrückenden russischen Panzern abgebrochen habe und nach einer Odyssee, zunächst auf offenen Güterwagen, mit dem Zug nach Pirna zurückgekehrt war. Hier, auf den Höhen des waldreichen und idyllischen Elbsandsteingebirges, hatte die Schwangere einen Sohn gesund zur Welt gebracht.