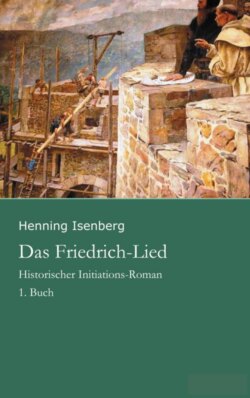Читать книгу Das Friedrich-Lied - 1. Buch - Henning Isenberg - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Kapitel
ОглавлениеEine Hand legte sich zwischen seine bebenden Schulterblätter. Friedrich hielt inne. Schnell wischte er sich mit der Hand die Tränen aus den Augen. Ruckartig erhob und straffte er sich. Dann drehte er sich der Nonne zu. Er blickte in Guldas helle Augen.
„Mein Vogt, trauert Ihr um Euch selbst oder um Euren Vater?“
Friedrich blickt verstört drein. „Beides.“
„
Was ist es am meisten?“
„
Ich bin ganz allein und alle interessieren sich für sich selbst.“
„
Hm, verstehe. Aber Ihr seid nicht allein. Euer geistiger Vater ist stets bei Euch und er spricht durch mich zu Euch. Ihr seid nicht allein.“
Ein Mensch, der mit ihm redete, nicht über ein Ding, sondern über ihn und seine Belange. Friedrichs Gedanken beruhigten sich.
„
Wo empfindet Ihr Schmerz?“, fragte die Äbtissin, deren Alter er unter der Haube, die nur den Ausschnitt ihres Gesichtes freigab, nicht auszumachen vermochte.
„
Hier, im Hals… und hier.“ Dabei fasste er sich dahin, wo sein Herz schlug.
„
Es schnürt Euch den Hals zu. Atmet. Atmet, Friedrich von Altena zu Isenberghe. Atmet.“
„
Ihr wollt der Welt etwas sagen, aber bisher durftet Ihr das nicht. Das schnürt Euch den Hals zu.“
Friedrich schluckte.
„
Und Euer Herz will ich weiten. Das enge Herz, zeigt einen Konflikt mit Eurem Vater. Es fordert Erklärung und will, dass Ihr Euch am Ende versöhnt. Ein unversöhntes Herz hört auf zu schlagen und der Mensch stirbt vor seiner Zeit.“
Sie fasste ihn bei der Schulter.
„
Kommt, wir gehen ein paar Schritte.“
Am Nachmittag trat die Trauergesellschaft den Ritt zurück zur Isenburg an. Wegen der schweren Wagen, in denen die Damen reisten, ging es nur schleppend voran, und man vermochte nicht auszumachen, ob die Mienen der Reisenden aufgrund der Trauer oder des Reisetempos derart finster waren. Doch Friedrich war voller Pläne.
‚
Viel Glück in Italien’, hatte der Junge namens Otto gesagt. Das beflügelte ihn. Er malte sich seine Ausrüstung aus. Er sah sich in heldenhaften Kämpfen und auf glanzvollen Festen. Wie mochte das Land jenseits der Alpen wohl aussehen? Ein grenzenloses Leben. Die Vorstellung war einfach unfasslich.
Am Abend erreichten sie die Isenburg. Viele Angehörige der Familie aus den nördlicheren Regionen, die über den Hellweg zurückreisten, unter ihnen Dietrich von Cleve und sein Gefolge, waren mitgekommen. Und so war die Isenburg für ein paar weitere Tage Heimstätte für eine große Zahl von Menschen. Das Gesinde hatte zu ihrer Ankunft bereits alle Unterkünfte und für den Abend ein großartiges Mahl im großen Saal des Palas hergerichtet.
Friedrichs Mutter, Mathilde, hatte an diesem Abend den Vorsitz der Gesellschaft. Sie saß zwischen Friedrich und ihrem Bruder, Dietrich, neben diesem saß Adolf von Altena.
„
Meine liebste Schwester”, begann Dietrich, „als Friedrichs Oheim, möchte ich dir einen Vorschlag machen.“
Er schwieg einen Moment und musterte Mathilde.
„
Als Everhard vor zwei Jahren starb”, fuhr er fort, „habe ich Friedrich als Armiger in meine Dienste genommen, damit er zu einem vollständigen Regenten der Grafschaft heranwächst.”
„
Das ist sehr großzügig von dir gewesen, Dietrich. Und nun?!”, entgegnete Mathilde mit sichtbarer Zurückhaltung aber ruhigem Ton.
„
Durch sein Leben hinter Klostermauern, ist er mit vielen Wissenschaften vertraut. Und das ist gut so. Im sicheren Hafen seiner Knappschaft in meinen Diensten, wurde er für den ritterlichen Stand herangezogen. Was ihm nun noch fehlt, ist der Beweis in der Welt dort draußen.“ Dabei zeigte Dietrich durch eines der Fenster ins Freie.
„
Du meinst wohl, dass er mit deinen Raufbolden in irgendeinem Kleinkrieg Bauern abstechen soll, um Blut zu lecken!”
„
Mathilde“, mahnte Dietrich seine Schwester freundlich. Er kannte die Vorbehalte seiner Schwester gegen jegliche Form von Grobheit.
„
Raufbolde,“ sagte er vermittelnd, „das sind wir mit Sicherheit nicht. Wir sind Ritter Gottes. Wir stehen unter seinem Schutz und wir stechen keine Bauern ab. Nein, ich meine der Junge ist so weit, dass er sich die Ritterschaft verdienen kann.“
Mathilde schaute auf in den rauchgeschwängerten Saal. Die Gesellschaft war in Fahrt gekommen und feierte. Mathilde zog die Augenbrauen hoch und ihr gehobenes Kinn formte eine trotzige Geste, die Dietrich nur zu gut kannte. Adolf suchte verlegen die gedeckte Tafel vor seinen Augen nach Worten ab.
„
Dietrich hat recht, Mathilde“, sagte er dann, „Friedrich und somit unser Besitz ist leichte Beute, für jeden Schurken, wenn er nicht auch mit diesen Wassern gewaschen wird. Wie soll er die Grafschaft verteidigen, wenn er nicht einmal weiß, was es heißt, übers Ohr gehauen zu werden?!”
„
Ich habe heute meinen Mann und vor zwei Jahren seinen Stiefsohn zu Grabe getragen, und ihr sprecht davon, nun auch Friedrichs Leben in Gefahr zu bringen. Die Welt braucht mehr der Gottergebenen, nicht der Krieger!”
„
Mathilde, die Welt ist so, wie sie ist. Sie ist grausam, sie ist gewalttätig. Wenn die Grafschaft nach Arnolds Tod überleben soll, dann braucht sie einen Führer; um das Seelenheil müssen sich andere kümmern. Nur, hier und heute kann Friedrich die Grafschaft nicht übernehmen. Arnolds Tod kam zu früh, Mathilde.”
Mathilde blickte betreten drein.
„
Was habt Ihr vor mit dem Jungen, Dietrich?”, fragte Adolf.
„
Ich werde ihn mit auf den Italienzug nehmen und dem König zur Krönung nach Rom folgen.“
Friedrich spürte, wie die Hitze der Erregung in seinen Kopf stieg.
„
Ich habe dem König meine Aufwartung gemacht und ihm im nächsten Frühjahr in Italien meine Dienste angeboten und...”
„
Du wirst den Jungen mitnehmen? Kommt gar nicht in Frage!”, entrüstete sich Mathilde.
„
Mutter”, meldete sich nun Friedrich zu Wort, der vor Aufregung, auf große Fahrt gehen zu können, förmlich erglüht war.
„
Wie soll ich unsere Rechte durchsetzen, wenn ich uns gegen Bedrohungen von außen nicht verteidigen kann?!“, plapperte er Dietrich und Adolf nach.
„
Man kann nicht alles durch Verhandlungen erreichen. Wenn man nicht drohen kann, dann kann man nichts halten. Das habe selbst ich hinter den Klostermauern erkannt.”
„
Das machen andere. Die Truppen deines Vaters sind gut und unser Heermeister ist ein guter Mann”, wollte Mathilde ihren Sohn ruhigstellen.
Dietrich spürte die Ängste seiner Schwester.
„
Mathilde, so ein Mann ist doch nur ein Werkzeug. Er braucht einen Kopf, der ihm sagt, was er tun soll. Ich spreche auch nicht nur über Hauen, Stechen und Lanzebrechen. Das Geld nimmt eine immer wichtigere Rolle ein, Verhandlungsgeschick und Erfahrung in allen Dingen sind eine weitere Sache. Das kann er unmöglich alles hier bei dir lernen.”
„
Mutter!”, rief Friedrich.
„
Sei still…!”, fauchte Mathilde ihn augenblicklich an.
Ein Moment betretenen Schweigens setzte ein.
„…
Mathilde, überlege es Dir gut. Du kannst mir einen Boten bis Mariä Lichtmess schicken. Danach ist es allerdings zu spät. Und jetzt lasst uns von etwas anderem reden. Morgen steht noch ein anstrengender Tag an.”
Dietrich litt unter der Anspannung, die er von seiner Schwester kannte, wenn sie etwas nicht wollte. Und diese Anspannung begann sich über ihre Tafel hinaus über den ganzen Saal zu legen. Er sah in die betreten Mienen der Tischgesellschaft. Er hob den Arm und rief den Spielleuten zu, „Spielt auf!“
So kam das Gespräch den ganzen Abend nicht mehr auf die ungeklärte Lage der Grafschaft.
Am nächsten Morgen wurde das Erbe Arnolds von Altena an seine Familie übergeben. Adolf von Altena war zwar nicht mehr Erzbischof, aber vollzog er den Akt auch in Abwesenheit seiner Amtswürden. Und, es hätte keinen Besseren für diese Aufgabe geben können. In juristischen Dingen war er beschlagen, wie kein anderer, und bis zum Antritt des Erbes durch Friedrich war er das Oberhaupt der Grafschaft gewesen.
Zu Gunsten der Heiligen Kirche wurden umfangreiche Schenkungen verfügt. Dies aus zwei Gründen. Zum einen um gegen seinen Buhlen, Bruno von Sayn, im Streit um das Erzbistum zu siegen. Zum anderen versprachen die Spenden den vier jüngeren Brüdern Friedrichs – in guter Vorsorge für seine Sippe – den Ausblick auf hohe Kirchenämter.
Nur der Jüngste, Adolf, blieb dem weltlichen Leben erhalten. Er war dem Fräulein von Holte versprochen. Einem Kind mit reichem Besitz, welches ihm den Titel des Herrn von Holte verschaffen sollte. Außerdem erhielt Adolf Pferde und Waffen sowie eine Leibrente zur Sicherung seines persönlichen Auskommens.
Friedrich jedoch folgte Graf Arnold als erster Graf von Altena zu Isenberghe nach. Ihm oblag es nun, den Platz neben seiner Mutter einzunehmen, den sein Vater hinterlassen hatte, ihm oblag es nun, die Herrin und das Land zu schützen. Nun war Friedrich Herr der Grafschaft.
Umso mehr ärgerte es ihn, dass seine Mutter und Oheim Adolf ihn später am Tag von der Unterredung über seine Zukunft im Audienzsaal des Grafen ausschlossen.
Doch Friedrich kannte den hohen Raum, dessen Dach von einem Gewirr aus Balken und Streben gehalten wurde. Vom Turm des Palas aus konnte man über ein kleines Fenster im Giebel in das Innere der Halle gelangen. Es war nicht ungefährlich und Friedrich schaffte es, sich in dem Gebälk einzurichten, als sich die Tür zu dem Arbeits- und Empfangssaal öffnete und seine Mutter gefolgt von Adolf eintrat.
„
Mathilde“, sprach Adolf seine Schwägerin an, „habt Ihr Euch schon Gedanken gemacht, wie Ihr jetzt die Grafschaft führen wollt?”
„
Ja, habe ich!” antwortete sie knapp.
„
Ich würde wünschen, ehrwürdiger Vater, Ihr würdet die finanziellen Dinge regeln, bis Friedrich sie übernehmen kann.”
„
Mathilde, ich bin dabei meinen Sitz zurückzugewinnen, da bleibt keine Zeit, mich auch noch um diese Angelegenheit zu kümmern.“
„
Ihr habt den Tod meines Mannes verschuldet, indem Ihr ihn überredet habt, mit Euch ins Midi zu ziehen.“
„
Ach, so ist das. Endlich kommt Eure wahre Meinung zur Sprache. Ich kann Euch nur sagen, dass Arnold freiwillig mit auf den Kreuzzug gegangen ist, wie auf die übrigen zuvor auch.“
„
Er ist Euer Bruder gewesen. Er konnte Euch nicht im Stich lassen; das wusstet Ihr. Ein einziges Wort von Euch hat gereicht. Gebt das doch wenigsten vor Euch selbst und im Angesicht des Herrn zu.“
„
Ich trauere genau wie Ihr um Euren Mann, um meinen Bruder. Ich bin nicht Schuld an seinem Tod. Und unter Druck setzen lasse ich mich schon gar nicht.… Außerdem habe ich die letzten Jahre damit verbracht, den Schuldenberg des Erzstiftes zu verringern, ich bin des Geldes fast müde. Ich kann es nicht machen. Ihr müsst eine andere Lösung dafür finden – selbst in der Zwischenzeit. Sollte Friedrich mit Dietrich gehen, so könnt Ihr vielleicht für den Übergang einen Amtmann damit betrauen.”
„
Es ist heillos. Soll ich in der Mark um Hilfe suchen?!”
„
Traut Ihr meines Bruders Sohn? Ich stehe in Eurem Lager, weil ich von meinem Neffen Ado nichts Gutes erwarte.”
Er endete mit einer abschätzigen Geste und schwieg für einen Moment, bevor er fortfuhr.
„
Friedrich und Ihr braucht einen Plan, der lange währt. Es muss aus ihm kommen. Doch er ist noch nicht bereit, diesen Plan auszudenken, versteht Ihr?!“
Mathilde schwieg und schaute auf die in frohen Farben dargestellten Jagdszenen auf dem großen Wandteppich an der bruchsteinernen Stirnwand des Saales.
Friedrich duckte sich hinter einen Balken.
Adolf fuhr fort, „wartet nur. Wenn er aus Italien zurückkommt, wird er gereift sein. Vertraut auf Euren Bruder. Er ist der beste Führer und Lehrmeister.“
Obwohl er sich, ob der Anschuldigungen Mathildes, selbst hatte zur Räson rufen müssen, sprach Adolf noch eine Weile besänftigend auf seine Schwägerin ein. Mathildes Vorstellungskraft reichte nicht aus. Zu sehr war sie von der Furcht und der Last des Alleinseins gefangen. Ohne eine Lösung für das Problem gefunden zu haben, ging schließlich jeder seiner Wege.
Mit dem Eindruck, dass Mathilde noch Zeit brauchte, ihre Zurückhaltung und ihren Selbstschutz gegen andere Gedanken einzutauschen, ging Adolf über den Wehrgang der Oberburg. Nun, er hatte noch einen ganzen Sommer und einen ganzen Winter Zeit.
Friedrich aber, der das Gespräch im Gebälk des Saales angehört hatte, ohne dass jemand seine Anwesenheit bemerkt hätte, machte sich froh wieder auf den Weg in seine Kammer im jenseitigen Teil, des Palasturmes. Er hatte Adolf offensichtlich verkannt, denn in ihm hatte er einen Fürsprecher gefunden.
Am Tag seiner Abreise ging Dietrich zu Adolf von Altena und bat ihn weiterhin auf Mathilde einzudringen.
Als Friedrich Isenburgh verließ, spürte er Unbehagen. Er schaute sich um. Seine Blicke suchten die Mauern und Zinnen ab. Doch sah er die strenge Mutter nicht. Zu dieser Blöße hätte sie sich nicht in diesem und auch nicht im nächsten Leben hinreißen lassen. Schon der Abschied war kühl gewesen und hatte Friedrich mit dem Gefühl tiefer Schuld zurückgelassen. Hätte sie ihnen doch nur von dem Wehr nachgeschaut – es hätte ihm schon gereicht. Wie ein geprügelter Hund folgte er seinem Oheim nach Cleve. Es mangelte ihm am Segen der Mutter. Er litt. Er fühlte sich kraftlos. Würde er jemals Sophie zur Frau nehmen, so war sie sicherlich die Frau, die ihn in schweren Momenten stützen würde. Inständig hoffte Friedrich auf die Fürsorge der einfühlsamen und schönen Mathild, der Frau seines Oheims Dietrich, die er aus der Ferne anbetete, solange Sophie noch nicht in seinem Leben war.
Cleve
Am späten Nachmittag hatten sie die Schwanenburg fast erreicht. Friedrich hegte, obwohl sein Oheim selbst noch in einem Alter von noch nicht dreißig Jahren stand, große Bewunderung für Dietrichs Ritterlichkeit und Mannhaftigkeit. Dietrich war ein Ritter des Reiches, der in der Blüte seiner Ausstrahlung und Kraft stand. Weise im Geiste und edel in seinen Gebärden, war all sein Verhalten ritterlich und erlesen.
Doch er, Friedrich, war zu schüchtern, ihm seine Liebe zu zeigen, noch ihm sein Ziel, einmal nach Jerusalem ziehen zu wollen, zu nennen. Er traute sich so wenig, ängstlich durch die schlimmen Ächtungen der strengen, durch das Elternhaus und die Kirchenjahre geprägten Vorstellungswelt. So liebte er seinen Oheim im Stillen und schwor ihm Treue.
Einzig teilte er in diesen Tagen seinen Wunsch, auf den Kreuzzug zu gehen, mit zwei Menschen.
Die Zeit seiner Knappschaft unter dem Clever Lilienhaspel teilte Friedrich mit Conrad von Wied und Gerhard von Büderich. Sie waren, wie er, von befreundeten Adligen der Obhut Cleves überantwortet worden. Die Burschen verbrachten die meiste Zeit gemeinsam und trotz ihres gemeinsamen Standes, hatten die Kirchenjahre die Unfähigkeit, die innere Distanz zu den Freunden zu überwinden, in Friedrich hervorgebracht.
Zudem suchten sie ihrerseits das Weite, wenn Friedrich einen seiner plötzlichen Wutanfälle bekam.
Ohnehin war Friedrich seinem Wesen nach eher ein Einzelgänger und so blieb er es auch in der Freundschaft zu Conrad und Gerhard. Er war der Freund, der sich, wenn ihm danach war, zu dem Freundespaar gesellte. Doch auch selbst sah er in jedem von ihnen einen Teil von sich. Dies machte seine Liebe zu den beiden aus. Und mit allen Seelenkräften seiner Jugend strebte er beiden Polen nach.
Ähnliche Zerrissenheit herrschte aber über Gerhards Wesen. Von seinem Inneren hin und her gestoßen, strebte er danach der beste Knappe zu sein, um der beste Ritter zu werden. Gleichzeitig richtete er sich dafür, sich nicht der Andacht und den Schriften zu widmen, um seiner Feinfühligkeit Rechnung zu tragen. Er selbst wusste nicht, wie es um ihn bestellt war und er verstand auch seine Trauer nicht, da es ihm, sein Ziel zu erreichen, so schwer fiel. Sein Leid konnte er nicht verbergen und ein ums andere Mal verwickelte er sich in hitzige Streitereien, eifrige Wortgefechte und Faustkämpfe mit anderen Knappen. Doch zufriedener ging er nicht aus ihnen hervor. Welche Macht nur leitete diesen Geistmensch mit seinen feinen Gedanken, ein Krieger werden zu wollen?
Conrad, im Gegensatz dazu, war ein Krieger. Er wäre jeder Auseinandersetzung gewachsen gewesen. Doch suchte er nicht danach, einen Kampf mit Waffen auszutragen und sich im hitzigen Klein-Klein zu verlieren. Von den Dreien hatte er wohl die meiste Ähnlichkeit mit Dietrichs Standhaftigkeit. Eigen jedoch war ihm seine Sturheit, die seine Wendigkeit, Entscheidungen zu treffen, bei weitem überstieg. Aber auf Conrad war Verlass.
Doch, wenn Conrad ein Krieger und Gerhard ein Gelehrter war, was oder wer war er, Friedrich, selbst?
So grübelnd ritt er ein oder zwei Pferdelängen versetzt hinter seinem Oheim und bemerkte, dass sich sein gedankenverlorener Blick auf dessen bärtiger Wange festgeheftet hatte. So wie er Dietrich, seinen Oheim liebte, liebte er Conrad und Gerhard.
Ein fernes Geschrei ließ ihn aus seinem Sinnen aufhorchen. Friedrich schaute in die Ferne. Da, da war sie die Schwanenburg. Auf dem fernen Wehr der Clever Burg standen die Freunde und ruderten laut rufend mit den Armen, um sie willkommen zu heißen.
Er war wieder zurück in der Welt der Waffenübungen und des Umgangs mit grobem Rüstzeug, die ihm in den letzten zwei Jahren Heim und Schutz geboten hatte, die er lieb gewonnen hatte, die ihm nun fast vertrauter war, als die Welt hinter Kirchenmauern, die so weit in die Ferne gerückt war. Dieses neue Leben hatte aus dem langen, schmalen Novizen, einen kräftigen, jungen Mann geformt, denn die Waffenübungen hatten starke Muskeln auf seine Schultern, Arme und Beine gelegt und ein weicher Flaum wuchs nun in seinem Antlitz. Friedrich war glücklich. Morgen, morgen würden sie wieder gemeinsam jungen Hunden gleich dem Treiben der Knappen nachgehen, sich hauen, Anweisungen hinnehmen, gehorchen, Demut üben, um danach darüber Späße zu treiben, die Ställe säubern und die erfahrenen Ritter bewundern.
Als sie im Hof der Schwanenburg von ihren Pferden abstiegen, lief die junge Gräfin Mathild, Tochter des Grafen von Dinslaken, die Treppen des Palas herunter und sprang Dietrich in den starken Arm. „Dietrich, endlich.“ Sie küsste ihn auf den Mund.
Friedrich sah sehnsüchtig zu ihnen herüber. Am liebsten wäre er an Dietrichs statt gewesen. Wie war es wohl von einer Frau auf den Munde geküsst zu werden?
Dem Sehnsuchtsgedanken war nur kurz Platz geboten, denn Conrad und Gerhard rissen ihn bereits zu Boden. Das eigenartige Begrüßungsritual der drei Freunde, die sich raufend durch den Schmutz des Burghofes wälzten, wurde vom Seneschall mit Kopfschütteln kommentiert.
„
Ihr Narren!“, rief er, „steht auf und versorgt die Pferde.“
Die drei grinsten sich an, klopften sich ausgelassen den Dreck von den Kleidern, woraufhin sie die Pferde gemeinsam zu den Tränken bei den Ställen führten. Wenigstens konnten sie dort unbehelligt ihren Späßen nachgehen, während sie die Tiere mit Futter und Wasser versorgten und den Schweiß der Reise mit groben Bürsten von ihren Rücken und Flanken rieben.
Vorbereitungen
Im Verlauf des Sommers hatte König Otto seine Position in deutschen Landen so weit gefestigt, dass er bei der Bischofswahl in Cölln und Minden eigene Anhänger durchgesetzt hatte. In Cölln hatte Bruno von Sayn die Nase vorn. Im schwäbischen Konstanz hatte er Werner von Staufen zum Rücktritt nötigen und einen Ministerialen aus einer edelfreien Familie einsetzen können. Er versprach sogar, seine entfernte Cousine, Beatrix von Staufen, zur Braut zu nehmen. Die Taktik, die er damit verfolgte, zeigte Wirkung in Schwaben. Auch das Ehehindernis der verwandtschaftlichen Bindung beseitigte er planvoll. Mit einem feierlichen Staatsakt auf dem Reichstag von Würzburg ließ er sich offiziell die Verbindung mit den Staufern von allen Seiten absichern. Er war sich auch der kirchlichen Weihe durch die einundfünfzig Zisterzienseräbte gewiss, die sich zuvor anlässlich eines Ordentreffens in der Abtei Walkenried, nahe der Welfenstadt, Braunschweig, versammelt und den König nach Würzbourgh begleitet hatten. Außerdem rief er zu Würzbourgh den Landfrieden aus. Dieser sicherte ihm für die Zeit des Italienfeldzuges Ruhe um die Vorherrschaft im Reich. Doch all seine Vorkehrungen waren nur Mittel zum Zweck.
Das große Ziel des Königs war die Souveränität über das gesamte christliche Imperium. Doch nur, wer das Königreich Jerusalem sein eigen nannte, besaß diese unantastbare, von der Macht des Papstes befreiende Souveränität.
Zuvor allerdings hatte er noch zwei Stolpersteine aus dem Weg zu räumen. Beide Hindernisse allerdings schienen lösbar. Das eine war, das Südreich zu erobern. Das andere war, einen namenlosen, minderjährigen, staufischen Spross, Sohn des verstorbenen Heinrich VI. und der Normannen-Königin Constanza, aus dem Weg zu räumen. In Sizilien lebte dieser. Also würde der Feldzug bis nahe an das Ende der bekannten Welt gehen.
An Jakobus, dem Tag Ottos Lieblingsheiligen, brach das prächtige Heer von tausendfünfhundert Rittern mit dem Kaiser an der Spitze zum Zug nach Rom auf. Von Augsbourgh aus zogen sie durch geerntete Felder, durch die goldbraunen Auen und herbstlichen Wälder des deutschen Südens zum Brennerpass. Nach nur drei Wochen, am Tag des heiligen Meinhard, erblickte das Heer den Garda-See. Um möglichst schnell nach Rom zu gelangen, mied Otto die größeren oberitalienischen Städte.
~
„Otto der Vierte von Braunschweig ist vom Papst in Rom zum Kaiser gekrönt worden!”, schallte es von der Mauer.Friedrich ließ Schwert und Schild sinken und nahm den Helm ab. Er wendete sich in die Richtung, aus der die Kunde kam.
„
Am vierten Oktober in der Peterskirche zu Rom!”
Die Zweikämpfe im Übungshof hörten schlagartig auf und die ganze Schar schaute auf den jungen Ritter im Wehrgang der Festungsmauer.
An den Mauern des Burghofes türmte sich der Schnee, während zertretenes Stroh den fast gänzlich vom Schnee befreiten Innenhof bedeckte. Schlamm hatte sich mit dem nun zertreten Stroh vermengt und haftete an den Beinkleidern der jungen Kämpfer.
„
Dann ist es bald soweit, Friedrich!”, rief Conrad, der mit einem anderen Armiger die Waffenübungen abgehalten hatte, herüber.
„
Endlich“, stöhnte Friedrich, ging auf die Mauer zu, ließ sich dort auf eine Holzbank niedersinken und setzte einen tönernen Krug mit Wasser, den er vom Boden gegriffen hatte, an den Mund. Gierig trank er von dem eisigen Nass. Zu gierig. Er verzog das Gesicht.
Gerhard ließ sich ebenfalls neben ihm auf die Bank fallen und schaute Friedrich mit seinen großen blauen Augen an. Dann grinste er. Als Friedrich den Krug endlich abgesetzt hatte und ihn zu Gerhard herüberreichte, grinste Friedrich zurück. Mit seinem eher braunen als blonden Haar, das seine nördlichere Heimat häufig hervorbrachte, seiner bleichen Gesichtshaut und seiner markanten Nase, war der Freund von einer eigenwilligen Schönheit, die, gerade als Friedrich den Blick abwenden wollte, durch des Freundes zweifelnde Miene, getrübt wurde. Friedrich kannte diesen Ausdruck schon, den Gerhard immer dann auflegte, wenn etwas Unbekanntes, von dem er sich kein Bild machen konnte, bevorstand. Warum ist er nur so wankelmütig?!
Die Waffenübungen am Nachmittag gingen allen Gefährten leicht von der Hand und das Stöhnen über die Beulen und die Arbeit in den Pferdeställen fiel wesentlich leiser aus als an den Vortagen. Denn die jungen Burschen waren des Winters und der engen, stinkigen Kalkaden überdrüssig. Sie wollten raus in die freie Natur, nach Abenteuern suchen.
Am Abend versammelte Dietrich von Cleve seine Trustis zum Abendmahl um sich.
„
Ihr habt es gehört, Otto ist gekrönt. Das ist für uns das Zeichen zum Aufbruch. Nach Tuszien, wo der Kaiser sich jetzt aufhält, benötigen wir ungefähr fünfundvierzig Tage, wenn alles gut vorangeht.”
Der Tag des großen Zuges ins Südreich rückte näher. Eines Abends bemerkte Friedrich beim Säubern der Ställe, wie Gerhard bei seinem Pferd stand und es am Hals umarmte, wie ein Junge, der bei seiner Amme Zuflucht und Geborgenheit sucht. Ohne sich Gerhard aber zu erkennen zu geben und sich weiter Gedanken darüber zu machen, setzte er seine schweißtreibende Arbeit fort. Er, Friedrich, glühte nach Taten. Doch auch auf Friedrich lastete eine Ungewissheit, wenn auch ganz anderer Art.
Bis Maria Lichtmess war es nicht mehr lang. Fast täglich stand er auf dem Burgwall und hielt Ausschau nach dem Boten seiner Mutter.
Am Tag der Heiligen Barbara, einen Tag vor Ablauf der Frist, wurde sein sehnsüchtiges Warten belohnt. Er sah Aelred schon von weitem. Doch was war das?
Aelred war nicht allein. Er wurde begleitet von Wibold, Ortliv und den Zwillingen, Gerulf und Gundalf. Friedrich winkte ihnen von der Burgmauer zu. Ortlivs scharfes Auge erkannte ihn als erstes und er winkte zurück. Nun wusste Friedrich, dass sein großer Traum wahr wurde. Mehr noch, die Anwesenheit Aelreds und der anderen gab ihm eine große Geborgenheit. Erleichtert ließ er sich an der kalten Wehrmauer auf die steinernen Platten des Wehrgangs niedersinken und dankte seiner Mutter im Stillen.
„
Die mitgeführte Verpflegung muss vom Reisetage an drei Monate reichen, die Waffen und Bekleidung ein halbes Jahr!“, rief der Seneschall von Cleve mit unleidiger Stimme. Mit gewichtiger Geste wiegte er eine lange Schriftrolle vor seinem fetten Wanst mal hier hin mal dort hin, je nach dem, wohin die Ware zu legen war. Friedrich war, trotz der unfreundlichen Anweisungen, eifrig bei der Arbeit. Der großen Fahrt stand nun nichts mehr im Wege. Die Mutter hatte ihn freigeben, Gott sei es gedankt!
„
Berittene sollen Schild, Lanze, Schwert und Hirschfänger mit sich führen“, rief diesmal der Seneschall den Rittern zu.
„
Dazu Bogen und Köcher mit Pfeilen.“
Es war ein heilloses Durcheinander im Burghof der Schwanenburg. Zu den Knechten, die unter den Lasten um Gleichgewicht ringend knöcheltief im Schlamm des Hofes hin und her rutschten, brüllte er hinüber, „auf Packwagen sollen geladen sein, Äxte und Hacken, Bohrer, Beile und eiserne Sparten … und die Zelte. Vergesst die Zelte nicht, ihr Esel!“
Am Tage des Heiligen Valentin war es soweit. Die Pferde schnaubten ungeduldig. Der Burghof war von Geschäftigkeit erfüllt. Die Ritter und das Kriegsvolk verabschiedeten sich von ihren Frauen und Kindern.
Dietrich kam aus dem Palas. An der Hand die hübsche Mathild. Mathild blieb auf der Treppe stehen und entließ ihren Mann, der in die Mitte des Burghofes ging, um mit einem Sprung auf dem Rand des Brunnens Aufstellung zu nehmen.
„
Leute, hört her!“, rief er. „Nun ist der Tag gekommen, auf den wir so lange gewartet haben. So der Allmächtige uns von heute an leite, wollen wir am Josefstag in Tuszien anlangen.“
Dietrich zog ein Pergament aus seinem Gürtel, rollte es auf und zitierte daraus.
„
In der Zwischenzeit mahnt mich der Kaiser, durch welche Teile des Reichs auch immer wir reiten, keiner sich unterstehe außer Grünfutter, Holz und Wasser, irgendetwas anzurühren. Wenn wir durch fremden Besitz marschieren, sollen die Führer immer bei ihren Leuten sein, auf dass die Abwesenheit eines Oberen den Knechten nicht Gelegenheit gibt, Unheil anzurichten. Das soll bis zur Ankunft beim Kaiser so sein! … Und nun“, er hob die Stimme und wies in Richtung des großen Burgtores, „lasst uns aufsitzen und auf Ritterfahrt gehen!“
Die Männer stimmten mit lauten, unternehmungslustigen Rufen in die Aufforderung ihres Herrn ein. Ein Horn blies zum Aufbruch. Dietrich schaute in die bunte Menge. Die Männer waren froh gestimmt und des Wartens überdrüssig. Als er von dem Brunnen herunterstieg, hob das Stimmengewirr des Abschieds an. Der Graf saß auf und hieß die Männer Gleiches zu tun. Und augenblicklich kam das Heer in Aufruhr. Der Burgkapplan zog, von einem Novizen mit einer weißen Standarte, auf der gülden das Kreuz Jesu prangte, die Reihen bekreuzigend vorbei, als Mathild zu Friedrich, der gerade aufsitzen wollte, herüberkam.
„
Friedrich, warte.“ Sie hielt ihn am Arm.
„
Ich soll dir einen Gruß von der Mutter sagen. Sie wünscht dir Glück und erwartet dich im nächsten Jahr gesund zurück.“
Sie hatte ihn bei den Schultern gefasst, und ihre Augen strahlten ihn an. Wie ein warmer Schauer durchströmten ihn die Worte. Dann zog sie aus ihrem Ärmel ein Tuch und band es ihm um den linken Arm. Sie zog ihn zu sich heran und drückte Friedrich an ihre Brust. Ein innerer Reflex befahl ihm sich zu wehren, doch sein Stolz und seine männliche Haltung wichen aus ihm, ohne dass der innere Impuls noch über ihn gebieten konnte. Ergeben ließ er den Kopf an ihre warme Brust sinken. Ein unendliches Gefühl von Glück breitete sich in ihm aus. Von seinem Pferd schaute Gerhard, der bereits aufgesessen war, voll von eigenem Gram zu den beiden herüber. Dann hörte Friedrich das Klirren der Geschirre, die Rufe der Männer und die Rufe der Familien zum Abschied. Er löste sich aus der Umarmung und nahm mit einem scheuen, dankbaren Blick Abschied von Mathild. Der Tross setzte sich in Bewegung und verließ die Schwanenburg.