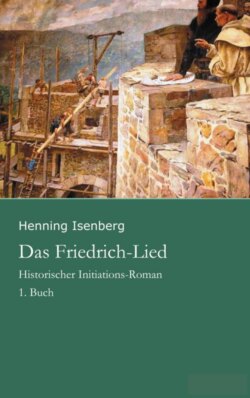Читать книгу Das Friedrich-Lied - 1. Buch - Henning Isenberg - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5. Kapitel
ОглавлениеDrei Wochen reiste der Tross durch deutsche Lande nach Süden. Ihr Weg führte Dietrichs Heer entlang des Rheins über Neuss, Cölln, Koblenz und Boppard. Entlang des Mains über Frankfourt, Aschaffenbourgh, Würzbourgh und dann über die freien Landschaften nach Süden über Nürnberghe, Ingolstadt und München. Sie kamen durch befriedetes Land. Überall säumten grüne Felder den Weg. Bauern gingen endlich, nach langen Jahren ungeklärter Herrschaftsverhältnisse und fortwährender Zerstörung, wieder hinaus und bestellten ihre Schollen, um im Herbst die Erträge ihrer Arbeit zu ernten. Die Wälder hallten von den Hieben der Äxte wider. Karren mit schweren langen Stämmen beladen rumpelten den Städten und Marktflecken zu, während sie von geschäftigen Händlern, Marktleuten und Fahrenden hinter sich gelassen wurden, als hätten es diese ihrerseits eilig, den besten Platz auf den zu neuem Leben erwachten Marktflecken zu ergattern. Ob auf alten oder neuen Märkten erblühte der Handel wieder. Überall waren die Zimmerleute über den Mauern der Städte auf den Dächern der neuen, steinernen Patrizierhäuser zu sehen. Denn viele Städte hatten das Befestigungsrecht zugesprochen bekommen – ein Zugeständnis Ottos an das aufstrebende Bürgertum. Weniger hingen die Bürger nun vom Gutdünken ihrer Landesherren ab oder mussten marodierende Banden fürchten. Nun konnten sie sich selbst schützen und verwalten. Das Selbstbewusstsein der Städter stieg. Stadtluft macht frei, hieß es in diesen Tagen.
Insbesondere in Baiern und Schwaben hatte der Kaiser sich so eine große Anhängerschaft erworben.
Beschwingt und frei reisten die drei Freunde durch das deutsche Land und sogen, trockenen Schwämmen gleich, die Erkenntnisse über die Unterschiedlichkeiten der Landstriche, Menschen und ihrer Sprachen in sich auf.
Bei der reichen Handelsstadt Innsbruck vereinigten sie sich, wie es der Kaiser gefordert hatte, mit weiteren frischen Truppen aus deutschen Landen unter dem Banner Eberhards von Lautern. Doch die Städte wollten das größer werdende Heer nicht lange versorgen und so zog der nun stattliche, tausendfünfhundert Reiter zählende Heerwurm von Innsbruck aus weiter über Aue und Klösterle hinein in die riesenhaften Bergtürme der Alpen. In Clausen und Säben fanden sie Aufnahme in den Commenden der Ordensritter, während sie sonst, sehr zum Schrecken der Bauern, auf deren Feldern und Matten lagerten, die sie dann, für die Ernte meist völlig unbrauchbar, zurückließen. Je weiter sie die Alpen hinaufstiegen, so enger wurde der Reiseweg. Schließlich mussten sich die Abteilungen aufteilen und ihre Wege durch Klammen und über Saumpfade finden. Die Tage, an denen das Heer sich teilen musste, waren gefährlich, denn all zu leicht konnten die schweren Panzerreiter Opfer räuberischer Banden werden und eine Absicherung des Trosses war in diesem unwegsamen und unbekannten Gelände schwierig. Einzig blieben zum Schutz die großen Hörner. Allerorten erschallten sie, mit deren Hilfe sich die Truppen ihrer gegenseitigen Anwesenheit versicherten.
Obwohl das Wetter in diesem Frühjahr unbeständig war, hatten sie bei der Überquerung der gerade eben eisfreien Alpenpässe tagsüber eher mit der gleißenden Sonne, die jede Orientierung erschwerte, zu kämpfen als mit Regen und Kälte. Nässe und Kälte aber kroch nächtens in ihre zugigen Schlafstätten.
Als sie endlich durch die engen Schluchten aufgestiegen waren, erreichten sie im Tyrol wieder größere Pässe, wo sie unter dem Schutz der dortigen Herren reisten. In Brixen vereinigte sich das Heer wieder und setzte den Weg nach Teint zügig fort. Am siebzehnten Tag ihrer Reise durch die Alpen erreichten sie schließlich Trient.
Dietrich von Cleve nahm Friedrich und Gerhard zu seinem Geleit mit in die Stadt. Die Heerführer waren zu einer Audienz beim neuen Bischof von Trient geladen.
Bischof Friedrich von Wangen war ein Mann der Kaisers. So hatte Otto sichergestellt, dass ihm der Weg über die Alpen stets offen stand. Im Gefolge des Bischofs befanden sich viele deutsche Kirchendiener. Als Gerhard und Friedrich den Herzog verabschiedet hatten, begaben sie sich auf die Suche nach Bekannten aus der Heimat.
„
Bruder, wo finden wir den Abt?“, fragte Gerhard einen Geistlichen, der ihnen im Klosterbezirk entgegenkam. Der Mönch schaute auf ihre Kleidung, wie zum Einverständnis verschränkte er die Hände in den Ärmeln seiner Kutte, senkte wieder den Kopf unter seiner Kapuze und sprach, in dem er sich zum Gehen wandte, „folgt mir, meine jungen Herren“.
Beim Abt angekommen, fragten sie nach Brüdern, die aus dem Erzbistum Cölln abgestellt waren. Aus der Liste, die ihnen der Abt zeigte, kannte Friedrich Heinrich von Sankt Gereon.
„
Wie finden wir Bruder Heinrich, Vater?“
Der Abt winkte einen Mönch zu sich und gab ihm auf, die Gäste in die Kanzlei zu Heinrich von Sankt Gereon zu führen.
Überrascht blickte Heinrich auf, als die Freunde von dem Mönch in die Kanzlei geführt wurden.
“
Friedrich, wie kommst du hier her?!“, rief er aus und sich im nächsten Augenblick unsicher und geduckt umschaute. Einige Mönche schauten auf, um sich sogleich wieder ihren Arbeiten zu zuwenden.
„
Wir sind über die Alpen gekommen, um mit dem Kaiser in seinem Italienfeldzug zu Diensten zu sein. Danach wollen wir mit ihm Seite an Seite im heiligen Lande kämpfen.“
„
Ah, also zieht ihr nach Tuszien zum Kaiser?!“, flüsterte Heinrich, während er sie hinter sich her aus der Kanzlei zog. Er nutzte die Zeit der Stille, sich der Umstände, unter denen Friedrich Cölln verlassen hatte, zu erinnern. Draußen angekommen, schauten sie sich ein paar Sekunden in die Augen.
„
Ich hörte vom Tod deines Vaters. Es tut mir leid, was passiert ist.“
Friedrich nickte und senkte den Blick auf die wie Fischgräten angeordneten dunkelroten Backsteine im Muster des Bodens.
„
Dann bist du jetzt der Graf von Altena?!“
Friedrich nickte abermals, „aber die Sporen der Ritterschaft will ich mir hier erst noch verdienen.“
„
Mit dem Segen der Kirche dürfte das ein Leichtes werden.“
„
Dies ist Gerhard von Büderich. Wie ich Armiger in Diensten meines Oheims, des Grafen von Cleve.“
Gerhard und Heinrich nickten sich zu.
„
Aber sag, Heinrich, wie kommt es, dass du hier bist?“
„
Als du fort warst, wurde ich im darauffolgenden Frühjahr zum Scholaster von Sankt Gereon ernannt. Als der Kaiser in Rom war, forderte Bischof Friedrich mehrere Brüder aus deutschen Landen an. Das Erzbistum hat mich ausgewählt. So komme ich hier her. Doch werde ich bald mit euch nach Tuszien ziehen. Dort soll ich in der Schreiberei der kaiserlichen Kanzlei dienen. Es heißt, der Kaiser wolle das Kirchengefolge aus Rom nicht.“
„
Das ist ja wunderbar, Heinrich.“
„
Ja, es wird sicherlich eine spannende Zeit.“
„
Heinrich, begleitest du uns in die Stadt und zeigst uns, wo wir unseren Hunger und Durst befriedigen können.“
Endlich wieder frei vom Leben in Wiesen und Wäldern, von den Strapazen der Reise, nächtlicher Kälte und Gefahren schlenderten die jungen Burschen durch die engen Gassen und über die schönen Plätze von Trient. Sie genossen das bunte Treiben und den Anblick der jungen Mädchen.
Nach einer Weile kamen sie an einen Platz, auf dem Wachen des Bischofs einen bärtigen Mann von einem Brunnen gezerrt hatten, auf dem er wohl Aufstellung genommen hatte. Ein Dominikaner beaufsichtigte offensichtlich das Geschehen.
Der Mann schrie, „leidet nicht länger in einer Welt, in der die Lichtseele des Menschen nicht daheim sein kann. Ihr seid fremd hier, da ihr weilt in einem irdischen, befleckten Körper.“
Während der Mann rief prügelten die Wachten unentwegt auf den Wehrlosen ein. Doch dieser schien, trotz der Hiebe, sein eigenes Heil der Verkündung seiner Botschaft hintanzustellen.
„
Vollrichtet nun das Werk Mani an mir. Befreit mich von meinem stinkenden Körper. Und dann folgt mir, ihr Diener Manis.“
„
Manichäer!“, schnaufte Heinrich verächtlich.
Friedrich und Gerhard starrten betroffen auf die paradoxe, von vergnügungsfrohen Passanten bezeugte Szenerie, die sich im Kern aus den brutalen Wachen und dem friedvollen, jedoch herausfordernden und standhaften Prediger zusammenfügte. Heinrich zog sie eilig fort von dem Ort.
„
Kommt, ihr wollt doch essen und trinken!“
Als sie in der Schänke, zu der sie Heinrich geführt hatte, beisammen saßen, fragte Friedrich Heinrich, „was war mit dem Mann vorhin?“
„
Das war eine Heuschrecke der Apokalypse. Eine der schlimmsten Sorte. Ein Manichäer.“
„
Und was ist ein Manichäer?“
„
Sie wollen die Welt überwinden. Sie sind Extreme, die alle mit sich reißen wollen.“
„
Wie mitreißen“, fragte Gerhard.
„
Sie haben für sich den Anspruch der Gnosis.“
„
Was ist Gnosis?“
„
Erkenntnis.“
„
Erkenntnis in was?“
„
Sie glauben an ihren Propheten Mani. Der hat angeblich um das Jahr zweihundert die Essenzen aller Katechismen zu einem Buch zusammengefasst. Das lässt sie glauben, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen.“
„
Heinrich“, lachte Friedrich erstaunt, „nicht so verbissen.“
„
Ja, du hast gut lachen, du musst dich ja nicht mehr mit dieser Plage herumschlagen. Der manichäische Gnostiker glaubt, dass das Licht, dass Gott, unendlich weit von unserer Welt entfernt ist und die grobe, undurchlässige Körpermaterie uns daran hindert, Gott nahe zu sein. Nur eine Seele aus feinstem Stoff, ist in der Lage, in die göttliche Sphäre vorzudringen. Nur er, der sich selbst genug ist, greift das Unfassbare, ist die Vollendung des Lichts, begreift die Erleuchtung.“
„
Noch kann ich nichts sehen, warum dieser Mann derart zu Tode geprügelt werden muss“, wandte Gerhard ein.
„
Ihr versteht nicht!“, rief ihm Heinrich erregt. „Für sie ist es nicht möglich, dass wir von Gott oder vom Messias auf Erden erlöst werden. Nur ein Heraustreten aus dieser Welt kann die Erlösung bringen. Ein Heil im Diesseits gibt es nicht. Diese Welt ist in ihren Augen nur Finsternis. Eine ketzerische Irrlehre.“
„
Und wo ist Licht?“, fragte Friedrich.
„
Sie sagen in jedem Menschen gibt es einen Gottesfunken, die Seele, das höhere Selbst.“
„
Das sagt doch das Christentum auch.“
„
Ja, aber für sie ist es auf Erden nicht und nicht in dieser Zeit. Es gibt hier kein Gut. Nur Böse. Und sie wollen alle zur Umkehr bewegen, diese Welt nur zu überwinden. Dafür errichten sie ihre Tempel, wo sie die Blüte des Volkes zerstören wollen. Die Welt ist für sie nicht gottgewollt.“
„
Das ist wirklich extrem. Kaum zu verstehen“, sagte Gerhard, „ für uns Christen ist sie doch gottgewollt, diese Welt. Und wir leben in einem Zeitalter, da der Messias zu uns auf die Erde kommt, um uns, die Menschen, die Kinder Gottes, erneut zu erlösen. So weissagen es die Gelehrten.“
„
Deshalb werden die Frevler, die gegen unsere Lehre predigen, verfolgt. Zum Glück ist ihre Zeit vorbei. Manichäer trifft man heute nur noch selten. Ihre Zeit war bereits vor Beginn der Kreuzzüge vorbei. Die meisten von ihnen finden sich heute in einer kleinen Bergenklave im byzantinischen Reich; im fernen Osten solle es auch ein paar geben, berichten Händler. Schlimmer sind hier andere Ketzergruppen. Humiliten, Waldenser, Runcianer, Albigenser, die armen Christen. Sie verbreiten sich wie Heuschreckenschwärme. Eine regelrechte Plage.“
Friedrich wünschte sich, sie hätten ein anderes, heitereres Thema angesprochen. Doch Heinrich wollte sich gar nicht mehr beruhigen. Zum Glück hörte Gerhard Heinrich weiterhin zu. Friedrich hingegen trank für sich sein Bier, schaute dem bunten Treiben in der Schankwirtschaft zu und wunderte sich. Normalerweise schlagen sie so auf die Juden ein. Was sind diese Christen für Menschen, dass sie alles und jeden meinen, vernichten zu können. Wir verhalten uns wie Übermenschen und unterwerfen alles und jeden im festen Glauben auf dem richtigen Pfad zu wandern. Doch scheint es mir, als vereine diese Zeit alle Sünden wie in einem Urwald, aus dem es kein Entkommen mehr gibt…. Eine Seele, die sich in fernen Zeiten einen neuen Körper sucht, könnte mehr des Guten vorfinden. Reifere Seelen und mehr Menschen ohne Gier und Gewalt.
„
Psst, Gerhard?“, fragte Friedrich seinen Freund, als sie sich auf den Pritschen des Dormitoriums in der Klosterburg von Trient zur Nachtruhe gebettet hatten, „…geht dir der Mann, den sie heute auf dem Marktplatz zusammengeschlagen haben auch nicht aus dem Kopf?“
„
Hm, weswegen?“, murrte Gerhard, der schon fast schlief, zurück.
Hast du nicht auch manchmal das Gefühl, nicht auf dieser Welt zu Hause zu sein? Nur auf der Durchreise zu sein?“
„
Ja, mag sein.“
„
Weißt du, manchmal fühle ich mich wirklich alleine und einsam.“
„
Ja, unser Leben in den Wäldern ist manchmal einsam, da können wir froh sein, wenn wir Kameraden haben.“
„
Gut, ja. Ich meine aber dieses Gefühl, letztendlich alleine auf der Welt zu sein. Im Inneren.“
„
Friedrich!“, murrte Gerhard ungeduldig und schläfrig.
„
Nein, Gerhard, das ist mir wichtig. Und du scheinst mir der einzige zu sein, der mich versteht. Mich macht dieses Gefühl so unendlich traurig und ich frage mich, was ist der Sinn, warum uns Gott auf diese Erde geschickt hat. Wozu müssen wir hier durch?“
„
Du meinst, wenn hier sowieso alles Irrsinn und Chaos ist, wie die Manichäer meinen?“
„
Ja.“
„
Aber deren Lehre ist doch eine Irrlehre.“
„
Ja, aber warum bleibt dann diese Leere und Trauer in mir. Warum konnten mir die Novizenjahre diese Leere nicht nehmen? Könnte nicht irgendetwas dran sein, das wir woanders als hier die Erleuchtung bekommen, woanders zu Hause sind?“
„
Du meinst, wo ist dein Ort und was ist der Sinn deines Hier seins?“
„
Ruhe da drüben“, fauchte es von einer anderen Pritsche aus dem Dunkel des Schlafsaales und die beiden schwiegen eine kurze Weile. Dann flüsterte Gerhard, „so lange, Friedrich, glaube, wie du es immer getan hast, glaube an Gott, den Allmächtigen, der alles richtet und uns unseren Platz in der heiligen Ordnung weist. Es wird dir so nichts geschehen.“
Dann war es still. Friedrich lag noch eine ganze Weile wach.
Heilige Ordnung, dachte er, nichts geschehen! Die Verantwortung in die Hände eines Wesens, das sich Gott nennt, legen und der Gewalt weithin zusehen. Ist das alles gottgewollt?! Es geschieht schon etwas und Gerhard, ach, niemand, den ich kenne, will sich die letzte Frage stellen. Was ist es, was diese Trauer in mir heraufbeschwört? Ist es die Begrenztheit der Jahre zwischen Geburt und dem Streben der Körperhülle? Die Trauer um die Vergänglichkeit, gepaart mit der Erkenntnis, wie wenig der Mensch zu schaffen vermag? Ist es die Angst zu scheitern? Gott am Ende ein schlechter Diener gewesen zu sein? Beim Eintritt des Todes nichts geschafft zu haben; nichts hinterlassen zu können? Die Ungewissheit, ob nach dem Leben auf dieser Erde, ein weiteres folgte? Was vermag der Mensch, was vermag ich zu schaffen? Woran kann ich sehen, dass ich glaube? fragte er sich. Was ist der Sinn meines Lebens? Was ist der Sinn der Zeit zwischen der Geburt und dem Tod? Also, dem Schritt in das Paradies – oder in die Hölle. Ist es, ein gottgefälliges Leben zu führen, um den Höllenqualen zu entgehen und alles erdenkliche Glück im Paradies zu empfangen? Was ist mein Auftrag für mein Leben? … Wenn es der ist, in der Ritterschaft Ruhm und Ehre zu erlangen, muss ich nach den Regeln der Ritterschaft leben – in der Annahme sie bringen Licht in das Grauen der Gedankenlosigkeit.
Er flüsterte die ritterlichen Tugenden in die Dunkelheit über ihm: „Treue und Gefolgschaft, Heldenmut und Tapferkeit, Höflichkeit und Freigiebigkeit.“ Er wiederholte die ritterlichen Tugenden und fügte hinzu, „mit Gottes Willen.“ Für das erste beruhigte ihn seiner Gedanken Antwort und er konnte unter den Geräuschen schnarchender und furzender Männerleiber in den Schlaf sinken.
Von Trient aus setzte sich das Heer, verstärkt durch die frommen Streiter Gottes, wieder in Bewegung, um nun den letzten Teil der Reise zu bewältigen, bevor es sich mit dem kaiserlichen Heer in Tuszien vereinen sollte. Noch am selben Tag ließen sie den Gardasee hinter sich und durchschritten in wenigen Tagen die Po-Ebene, bevor es an den Aufstieg zur Feste San Miniato al Tedesco ging.