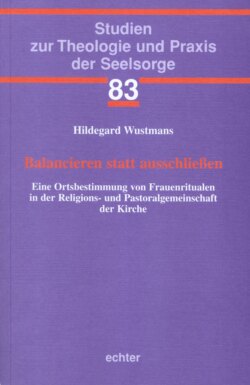Читать книгу Balancieren statt ausschließen - Hildegard Wustmans - Страница 19
1.2.2 Methodische Konsequenzen 1.2.2.1 Zur Relevanz qualitativ-empirischer Forschung im Bereich aktueller ekklesiologischer Entwicklungen
ОглавлениеEmpirisches Arbeiten in der Theologie ist darauf gerichtet, die tatsächlichen Begebenheiten zu beschreiben und zu erklären (vgl. van der Ven 1990, 90). Die Beschreibung wird dabei von dem her bestimmt, wie sich die Realität zeigt bzw. wie sie von Menschen wahrgenommen wird. Die Erklärung basiert dann auf genau dieser Beschreibung. So kann die Gefahr gebannt werden, an Orten präsent zu sein, die keine(r) mehr aufsucht, und Antworten auf Fragen zu geben, die keine(r) mehr stellt. Empirisches Arbeiten in der Theologie steht zugleich dafür, die Wahrnehmungen des Volkes Gottes ernst zu nehmen und nach dem consensus fidelium zu suchen (vgl. Finucane 1996; Yong-Min 2003). Sie achtet auf die individuelle gelebte religiöse Praxis der Menschen, hört auf ihre Fragen und Zweifel, nimmt ihre Formen des gelebten Glaubens wahr und reflektiert sie (vgl. Klein 2005, 36–38). Nur wenn die Theologie auf die Stimmen und Fragen des Volkes Gottes hört, wird sie in der Lage sein, angemessene Wörter und signifikante Symbole für eine Verkündigung der Frohen Botschaft zu finden, die in die konkreten Erwartungen und Bedürfnisse der Menschen auch tatsächlich hineinwirkt (vgl. van der Ven 1990, 28; ders. 2002).
Bei empirischen Arbeiten ist zwingend zu bedenken, dass die Entscheidung für eine bestimmte Methode, quantitativ oder qualitativ, den möglichen Erkenntnisgewinn wesentlich bestimmt. Mehr noch, die Erkenntnisse sind zudem von der Subjektivität der Forschenden geprägt, von ihren eigenen Erfahrungen, Standpunkten und kulturellen Hintergründen. „Auch die empirischen Wissenschaften beschreiben die Wirklichkeit nicht einfach ‚so, wie sie ist‘. Jede Beschreibung und Theorie beinhaltet subjekt- und kulturabhängige Deutungen“ (Klein 2005, 25). Vor diesem Hintergrund ergibt sich auch die Notwendigkeit der empirischen Wissenschaften, nicht nur Daten und Tatsachen darzustellen, sondern auch den Prozess der Datenerfassung darzulegen und zu reflektieren.
Im Nachfolgenden sollen Möglichkeiten und Grenzen quantitativer und qualitativer Methoden vorgestellt werden, um die Basis für die Methodenwahl der vorliegenden Arbeit vorzubereiten.
In den Sozialwissenschaften wurden quantitative Studien vorwiegend bis in die Mitte der 60er Jahre durchgeführt und die Qualität der Forschungen wurde vor allem daran gemessen, wie gut eine Übertragung in naturwissenschaftliche Modelle gelang (vgl. Hopf 1993). „Quantitative Studien unterscheiden sich von qualitativen in erster Linie durch ihre wissenschaftstheoretischen Grundpositionen, den Status von Hypothesen und Theorien sowie das Methodenverständnis“ (Atteslander 102003, 83). Quantitative Methoden sehen soziale Realität als objektiv gegeben an und mithilfe kontrollierter Methoden ist diese auch erfassbar. „Empirische Forschung soll theoriegeleitet Daten über soziale Realität sammeln, wobei diese Daten den Kriterien der Reliabilität, der Validität sowie der Repräsentativität und der intersubjektiven Überprüfbarkeit zu genügen haben und in erster Linie der Prüfung der vorangestellten Theorien und Hypothesen dienen. Forscher haben den Status unabhängiger wissenschaftlicher Beobachter, die die soziale Realität von außen und möglichst objektiv erfassen sollen“ (ebd.).
Seit den 70er Jahren wuchs in den Sozialwissenschaften die Kritik an quantitativen Methoden, und zwar wegen der starken Bindung an Standards und des distanzierten, analytischen Blicks. In diesem Kontext entwickelte sich das Interesse, Lebenswelten von innen, aus der Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben, um so zu einem besseren Verständnis sozialer Wirklichkeit zu gelangen (vgl. Flick/von Kardorff/Steinke 22003, 14). Dabei wurden von Lammek (vgl. Lammek 1988, 21–30) sechs Prinzipien entwickelt, die wie folgt zusammengefasst werden können:
„1) Offenheit gegenüber der Untersuchungsperson, Untersuchungssituation und den Methoden. Der Verzicht auf die Hypothesenformulierung ex ante ist ein konkretes Beispiel.
2) Kommunikation als konstituierender Bestandteil des Forschungsprozesses. Die Forscher und Daten werden nicht als unabhängig voneinander gesehen, vielmehr interagieren sie miteinander.
3) Prozesscharakter. Die Verlaufprozesse in der sozialen Realität stehen im Mittelpunkt der qualitativen Forschung.
4) Reflexivität. Hierzu gehören Fragen der Sinnkonstitution und des Sinnverständnisses.
5) Explizitheit der Unterschritte und Analyseregeln.
6) Flexibilität der Forschungsschritte“ (Lissmann 2001, 54).
Qualitative Methoden räumen der Subjektivität der Befragten einen großen Freiraum ein. Dies wird z. B. bei Methoden wie den biografischen oder narrativen Interviews deutlich (Schütze 1979, 1983). Darüber hinaus verzichten qualitative Methoden auf eine Hypothesenbildung zu Beginn des Forschungsprozesses. So ist es eher möglich, neue Hypothesen im Forschungsprozess selbst zu entwickeln (vgl. Franke 2002b, 43). In der Übersicht stehen sich die beiden Forschungsansätze mit folgenden Charakteristika gegenüber (Bucher 1994, 23):
Im Rahmen der qualitativen Sozialforschung gibt es nun wiederum eine Vielzahl von Methoden. Nach Kardroff stehen sie in folgender Weise miteinander in Verbindung: „Qualitative Forschung hat ihren Ausgangspunkt im Versuch eines vorrangig deutenden und sinnverstehenden Zugangs zu der interaktiv hergestellt und in sprachlichen wie nichtsprachlichen Symbolen repräsentiert gedachten sozialen Wirklichkeit. Sie bemüht sich dabei, ein möglichst detailliertes und vollständiges Bild der zu erschließenden Wirklichkeitsausschnitte zu liefern. Dabei vermeidet sie so weit wie möglich, bereits durch rein methodische Vorentscheidungen den Bereich möglicher Erfahrungen einzuschränken. […] Die bewußte Wahrnehmung und Einbeziehung des Forschers und der Kommunikation mit den ‚Beforschten‘ als konstitutives Element des Erkenntnisprozesses ist eine zusätzliche, allen qualitativen Ansätzen gemeinsame Eigenschaft“ (von Kardorff 1991, 4).
Qualitative Methoden verfolgen das Ziel, komplexe Deutungs- und Wahrnehmungsmuster zu beschreiben und Strukturzusammenhänge freizulegen, „um eine umfassende Analyse individueller und kollektiver Handlungskontexte zu ermöglichen und damit Mechanismen der gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit herauszuarbeiten“ (Franke 2002b, 45). Die „dichte Beschreibung“ (Geertz 1987) kann gerade im Zusammenhang mit Fragen nach Religion und Spiritualität eine wichtige und produktive Vorgehensweise sein.
Praktische Theologie, die um ihre Sprachfähigkeit in Bezug auf aktuelle und komplexe, religiöse und theologische Entwicklungen ringt, sollte dabei auf jeden Fall auch auf die methodischen Entwicklungen in den Sozialwissenschaften und der Psychologie zurückgreifen und deren Anwendung im eigenen Fach vorantreiben. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil Praktische Theologie sich als Handlungswissenschaft versteht, deren Gegenstand die Kirche und das Volk Gottes sind (vgl. Mette 1979; Haslinger 1999, 102–121). Kennzeichnend für den handlungswissenschaftlichen Ansatz sind die folgenden Aspekte:
• „Das induktive Vorgehen, das nicht von der kirchlichen Dogmatik, sondern von den Erfahrungen der Menschen ausgeht.
• Der Einsatz von empirischen Methoden. […]
• Die interdisziplinäre Orientierung: Nur durch eine enge Zusammenarbeit mit anderen Handlungs- und Humanwissenschaften lassen sich die der Praktischen Theologie gestellten Probleme angemessen angehen.
• Die Vermittlung von Orientierungshilfen für gegenwärtiges und zukünftiges christliches, kirchliches und pastorales Handeln.
• Die Überwindung des ‚Subjekt-Objekt-Schemas‘“ (Klein 2005, 45).
Praktische Theologie hat nicht nur auf das Evangelium und die Tradition zu hören, sondern auch auf das Volk Gottes, auf das, was Männer und Frauen in der Welt von heute bewegt, wie sich die Männer und Frauen in ihrem Leben der Trauer und Angst, der Freude und Hoffnung stellen, nach ihnen fragen, um sie ringen und ihnen Ausdruck verleihen. Zur Beantwortung dieser Fragen kann empirische Forschung einen wichtigen Beitrag leisten, auf den die Theologie nicht verzichten sollte (vgl. Bucher 1994, 13).
Zur näheren Beschreibung des prekären Verhältnisses von Frauen und Kirche liegt es nahe, einen qualitativen Ansatz zu wählen, um die Erfahrungen der Frauen zur Entwicklung einer pastoralen Antwort auf diese Situation nicht nur zurate zu ziehen, sondern zum Ausgangspunkt zu machen. In ihren Frauenliturgien und Ritualgruppen zeigt sich eine Praxis, welche die Kirche und ihre Pastoral in besonderer Weise herausfordert. Es handelt sich bei ihnen um Orte, die die gängige pastorale und liturgische Praxis infrage stellen und auf ihre Defizite in der Darstellung in der Welt von heute hinweisen. Im Rahmen einer empirischen Studie wird es möglich, genauer auf diese Punkte einzugehen, den Prozess nachzuzeichnen und zu verstehen sowie vor diesem Hintergrund Perspektiven für eine neuerliche Annäherung von Frauen und Kirche zu entwickeln.