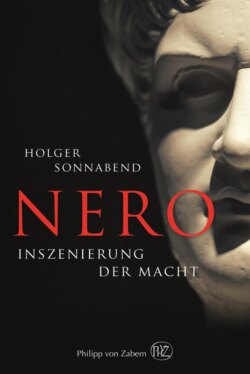Читать книгу Nero - Holger Sonnabend - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
|35|3 Der Bezugsrahmen: Die frühe römische Kaiserzeit
ОглавлениеNero war der fünfte römische Kaiser nach Augustus, Tiberius, Caligula und Claudius. Zugleich war er der letzte Kaiser aus der iulisch-claudischen Dynastie, die Augustus und seine Frau Livia gegründet hatten. Um Nero selbst und den von den Quellen gezeichneten Nero angemessen erfassen und würdigen zu können, muss das politische und gesellschaftliche Umfeld aufgezeigt werden, in das seine Herrschaft hineingehört. Im allgemeinen Bewusstsein rangiert die Zeit Neros, als Folge der Übernahme antiker und moderner Nero-Bilder, als eine Epoche der Dekadenz, als eine Phase, die geradezu paradigmatisch die sprichwörtlichen „Zustände wie im alten Rom“ repräsentiert. Jedoch ist daran zu erinnern, dass zur Zeit Neros die römische Monarchie noch recht jung und gerade dabei war, sich zu stabilisieren. Von Dekadenz kann also noch lange nicht die Rede sein, ebenso wenig von Kaisern, die sich als Götter fühlten. Die Vergöttlichung des lebenden Herrschers geschah erst viel später, am Ende des 3. Jahrhunderts, und sie war auch nicht das Werk hybrider Herrscher, sondern eine Sicherungsmaßnahme gegen die Gepflogenheiten der vorhergehenden Soldatenkaiserzeit, als es fast an der Tagesordnung gewesen war, Herrscher zu stürzen oder zu ermorden. Götter aber, so das Kalkül, ermordete man nicht so leicht wie Menschen. Doch diese Epoche lag zu Zeiten Neros noch in einer fernen Zukunft.1
Und bis zum Ende des römischen Kaisertums, das man bei oberflächlicher Betrachtung auch gerne mit Nero oder zuvor auch bereits mit Caligula in Verbindung zu bringen pflegt, sollte es auch noch sehr lange dauern – bis 476 im Westen mit der Absetzung des letzten Kaisers Romulus Augustulus, im Osten sogar bis 1453 mit der Eroberung Konstantinopels durch die Türken. So entfällt das vermeintlich historische Alibi, Nero gewissermaßen alles zutrauen zu dürfen, weil er eben das Produkt einer Phase der römischen Geschichte gewesen sei, als ohnehin alles aus dem Ruder lief. Eher wäre in diesem Fall der Frage nachzugehen, wie ein Nero innerhalb eines intakten politischen Umfeldes und angesichts der verdienstvollen |36|Pionierarbeit eines vorbildlichen Kaisers wie Augustus möglich gewesen ist.
Nero wurde am 15. Dezember des Jahres 37 geboren. Kaiser war zu dieser Zeit Caligula, der fast genau neun Monate zuvor, am 18. März, offiziell die Nachfolge des verstorbenen Tiberius angetreten hatte. Dieser wiederum war seit dem Jahre 14 direkter Nachfolger des Augustus, des Begründers des Principats, gewesen. Das Principat war die auch bereits zeitgenössisch so bezeichnete Form der Monarchie, die Augustus nach einer langen Periode der Bürgerkriege eingerichtet hatte. Nach dem Willen des Erfinders sollte diese Form der Herrschaft in einem deutlichen Kontrast zum alten römischen Königtum und vor allem zu der Diktatur Caesars stehen. Dass eine Alleinherrschaft das beste Rezept war, um die chaotischen Verhältnisse in der Zeit der späten Republik zu beenden, war die feste Überzeugung des Augustus. Stabilität und Ordnung waren nicht mehr durch eine Aristokratie zu gewährleisten, deren Mitglieder sich nur noch um ihre eigenen Interessen kümmerten. Jedoch hatte die Krise der römischen Republik einen nicht unwesentlichen Teil ihrer Dynamik gerade aus dem Umstand bezogen, dass im Prinzip jeder Senator und jeder Militärführer an eine persönliche Machtstellung dachte, die jeweils anderen aber bestrebt gewesen sind, ebendies zu verhindern.
Augustus war, nach der Ausschaltung seines größten Konkurrenten Marcus Antonius als Sieger aus den Bürgerkriegen hervorgegangen. Mit großem Geschick machte er sich ab 30 v. Chr. an die Aufgabe, seiner militärisch erworbenen Führungsposition auch politisch und gesellschaftlich Dauerhaftigkeit zu verleihen. Dabei kam das Königtum, mit dem die römische Geschichte einst begonnen hatte, ebenso wenig infrage wie Caesars Modell einer unumschränkten Alleinherrschaft. Die Ermordung des Adoptivvaters an den Iden des März des Jahres 44 v. Chr. – also am 15. März – war für Augustus Mahnung und Warnung genug, seiner angestrebten Machtstellung eine andere, eigene Gestalt zu geben.
Das Ergebnis war das „Principat“ – so benannt, weil es die Fiktion aufbaute, der Kaiser, wie der „Caesar“ – nun nicht mehr ein Name, sondern ein Titel – später genannt wurde, sei kein abgehobener Herrscher, sondern nur der primus inter pares, der „Erste unter Gleichen“. Das Principat gab sich in seiner Anfangsphase sogar den Anstrich der „wiederhergestellten Republik“. Tatsächlich blieben alle aus der Republik bekannten Institutionen, allen voran Senat, Volksversammlung und die gewählten politischen |37|Funktionsträger wie Konsuln, Praetoren oder Volkstribunen, bestehen. Der Kaiser nahm staats- und verfassungsrechtlich keine exponierte Position ein. Die Kompetenzen, auf denen seine institutionelle Macht beruhten, waren bereits aus den Zeiten der abgelaufenen Republik bekannt, mit dem einzigen Unterschied, dass sie Augustus dauerhaft und kumulativ bekleidete. Dazu gehörten die tribunicia potestas, die Amtsgewalt eines |38|Volkstribunen, die dem Princeps die innenpolitische Initiative vor allem in der Gesetzgebung ermöglichte, und das imperium proconsulare, die Befehlsgewalt eines Prokonsuls, die den Amtsinhaber in die Lage versetzte, verantwortlich und leitend außenpolitische, insbesondere militärische Unternehmungen, durchzuführen.
Abb. 1: Porträt des Augustus
Als Kern seiner Herrschaft hatte Augustus indes eine andere Kategorie auserkoren, die nicht so sehr in den politischen als vielmehr in den soziologischen Bereich gehörte. Am Ende seines Tatenberichts, der Res Gestae, verfasst ein paar Monate vor seinem Tod, steht, wie in Stein gemeißelt, der Satz: „Seit dieser Zeit überragte ich alle an Autorität, an Amtsgewalt aber besaß ich nicht mehr als die anderen, die ich in einem jeden Amt zu Kollegen hatte.“ An diesem selbstbewussten Anspruch mussten sich alle Nachfolger des Augustus und somit auch Nero messen lassen: Nicht die Kompetenzen, die von einem Amt ausgingen, waren entscheidend, sondern die auctoritas. Dabei handelte es sich um die nicht an ein Amt gebundene, sondern allein von der Persönlichkeit, der Aura, dem Charisma und nicht zuletzt auch den Leistungen des Kaisers geprägte Herrschaft. Autorität war demzufolge nicht einfach gegeben, sondern musste erworben werden.
Römischer Kaiser zu sein, bedeutete auch die Verpflichtung, für die Menschen da zu sein. Er war Teil eines komplexen sozialen Koordinatensystems, das auf dem für die Römer typischen Klientelwesen beruhte. In den alten Zeiten der Republik hatten die Adligen eine Art Schutzfunktion für jene Teile der Bevölkerung übernommen, die materiell und gesellschaftlich, im Gegensatz zu ihnen, nicht auf der Sonnenseite des Lebens standen. Jeder Adlige hatte als Patron eine mehr oder weniger umfangreiche Klientel, um deren Auskommen er sich kümmerte und die im Gegenzug alles ihr Mögliche tat, um das Prestige und das Ansehen ihres Förderers zu steigern. Mit dem Beginn des Prinzipats war es der Kaiser, der die Klientel nun monopolisierte und auf seine Person bezog. Konkret bedeutet dies, dass er sich intensiv um das Wohl der Bevölkerung – zunächst einmal in der Hauptstadt (der plebs urbana), dann aber auch in Italien und den Provinzen – zu kümmern hatte. Seit Augustus war es ein beliebtes und erprobtes Mittel, die Erfüllung der patronalen Verpflichtungen zu demonstrieren, wenn der Kaiser großzügig Getreide verteilte oder opulente Großveranstaltungen mit Gladiatoren oder Wagenrennen veranstaltete. Das war jener Kanon an Aktivitäten, die der römische Schriftsteller |39|Juvenal später auf die einprägsame und viel zitierte Formel „Brot und Spiele“ brachte. Diese Formel wurde häufig missverstanden als Beweis dafür, dass das römische Volk unter den Kaisern zu einer entpolitisierten, nur noch an Vergnügungen interessierten Masse degeneriert war. Tatsächlich handelte es sich aber um jene Faktoren, mit denen der Kaiser zeigen konnte, wie ernst es ihm damit war, seinen Pflichten als Patron nachzukommen. Das Volk wollte, so musste ein Augustus, ein Tiberius, ein Caligula, ein Claudius und eben auch ein Nero wissen, das Gefühl haben, vom Kaiser umhegt und geliebt zu werden. Nur dann gab es Pluspunkte auf der Sympathieskala. Ein Herrscher, der sich nicht blicken ließ und abgeschirmt von der Bevölkerung seinen dienstlichen Geschäften nachging, wie es bei Tiberius lange Zeit der Fall gewesen war, hatte keine Chance, als ein „guter“ Kaiser zu gelten.
Jedoch bestand das römische Volk nicht allein aus der Plebs. Andere gesellschaftliche Gruppen hatten wiederum andere Vorstellungen und Wünsche, die der Princeps nicht ignorieren konnte, wollte er bei ihnen nicht an Rückhalt und Sympathie verlieren. Das römische Principat war, jedenfalls in seiner Anfangszeit, keine institutionalisierte Herrschaftsform, innerhalb derer die Herrschaftsträger davon ausgehen konnten, einfach kraft des Amtes Legitimität und Akzeptanz zu genießen. Das lag an den besonderen Bedingungen der Entstehung des Principats. Es beruhte am Anfang ganz auf den persönlichen Leistungen und Qualitäten des Augustus. Das von ihm verfolgte Konzept der Bildung einer herrscherlichen, der iulisch-claudischen Dynastie hatte den Zweck, seine Autorität und seinen Einfluss auf die Nachfolger zu übertragen. Im Laufe der Zeit gewann das Amt mehr und mehr an Bedeutung. Doch wenn ein Kaiser allzu massiv gegen die Regeln im Umgang zwischen Herrscher und den sozialen Partnern verstieß, wie es signifikant bei Caligula der Fall war, schützte das Amt nicht vor massiven Gegenaktionen.
Die Plebs war wichtig für die Stimmung im Staat. Diesen Umstand hat Tacitus hervorgehoben, wenn er Tiberius die Worte in den Mund legt: Die normalen Menschen können so planen, wie sie es für richtig halten. Bei den Kaisern ist dies anders: „Sie müssen ihre wichtigsten Entscheidungen nach der öffentlichen Meinung ausrichten.“2 Wenn das Volk nicht zufrieden war und seinen Unmut etwa im Theater lautstark artikulierte, hatte der Kaiser ein Problem. Nicht, dass ihn das Volk hätte stürzen können, |40|aber für eine Atmosphäre, die die Herrschaft insgesamt beeinträchtigte, konnte die Plebs rasch sorgen.
Von großer Bedeutung war es für den Princeps auch, wie das Beispiel Tacitus zeigt, den Senatoren als der politischen Elite das Gefühl zu geben, noch gebraucht zu werden. Ein Faktor, mit denen ein Herrscher, der sorgenfrei zu regieren beabsichtigte, immer rechnen musste, waren ferner die Ritter. Bei diesem Begriff sollte man sich assoziativ von mittelalterlichen Konnotationen freihalten. Die römischen Ritter hießen ursprünglich so, weil sie genug Geld hatten, um sich beim Militärdienst ein eigenes Pferd leisten zu können. In den Zeiten der Republik hatten sie sich als führende Exponenten von Wirtschaft und Handel etabliert, deutlich separiert von der durch die Senatoren verkörperten politischen Elite. In der frühen Kaiserzeit wurden sie zur wichtigsten administrativen Stütze der kaiserlichen Herrschaft. Gerne wurden sie von den Herrschern als Statthalter, militärische Kommandeure oder auch als Leiter der sich sukzessive ausbildenden kaiserlichen Kanzleien eingesetzt.
Der wichtigste Partner eines jeden Kaisers aber waren die Soldaten. Sie waren im existenziellen Sinn die Stütze seiner Herrschaft. Auf ihre Loyalität musste der Herrscher bauen können, sonst stand ihm eine unruhige Regierungszeit bevor. Nicht zu Unrecht hat man das System des Principats, das Augustus so geschickt und überzeugend zu einer wiederhergestellten Republik erklärt hatte und das er als eine Ära des Friedens propagierte, als eine Militärdiktatur oder eine Militärmonarchie bezeichnet. Das Heer wollte Fürsorge, Geld und materielle Sicherheit auch nach der aktiven Dienstzeit. Wer dies als Kaiser garantieren konnte, durfte sich vieles leisten und auf eine relativ ruhige Herrschaft freuen.
Der Reichsbevölkerung, die im großen Imperium der Römer versammelt war, musste der Kaiser ebenfalls seine Fürsorge widmen. Die meisten kannten ihn zwar nur von den Statuen, den Bildern auf den Münzen, und von den Edikten, die von Rom aus in die weite römische Welt gesandt wurden. Nützlich waren Reisen, auf denen der Herrscher demonstrieren konnte, dass ihm das Wohl der Bewohner des Reiches am Herzen lag.
Neros Vorgänger waren unterschiedlich erfolgreich in ihren Bestrebungen, den Erwartungen der Plebs und der anderen relevanten gesellschaftlichen Gruppen zu entsprechen. Augustus, der Architekt des Systems, war ein Meister der Inszenierung von Macht und Herrschaft gewesen. Er gab sich als leutseliger, umgänglicher Herrscher, wusste aber auch genau jenes |41|Maß an Distanz zu wahren, das ihm die nötige Autorität verlieh. Die Senatoren hatten keinen Anlass zur Klage. Der Princeps gab ihnen, im Gegensatz zu seinem Adoptivvater Caesar, das Gefühl, auf ihre Meinung Wert zu legen. Den Rittern bot sich genug Gelegenheit, Geschäfte zu machen, den Soldaten, lukrative Kriegszüge zu unternehmen. Bei der Reichsbevölkerung sammelte der Kaiser vor allem dadurch Pluspunkte, dass er ihnen die Überzeugung vermittelte, nach langen Jahrzehnten der Bürgerkriege wieder in sicheren und geordneten Verhältnissen zu leben.
Sein Nachfolger Tiberius war weniger erfolgreich, auch deswegen, weil er im Gegensatz zu Augustus nicht über das Talent verfügte, seiner an sich soliden Herrschaft durch Propaganda und Inszenierung Glanz zu verleihen. Auch hatte er darunter zu leiden, dass sein direkter Vorgänger ein politisches Schwergewicht gewesen war. Sein Kardinalfehler bestand darin, dass er nicht über die Fähigkeiten des Augustus zur Kommunikation verfügte. Indem er die letzten elf Regierungsjahre abgeschieden im selbst gewählten Refugium auf der Insel Capri verbrachte, verstieß er gegen das eherne Gesetz, dass der Patron für seine Klientel immer erreichbar sein müsse. So aber mussten die Menschen in Rom ganz auf ihren Princeps verzichten, was ebenso zu dessen negativem Renommee beitrug wie der mangelnde Respekt für die zurückgebliebenen Senatoren.
Caligula, der Sohn des überaus populären Feldherrn Germanicus, mit 27 Jahren an die Macht gekommen, war vordergründig der personifizierte Verstoß gegen alles, was Augustus an sensiblen Instrumenten zur Herstellung einer allgemein akzeptierten Herrschaft entwickelt hatte. Seine zahlreichen Eskapaden haben Eingang in jedes historische Kuriositätenkabinett gefunden, vor allem die scheinbar sinnlose Aktion, wie er nach dem Tod eines Konsuls sein Pferd Incitatus zum Nachfolger machte. Caligula wird auch gerne als eine Erstausgabe von Nero gesehen und wie dieser mit Etiketten wie Despot und Tyrann ausgestattet. Ebenso wurde ihm, allerdings früher mehr als heute, Wahnsinn als Grundlage seiner Handlungen attestiert. Zugleich fehlt es nicht an Versuchen, Caligula zu rehabilitieren und in seinem Verhalten Methodik zu sehen – in der Form der bewussten Entlarvung des Principats als eines monarchischen Systems. Er wollte zeigen, was er sich als Kaiser alles leisten konnte. Nicht so viel, wie er glaubte, wird man rückblickend urteilen müssen: Caligula war der erste Kaiser, der ermordet wurde. Das Attentat war die konzertierte Aktion von Hofleuten |42|und den Prätorianern, die eigentlich die Aufgabe hatten, sein Leben zu schützen.
Neros unmittelbarer Vorgänger war Claudius. Als er im Jahre 41 Kaiser wurde, war Nero vier Jahre alt – zu jung, um bewusst zu erleben, auf welch ungewöhnliche Weise der Onkel Caligulas an die Macht gekommen war. Es waren die Prätorianer, die ihn nach der Ermordung seines Neffen Caligula zum Imperator ausriefen. Claudius galt, auch, weil er sich gerne mit Geschichte beschäftigte, als weltfremder Sonderling, nicht geeignet für die praktische Politik. Doch die Hoffnung der Prätorianer, in Claudius ein willfähriges Instrument für ihre eigenen Interessen zu finden, erfüllte sich nicht. In den dreizehn Jahren seiner Herrschaft präsentierte sich Claudius erfolgreicher, als es die negativen Beurteilungen in der senatorisch geprägten Geschichtsschreibung, allen voran der meinungsbildende Tacitus, glauben machen wollen. Seine Leistungsbilanz enthielt, neben der teilweisen Eroberung Britanniens, zukunftsweisende Reformen in der organisatorischen Gestaltung der Reichszentrale in Rom.
So hatten Neros Vorgänger dem fünften Kaiser aus der iulisch-claudischen Dynastie sehr unterschiedliche Angebote hinterlassen, wie man das Amt des Princeps interpretieren und ausüben konnte. Welchen Weg würde er einschlagen? Den des Augustus, der es gekonnt verstanden hatte, allen gesellschaftlichen Gruppen den Eindruck zu vermitteln, Garant für Ruhe und Ordnung im Staat zu sein, der darüber hinaus sowohl als Kriegs- als auch als Friedenskaiser in die Geschichte eingegangen war und der sich als Meister der politischen Propaganda und der politischen Inszenierung erwiesen hatte? Den des Tiberius, der sich anfangs redlich bemühte, dem Vorbild des Augustus zu folgen, jedoch nicht über dessen Begabung verfügte und schließlich die Öffentlichkeit mied? Den des Caligula, der die von Augustus im Principat installierten Sicherungssysteme bewusst ignorierte, um zu zeigen, was der Kaiser eigentlich alles darf? Den des Claudius, der sich redlich und erfolgreicher, als ihm bis heute attestiert wird, darum bemühte, Rom und das Römische Reich voranzubringen?
Oder ging Nero einen eigenen Weg?