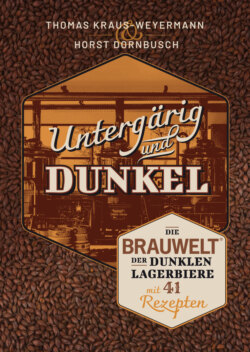Читать книгу Untergärig und Dunkel - Horst Dornbusch - Страница 27
Das Ende des Bieres im Nahen Osten — und dessen Neugeburt in Mitteleuropa
ОглавлениеMit dem Aufkommen der weintrinkenden griechischen und römischen Zivilisationen in der Antike wurde der Nahe Osten schließlich von einer Eroberungswelle nach der anderen überrannt, was dort zu einem drastischen Rückgang des Bierbrauens führte. Zuerst kamen die oben erwähnten Griechen im Jahre 331 v. Chr. unter Alexander. Danach kamen die Römer im Jahre 30 v. Chr. unter Octavian, was zum Ende des ägyptischen Reiches unter Kleopatra führte. Mit der Oberherrschaft der Römer wurde ein Großteil des ägyptischen Getreides entlang den Ufern des Nils statt zu Bier, entlang den Ufern des Tibers zu Brot verarbeitet. Im 7. Jahrhundert n. Chr. war es dann im Zuge der arabischen Eroberung des Nahen Ostens und Nordafrikas mit der dortigen Alkoholproduktion komplett vorbei. Die islamische Herrschaft weitete sich von der arabischen Halbinsel über Damaskus (634) auf Jerusalem (638), Ägypten (642) sowie Mesopotamien und Persien (651) aus. Im Jahre 711 landeten die Araber sogar per Schiff in der Bucht von Algeciras im Süden der Iberischen Halbinsel. Erst im Jahre 732 gelang es dem fränkischen Hausmeier Karl Martell, die islamische Expansion in der Schlacht von Tours und Poitiers, in der Nähe des heutigen Moussais-la-Bataille, einem kleinen Dorf in Aquitaine, in Frankreich, zu stoppen. Mit seinem Sieg bewahrte Karl Martell nicht nur den Westen vor der arabischen Herrschaft, sondern er rettete auch ganz nebenbei das europäische Bier – denn der Koran befiehlt, dass heilige Krieger keinen Alkohol trinken!
Diese keltische Bieramphore von etwa 800 v. Chr. ist der älteste uns bekannte Nachweis von Bierherstellung in Mitteleuropa.
Während die Bierherstellung in den Ländern rund um das Mittelmeer nach der Blütezeit der sumerischen und ägyptischen Kulturen zurückging, fasste sie bei den keltischen und germanischen Stämmen in Mitteleuropas richtig Fuß. Es ist nicht exakt belegt, wie das Wissen der Bierherstellung vom Nahen Osten nach Norden vordrang oder ob es sich dort autonom entwickelte, jedoch ist der Fund einer Amphore aus der Zeit um 800 v. Chr. der älteste uns bekannte Nachweis von Bierbrauen in Kontinentaleuropa. Dieses Gefäß wurde 1935 im Grabhügel eines keltischen Häuptlings aus der Hallstatt-Kultur in der Nähe des fränkischen Dorfes Kasendorf, knapp 15 km von Kulmbach, entdeckt. Die organischen Ablagerungen in diesem Artefakt wurden seitdem als Rückstände eines mit Eichenblättern gewürzten Weizenbieres identifiziert. Man kann die Amphore heute im Kulmbacher Biermuseum bewundern.
In den germanischen und keltischen Stammeskulturen Europas jener Zeit hat Bier anscheinend genau wie bei den alten Sumerern und Ägyptern eine große gesellschaftliche Rolle gespielt. Dies belegt zum Beispiel der römische Senator und Historiker Publius Gaius Cornelius Tacitus in seinem Buch, De origine et situ Germanorum (Über die Herkunft und das Gebiet der Germanen), welches er um 98 n. Chr. fertig stellte. Darin berichtet Tacitus sarkastisch, dass die germanischen Stämme ein alkoholisches Getränk aus Gerste tranken, welches einem „korrumpierten“ (wohl infizierten, verdorbenen) Wein ähnelte (Potui umor ex hordeo aut frumento). Auch erzählt er uns, dass Durst für Germanen unerträglich war (Adversus sitim non eadem temperantia). Wenn man ihnen daher erlaubte, sich betrunken zu saufen, konnte man sie sogar mit Hilfe ihres eigenen Lasters leichter besiegen als mit feindlichen Waffen (Si indulseris ebrietati suggerendo quantum concupiscunt, haud minus facile vitiis quam armis vincentur).
Jedoch scheinen sich die Römer irgendwann trotzdem mit dem „korrumpierten“ germanischen Getreidegetränk angefreundet zu haben. Der Beweis dafür ist eine Ausgrabung einer römischen (ja, einer römischen!) Brauerei in Regensburg nur wenige hundert Meter vom Donauufer entfernt. Die Überreste dieses römischen „Gewerbegebäudes“ – so lautete die anfängliche Interpretation dieser Anlage – wurden 1983 entdeckt. Dessen Konstruktion geht auf das Jahr 179 n. Chr. zurück, als Regensburg noch Castra Regina hieß und ein Außenposten des Römischen Reiches war. Dort hausten damals etwa 6000 durstige Legionäre sowie eine etwa gleiche Anzahl von germanischen und keltischen Handwerkern, Dienern, Sklaven und Huren. Ursprünglich war die Funktion dieses Gebäudes den Archäologen ein Rätsel. Unter den merkwürdigen Elementen dieses Baus waren ein tiefer Brunnen sowie zwei quadratische Versenkungen im Boden (siehe Bildmitte) welche inzwischen als Malz-Weichewanne und als Darre identifiziert wurden. Die Darre hatte offenbar einen Holzboden, der indirekt durch einen Schacht (hypocaustum auf Latein) mit Heißluft aus einer Feuerstelle (praefurnium) beheizt wurde. Über einer weiteren Feuerstelle hing offenbar eine Sudpfanne aus Metall. Die Sudpfanne existiert nicht mehr, da das Metall wohl irgendwann für andere Gegenstände eingeschmolzen und wiederverwertet wurde.
Diese Rekonstruktionen einer direkt befeuerten mittelalterlichen Sudpfanne und eines hölzernen Läuterbottichs wurden von der Weyermann® Malzfabrik in Bamberg speziell für die Experimente der Autoren in Auftrag gegeben.
Diese Ausgrabung eines römischen „Gewerbegebäudes“ am Ufer der Donau in Regensburg stammt aus dem Jahr 179 n. Chr. zur Zeit des Kaisers Marcus Aurelius. Dieses Gebäude gilt heute als die älteste uns bekannte, „moderne“ Brauerei der Welt. Sie hat einen tiefen Brunnen, ein Weichbecken zum Keimen von Getreide, eine Darre zum Trocknen des Grünmalzes und eine Feuerstelle für eine Sudpfanne.
Wenn die Interpretation dieses römischen Gewerbegebäudes in Regensburg als Brauerei korrekt ist, so enthält es die älteste uns bekannte Malzdarre der Welt. Das heißt auch, dass das dort produzierte Malz hell war, da die Darre indirekt von unten beheizt wurde! Diese Besonderheit macht die Römerdarre supermodern, denn, wie wir im Weiteren sehen werden, wurden Darren erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts wieder indirekt beheizt. Es bedurfte der Industriellen Revolution und der Erfindung der pneumatischen Malztechnologie, bevor indirekt beheizte Darren ein Comeback in der Moderne feiern konnten!