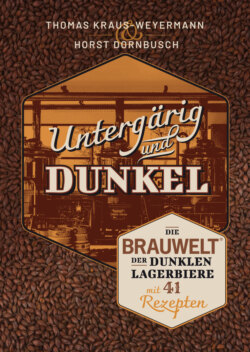Читать книгу Untergärig und Dunkel - Horst Dornbusch - Страница 28
Wie Dunkelheit (und Rauchgeschmack) ins Bier kamen
ОглавлениеKurz und bündig: Malz – und damit auch Bier – wurde erst dunkel, als die Menschen anfingen, mit direkt statt indirekt befeuerten Darren ihr gekeimtes Getreide zu trocknen. Warum? Wahrscheinlich, weil die Römerdarren mit ihrem einfachen Heißlufttrocknen, aus welchem nur helle Malze hervorgehen konnten, durch effizientere Darren ersetzt wurden. Die Lufttrocknung von Malz hielt sich jedoch zum Teil bis ins späte Mittelalter im Freien oder auf einer gut belüfteten Dachboden-Tenne, wo die keimenden Kerne in einer Schicht ausgebreitet und befeuchtet wurden. Das Malz musste dann tagelang von Hand gewendet werden, bis es endlich trocken war. Das ständige manuelle Umschaufeln des Malzes war notwendig, um das Trocknen zu vereinheitlichen, Wärme abzuleiten und zu verhindern, dass das Malz verfaulte oder verschimmelte. Diese Prozedur ist natürlich langsam, arbeitsintensiv und auch entsprechend teuer.
Wir wissen nicht, wer zuerst auf die Idee kam, eine schneller arbeitende, direkt befeuerte Darre zu bauen, jedoch ist bekannt, dass solche Darren zumindest seit dem 9. Jahrhundert in den fortschrittlichsten Klosterbrauereien jener Zeit gang und gäbe waren. Der Beweis dafür ist eine Architekturzeichnung von etwa 830. Sie zeigt den Grundriss der Benediktinerabtei St. Gallen in der nördlichen Schweiz, etwa 50 km südöstlich vom Bodensee, welche im Hochmittelalter als die prächtigste Abtei in ganz Europa galt. Wir wissen aus einem Kompendium mit dem Titel Casus Sancti Galli (Die Ereignisse von St. Gallen), dessen Hauptautor der Abt Ekkehard IV (ca. 980 bis ca. 1056) war, dass in der Abtei etwa 150 Mönche sowie Dutzende von Laien und Schülern wohnten. Auch beherbergte die Abtei einen ständigen Strom von Pilgern auf dem Weg nach Rom.
Auf dem Plan der Abtei sind drei separate Brauereien verzeichnet. In der ersten Brauerei stellten die Benediktiner ein Starkbier namens Celia aus Weizen- und Gerstenmalz her, welches ausschließlich für den Abt und dessen Besucher von hohem Rang reserviert war. In der zweiten Brauerei wurde Cervisa gebraut, ein Bier für die gewöhnlichen Mönche, die diesen Gerstensaft in Riesenmengen von morgens bis abends konsumierten. Letztlich produzierte die dritte Brauerei Conventus, ein Dünnbier, welches aus Hafer und den Nachgüssen der Celia- und Cervisa-Maischen hergestellt und dann an die Laienarbeiter und Leibeigenen des Klosters sowie an Bettler ausgeschenkt wurde. Der Klosterplan weist auch Skizzen eines Getreidespeichers (granarium) und einer Stelle „für das Rösten von Getreide / Mörser / [und] Mühlen“ (ad torrendas annonas / pilae / molae) auf. Im Getreidespeicher droschen die St. Gallener Pater das Getreide, befeuchteten es bis es spross. Dann darrten, schroteten und maischten sie es. Die Sudpfannen waren alle direkt befeuert. Sie waren über runde, gemauerte Feuerstellen montiert, deren Wände aus einem mit Lehm verputzten Weidengeflecht bestanden. Die Rauchabzüge der Sudpfannen-Feuerstellen wurden entweder ins Freie oder durch die Darre, in der das Malz getrocknet wurde, geleitet. Mit anderen Worten, das in St. Gallen verwendete Malz wurde direkt mit Hilfe heißer Verbrennungsgase getrocknet. Das fertige Malz war daher meistens etwas dunkel, manchmal sogar leicht angeröstet und definitiv auch rauchig und phenolisch im Geschmack. Ungefähr eintausend Jahre lang gehörten solche direkt befeuerten Darren zur Standardausstattung aller Mälzereien, nicht nur auf dem europäischen Kontinent, sondern auch auf den britischen Inseln, wie wir aus einem anglo-normannischen Gedicht aus der Mitte des 13. Jahrhunderts mit dem Titel Le Tretiz (Die Abhandlung) von Walter von Bibbesworth entnehmen können. In diesem Gedicht bezieht sich der Autor u.a. auf getrocknetes Malz aus direkt befeuerten Darren. Bibbesworth bezeichnet diese Darren mit dem altfranzösischen Wort torrail, was vom lateinischen torrere abgeleitet ist und etwa „braten“ oder „rösten“ bedeutet.
Diese Architekturzeichnung zeigt, wie das Kloster St. Gallen im 9. Jahrhundert n. Chr. möglicherweise aussah. In diesem Kloster gab es drei Brauereien, in denen die Mönche Bier mit dunklem, rauchigem Malz herstellten.
Viele spätere Quellen über das britische Mälzen und Brauen belegen, dass solche „torrail“-Darren aus perforierten Siebböden bestanden, auf denen das Getreide über offenen Flammen lag. Diese Darren verrichteten ihren Zweck schnell und effektiv; aber alle Malze, die mit dieser Methode hergestellt wurden, waren relativ inhomogen, wobei einige Körner „untergemälzt“ und hell, andere perfekt verarbeitet und wieder andere mit Sicherheit bräunlich, versengt oder gar schwarz waren. Die Farbe eines aus solchem Malz hergestellten Bieres war daher immer eine Schattierung von Braun oder dunkler. Der Geschmack war oft brenzlig und bitter, denn er spiegelte den in der Darre verwendeten Brennstoff wider – von verschiedenen Holzarten über Holzkohle, Stroh, Torf und in späteren Jahren auch Kohle und Koks.