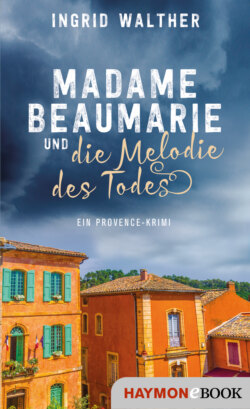Читать книгу Madame Beaumarie und die Melodie des Todes - Ingrid Walther - Страница 12
Passacaglia 8
ОглавлениеFlorence hatte kurz, aber gut geschlafen. Keine Träume! Bestens! Schon um sechs Uhr morgens war sie wieder aus den Federn. Die ideale Gelegenheit, um bei einem Morgenspaziergang Klarheit in ihre Gedanken zu bringen und einen guten Kaffee zu trinken. Um diese Stunde konnte man auch an Orte gehen, an denen man sonst vermutlich von Touristenmassen erdrückt wurde. Also auf zur „Brücke von Avignon“! Auf dem Weg dorthin summte sie die Melodie, die ihr Sohn im Alter von drei Jahren immer wieder hatte hören wollen: „Sur le pont d’Avignon, on y danse, on y danse …“
Wie konnte sie nach all dem, was gestern vorgefallen war, heute so gut gelaunt sein? Natürlich wusste sie genau, warum. Die stillen Straßen, die Frische des Morgens, die Stadt, die sie fast für sich alleine hatte, all das trug zu ihrer Hochstimmung bei. Aber es kam noch etwas anderes hinzu. Seit den Vorfällen des Vortages war ihr klar, auf welche Weise sie ihre Zeit hier nun verbringen würde. Den Reiseführer von Michelin, den ihr ein Kollege zum Abschied geschenkt hatte, würde sie nur mehr selten in die Hand nehmen. In die nunmehr von dieser Madame Petermann dirigierten Konzerte würde sie natürlich gehen. Schließlich hatte sie sich so darauf gefreut, zwei Wochen lang in barocken Klängen schwelgen zu können. Irgendwann würde sie auch den Papstpalast besichtigen. Ansonsten aber würde sie den Spuren eines kriminalistischen Rätsels folgen, ohne offiziellen Auftrag und nur zu ihrem eigenen Vergnügen. Denn das war es, was sie seit ihrer Kindheit am meisten faszinierte.
Sie war höchstens zehn Jahre alt gewesen, als sie bei einem der Bouquinisten an der Seine einen Roman von Georges Simenon entdeckt und dort so lange darin geblättert hatte, bis der Buchhändler ihn ihr schenkte. Daraufhin war sie seine Stammkundin geworden und hatte bald darauf Bekanntschaft mit den Romanen von Edgar Allan Poe und Dorothy Sayers gemacht. Erst als sie älter wurde, hatte sie sich manchmal gefragt, ob es denn moralisch angemessen sei, sich ausgerechnet bei der Beschäftigung mit Mord und Totschlag so lebendig zu fühlen. Durfte man denn an etwas, das so viel menschliches Leid verursachte, Gefallen finden? Mit Honoré Mordent, ihrem ersten Chef und Förderer, hatte sie sich oft über dieses Thema unterhalten – und war mit sich ins Reine gekommen. Diese Tätigkeit war genau das, wofür die Natur sie ausgestattet hatte. Ihr großartiges Gedächtnis, ihre Freude am Kombinieren, ihre Ausdauer, ihre Intuition und nicht zuletzt ihr Sinn für Gerechtigkeit hatten sie für einen Beruf prädestiniert, der einem Mädchen ihrer Generation zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht zugänglich gewesen war – schon gar nicht einem, das früh ohne Vater dastand und dessen Mutter sich eine lange Ausbildung für die Tochter nicht leisten konnte. Eigentlich hätte sie ja den Blumenladen ihrer Mutter übernehmen sollen, aber als sie ohne Mühe und mit lauter Spitzennoten durch die Schuljahre brauste, stand für diese fest, dass die Tochter für einen gehobenen Büroberuf in Frage käme. Da hatte Florence aber schon genau gewusst, was sie wollte, hatte mehrere Polizeikommissariate der Stadt nach einer Stelle abgeklappert, war schließlich in „ihrem“ Kommissariat fündig und dort bald Sekretärin des Chefs geworden.
An ihrem Arbeitsplatz waren Florence die unaufgeklärten Verbrechen wie reife Pflaumen in den Schoß gefallen und ihre auf raffinierte Weise platzierten Hinweise hatten anfangs vor allem die Karriere so manches Kollegen befördert, der sonst in den Niederungen des einfachen Streifendienstes hängen geblieben wäre. Ihr Chef, dem sie bis zum heutigen Tag verbunden geblieben war, hatte ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten bald erkannt und sie in die Aufklärung sämtlicher Mordfälle in seinem Arrondissement einbezogen. Das war gegen Ende der Sechzigerjahre gewesen, zu einer Zeit, zu der für Frauen eine Karriere im Polizeidienst nicht vorgesehen war. Erst im Laufe der Siebzigerjahre hatte sich der gehobene Polizeidienst für Frauen zu öffnen begonnen. Zu dieser Zeit war Florence Beaumarie in ihrer Dienststelle als unverzichtbare Mitarbeiterin schon so verankert gewesen, dass niemand – auch nicht sie selbst – an eine langwierige offizielle Ausbildung für sie dachte. Schließlich hatte sie es sogar zu einer gewissen landesweiten Berühmtheit gebracht. Als der entscheidende Hinweis zur Aufklärung eines besonders spektakulären Mordfalles wieder einmal von ihr kam, hatte Honoré Mordent dies einer Journalistin gegenüber erwähnt und diese hatte ihr einen eigenen Zeitungsartikel gewidmet. Ihre Sonderstellung inmitten eines hierarchisch geordneten Polizeiapparates war ab da auch den höheren Stellen bekannt und von diesen toleriert. Wie viele Frauen ihrer Generation hatte sie sich dabei mit ihrem Gehalt als Sekretärin abgefunden. Sie war nie verheiratet, aber eine recht beachtliche Erbschaft, die überraschend vom früh verstorbenen Vater ihres Sohnes kam und die sie klug verwaltete, sicherte ihr schließlich ihre persönliche Unabhängigkeit. Es war ihr privates Vergnügen, jeden Fall, an dem sie mitgearbeitet hatte, in einem eigenen Schreibheft der Marke Clairefontaine zu dokumentieren, einem grünen für aufgeklärte Fälle und einem roten für die ganz wenigen unaufgeklärten.
Mittlerweile hatte sie den Pont Saint-Benezet erreicht und auf ihrem Weg festgestellt, dass um diese Zeit noch alle Cafés geschlossen waren. Im Gegensatz zu Paris, wo man bereits frühmorgens überall Kaffee bekam, hatte man sich hier offensichtlich den später aufstehenden Touristen angepasst.
Mit dem Eingang zur Brücke von Avignon verhielt es sich genauso. Das Tor war geschlossen und außerdem war die Brücke nur gegen Eintritt zu besichtigen. Die als Touristin recht unerfahrene Florence schüttelte den Kopf. Sie brauchte einen Platz zum Nachdenken. Den ganzen Weg hierher war sie von der Vorstellung beflügelt gewesen, sich auf der berühmten Brücke den Morgenwind um die Nase wehen und dabei ihren Gedanken freien Lauf lassen zu können. Das konnte sie nun vergessen! Sie überquerte die breite Autostraße, die am Ufer der Rhône entlangführte. Das Gras auf dem grünen Uferstreifen war noch nass und eine unbändige Lust, barfuß zu laufen, ergriff sie. Mit den Schuhen in der Hand spazierte sie den Fluss entlang, fasziniert vom Anblick der monumentalen Steinbrücke, die mitten im Fluss zu Ende war. Währenddessen machte ihr Gehirn einen Plan für den kommenden Tag. Als sie ihre Schuhe wieder anzog, wusste sie, was ihre nächsten Schritte sein würden. Am Weg zurück in die Stadt sah sie, dass das kleine Café du Pont geöffnet hatte. Endlich bekam sie einen ordentlichen Espresso. Dazu ein Croissant – und dann gleich noch ein zweiter Espresso! Wie immer bestellte sie ihn mit einem Milchkännchen.
Madame Robert würde keine Freude haben, wenn sie nicht zum Frühstück erschien. Aber sie würde sie am Nachmittag aufsuchen und ihr das eine oder andere erzählen. Als alteingesessene Bewohnerin von Avignon war sie möglicherweise sogar eine brauchbare Informationsquelle.
Eine halbe Stunde später betrat Florence das Polizeikommissariat von Avignon, das außerhalb der alten Stadtmauer lag. Ah, dieser vertraute Geruch! Eine Mischung aus Schweiß, chemischen Reinigungsmitteln, Kaffee und Tabak. Über drei Stufen gelangte man zu einem dreiflügeligen Glasportal und dann in eine Vorhalle, in der es neben ein paar Stühlen und einer Anschlagtafel auch eine unbesetzte Portiersloge gab. Ein uniformierter Beamter wies ihr den Weg zu einem Dienstzimmer, in dem mehrere Polizisten an ihren Schreibtischen saßen. Eine weibliche Bedienstete sprach sie sofort an.
„Können wir etwas für Sie tun, Madame?“
Ein weiterer Beamter kam ihrer Antwort zuvor.
„Oh, Madame Florence Beaumarie höchstpersönlich, wir haben Sie schon erwartet. Kommen Sie, ich bringe Sie zu unserem Chef!“ Auf einmal waren die Blicke sämtlicher Anwesender auf sie gerichtet und der Sprecher – es war natürlich Chantals Bekannter Pierre – führte sie durch den lang gestreckten, hellen Dienstraum und den daran anschließenden dunklen Gang. Dann klopfte er an eine Tür und öffnete sie, ohne eine Aufforderung einzutreten abzuwarten.
Mit allem hatte Florence gerechnet, aber nicht damit, hier, siebenhundert Kilometer von Paris entfernt, ein vertrautes Gesicht zu erblicken. Obwohl er nicht in Uniform war und zu langen schwarzen Hosen ein hellblaues Hemd trug, erkannte sie ihn auf den allerersten Blick. „Spürnase“, so hatten ihn in ihrer Pariser Dienststelle alle genannt. Seine auffallend große, leicht gebogene und recht spitze Nase saß in einem durchaus ansehnlichen Gesicht: große blaue Augen, schön gezeichnete Augenbrauen, hohe Wangenknochen und ein wohldimensionierter, aber immer ein wenig skeptisch zusammengezogener Mund.
Kommissar Antoine Lambert hatte seinen Erfolg weniger seiner Kombinationsgabe als seinem ausgeprägten Sinn für Skepsis zu verdanken. Immer wenn seine Kollegen alles schon ganz genau zu wissen glaubten, hatte er seine Lippen zusammengepresst, seinen Kopf geschüttelt, auf seine Nase gedeutet und gemeint: „Meine Nase sagt mir, dass da noch etwas anderes dahintersteckt!“ Mit der Zeit hatten alle gelernt, dieser Nase zu vertrauen. Florence war seine Verbündete geworden, die ihm half, die Kollegen davon zu überzeugen, dass auch ein bereits geschlossener Aktendeckel noch einmal geöffnet werden musste.
„Meine Nase sagt mir, dass er dennoch nicht der Täter sein kann“, sagte er nun zu Florence, die ihm an seinem Schreibtisch gegenübersaß. Eingangs hatte er ihr erklärt, dass er bereits seit gestern von seinem Mitarbeiter Pierre Caspari wisse, dass sich Madame Florence Beaumarie in Avignon und noch dazu direkt am Ort des Geschehens aufhalte. Durch die Zeitungsberichte über sie sei sie auch hier im Süden keine ganz Unbekannte und er selbst habe schon des Öfteren seinen Leuten die von ihr gelösten Fälle als lehrreiche Beispiele präsentiert. So wie er sie kannte, war er sich sicher gewesen, dass sie von selbst hier auftauchen werde, und voilà, da war sie auch schon, und noch dazu zu einer so frühen Stunde.
„Wer bitte soll nicht der Täter sein?“ Florence fühlte sich, als wären die mehr als fünfzehn Jahre, vor denen Lambert der Liebe folgend in den Süden gezogen war, wie ausgelöscht.
„Nun, Monsieur Amontero natürlich, der berühmte Pianist. Es war mir äußerst unangenehm, ihn noch in der vergangenen Nacht in Gewahrsam nehmen zu müssen.“ Er gähnte.
„Er ist hier?“ Florence staunte und die Spürnase nickte.
„Es ist uns nichts anderes übriggeblieben. Er hat gestern am Abend Madame Lemercier nach Hause gebracht, ist aber gegen zweiundzwanzig Uhr noch einmal am Tatort erschienen. Ich war selbst noch dort. Amontero war auf der Suche nach einer Stofftasche mit Musiknoten, von der er vermutete, dass er sie vergessen hatte. Die Tasche war schnell gefunden. Sie lehnte an der Wand der Garderobe im Vorraum zur Sakristei. In der Tasche befanden sich die Noten eines Stücks von Chopin, das Amontero nach eigener Aussage zur Vorbereitung für sein nächstes Konzert dringend benötigte, sowie ein altes Notenblatt eines Komponisten namens Marin Marais. Er behauptete, dieses Blatt sei erst zu Mittag von einem Unbekannten zusammen mit einer kurzen Notiz in einem Kuvert an der Rezeption seines Hotels abgegeben worden. Der Schreiber der Notiz forderte ihn auf, dieses Blatt noch vor dem Konzert an Lemercier zu übergeben. Würde er dieser Anweisung nicht folgen, drohe ihm der Tod. Das war aber nur ein Teil des mysteriösen Inhalts dieser Stofftasche, denn diese enthielt“ – Lambert machte eine kurze, die Spannung steigernde Pause – „außerdem noch die Tatwaffe.“
„Die Tatwaffe?“ Florence blieb der Mund offenstehen und Kommissar Lambert nickte triumphierend.
„Allerdings. Wenigstens eine davon. Nämlich die Saite eines Streichinstruments, und zwar eines Cellos. Das wurde uns von einem Experten bereits bestätigt.“
Lambert lehnte sich weiter nach vorne und senkte seine Stimme: „Sie wissen, Florence, dass ich Ihnen das alles nicht erzählen darf, aber ich hoffe, dass Sie ein Geheimnis immer noch so gut für sich behalten können wie damals, in unserer Pariser Zeit.“
„Natürlich können Sie sich darauf verlassen, Antoine. Sie kennen mich.“ Auch Florence hatte sich nach vorne gebeugt und war zu dem vertrauten Ton zurückgekehrt, den sie früher gepflegt hatten.
„Gut, meine Liebe. Ich hätte nämlich nichts dagegen, wenn Sie auf Ihre bewährte Weise noch ein wenig hinter den Kulissen herumschnüffelten. Ich persönlich glaube Amontero, aber entlastet ist er natürlich nicht! Wie Sie meinen Kollegen gestern mitgeteilt haben, besitzen Sie ja einen Festivalpass und planen, sämtliche Konzerte zu besuchen.“
Florence nickte und der Kommissar erhob sich. „Kommen Sie, Florence! Wir machen besser noch einen kleinen Spaziergang und dann“ – noch einmal senkte er seine Stimme – „erzähle ich Ihnen alles, was wir bisher wissen.“
Er drehte sich um, nahm ein dunkelblaues Sakko von der Sessellehne und warf es sich schwungvoll über die Schultern.
„Das Leben im Süden steht ihm nicht schlecht, er ist eleganter und selbstbewusster geworden“, dachte Florence ihm in Richtung Ausgang folgend.
„Ich bin in einer Stunde wieder zurück“, rief er seinen Mitarbeitern zu, und kurz darauf überquerten sie schon den breiten Boulevard und befanden sich gleich darauf innerhalb der Stadtmauern von Avignon. Der Kommissar schlug vor, ein Stück zu gehen und ein Café aufzusuchen, von dem er annehmen konnte, dass sie dort unbehelligt bleiben würden. Schon auf dem Weg begann er mit seiner Schilderung der Ereignisse des Vortages. Monsieur Lemercier war von Auguste Benoît, dem Pfarrer, tot aufgefunden worden. Dieser hatte vom Altarraum aus beobachtet, wie das Publikum aufgrund der langen Wartezeit immer unruhiger geworden war. Noch ehe die Konzertmeisterin aufstand und nach hinten kam, hatte sich Hochwürden Benoît entschlossen, selbst nach dem Dirigenten zu schauen. Er klopfte mehrmals an die Tür zur Sakristei, ahnte aber, dass dies erfolglos sein würde. Er wusste, dass Lemercier in seiner geheiligten Konzentrationspause vor dem Konzert Kopfhörer trug, die jedes Geräusch ausblendeten. Die Tür sperrte er zwar nie ab, aber exakt zwanzig Minuten vor Konzertbeginn hing das gewohnte und unübersehbare Schild mit der Aufschrift „Bitte nicht stören!“ am Türknauf.
Als der Pfarrer nach erfolglosem Klopfen die Tür einen Spalt öffnete, konnte er sofort erkennen, dass er sich am Schauplatz eines Verbrechens befand. Der Dirigent saß in dem hohen Lehnstuhl aus Leder und geschnitztem Holz, in dem sich schon Generationen von Geistlichen auf ihre Predigten eingestimmt hatten. Sein Kopf war merkwürdig zur Seite gerutscht, die Augen weit aufgerissen. In seiner Brust steckte ein Messer. Eines war vollkommen klar: Dem armen Mann war gewiss nicht mehr zu helfen. Warum der Pfarrer in der Folge so und nicht anders gehandelt hatte, wie er es dann tat, konnte er später nicht wirklich erklären. Wahrscheinlich sei er unter Schock gestanden, mutmaßte der Kommissar. Er habe vielleicht gehofft, sein Gotteshaus noch vor etwas schützen zu können, was bereits irreversibel als Urgewalt des Bösen über dieses hereingebrochen war.
Jedenfalls hatte Pfarrer Benoît die Tür zur Sakristei sofort wieder geschlossen, sich als Wache davorgestellt und den in der Nähe anwesenden Kirchendiener darum gebeten, umgehend einen der beiden anwesenden Polizisten zu holen. Der war binnen kürzester Zeit zur Stelle gewesen und auch dem genügte ein kurzer Blick durch den Türspalt, um das Ausmaß der Katastrophe zu erkennen. Gerade als er sein Handy zückte, um alles Nötige zu veranlassen, hatte Madame Petermann, die Konzertmeisterin, die Szene betreten. In diesem Augenblick entschied sich der Pfarrer zur Notlüge. Monsieur Lemercier sei ernsthaft erkrankt, erklärte er ihr, und derzeit nicht ansprechbar. Er werde das Konzert bestimmt nicht dirigieren können. Madame Petermann hatte sich bestürzt gezeigt, jedoch sofort erklärt, dass in diesem Fall sie selbst den Taktstock übernehmen werde. Schließlich könne man das Publikum nicht um ein Ereignis bringen, für das es bereits bezahlt hatte.
„Die Notlüge des Pfarrers wundert mich nicht wirklich“, sagte Florence etwas später zum Kommissar. „Er ist bestimmt nicht der Erste, der unmittelbar nach dem Einbruch einer Katastrophe so tut, als könne diese nicht geschehen sein.“
„Das stimmt schon, Florence, aber bei einem Pfarrer erstaunt es mich doch.“
Sie hatten inzwischen als einzige Gäste im Hinterzimmer eines kleinen, etwas schmuddeligen Café-Tabac Platz genommen. Von dort aus hatten sie einen guten Blick auf den Eingang und den Tresen, an welchem zwei Männer mit ihren Tageszeitungen lehnten. Ein etwas mürrischer Asiate hatte den Kaffee gebracht und sie konnten ihr Gespräch unbehelligt fortführen.
Antoine Lambert leerte seine Tasse Espresso mit einem Schluck. „Für uns war die Lüge des Geistlichen eigentlich ein Glücksfall. Sonst wäre es äußerst schwierig geworden, ohne größeren Aufruhr den Tatort zu sichern und unsere Vorgangsweise zu planen.“
Florence enthielt sich eines Kommentars. Dass die Öffentlichkeit bis zum nächsten Tag über die wahre Ursache des Todes im Unklaren gelassen worden war, war nicht korrekt, passte aber durchaus zu Antoine Lambert, der es bestimmt vorzog, mit seiner Spürnase noch eine Weile ungestört herumschnüffeln zu können. Am Weg hierher hatte er ihr allerdings verraten, dass er schon frühmorgens die Bürgermeisterin und die Staatsanwältin aus ihren Betten geholt und für Mittag eine gemeinsame Pressekonferenz anberaumt hatte.
„Wann waren denn Sie am Tatort, Antoine, wenn ich fragen darf?“
„Etwa zwölf Minuten nach der Entdeckung des Toten. Rascher ging es nicht. Der Anruf hat mich in einem Restaurant in der Altstadt erreicht, wo ich mit meiner Frau zu Abend gegessen habe. Ich bin gleich losgerannt, denn ich wusste, dass ich zu Fuß am schnellsten sein würde. Der Arzt war schon nach wenigen Minuten da. Er befand sich ganz in der Nähe und konnte nur mehr bestätigen, dass der Tod unmittelbar nach der Tat eingetreten sein musste.“
„Aber hatten Sie nicht zuvor gesagt, dass die Tatwaffe die Saite eines Streichinstruments gewesen ist?“
„Das ist ja das Interessante.“
„Seltsam“, murmelte Florence. „Das muss im Zusammenhang mit der Tat wohl eine symbolische Bedeutung haben. Aber sagen Sie, Antoine. Wie sind Sie so schnell darauf gekommen, dass es sich bei dem Draht um die Saite eines Cellos handelte?“
„Ehrlich gesagt, nicht gleich. Wer kommt schon auf so etwas? Erst als wir in der Tasche von Monsieur Amontero die Saite gefunden haben, kam mir der Verdacht, dass diese das Tatwerkzeug sein könnte.“
„Und dann haben Sie den berühmten Pianisten gleich eingesperrt. War da die Beweislage nicht etwas zu dünn? Eine Cellosaite in einer Tasche mit sich zu tragen, ist ja nicht verboten. Es könnte sie ihm jemand hineingelegt haben.“
„Kommen Sie schon, Florence! Jetzt sind Sie aber die Skeptische! Ich habe die Sachlage sofort prüfen lassen. Unsere Spurensicherung war mit dem Tatort schon fertig, aber ich habe deren Leiter gebeten, die Saite noch in der Nacht auf Blutspuren zu untersuchen. Freude hatte er keine darüber, denn er lag schon im Bett. Bis er kam, habe ich Amontero eingehend befragt. Er behauptete, erst vorgestern in Avignon angekommen zu sein, und schien ehrlich erschüttert von den Ereignissen. Aber das kann er uns auch vorspielen. Ein direktes Tatmotiv haben wir noch nicht gefunden, aber andererseits schien er mit Monsieur Lemercier und insbesondere mit seiner Frau sehr vertraut zu sein. Da kann man nie wissen.“
Florence musste auf einmal schmunzeln: „Also, dass er erst vor zwei Tagen aus Paris angereist ist, kann ich bestätigen. Ich habe nämlich bereits vorgestern früh am Gare de Lyon seine Bekanntschaft gemacht.“
„Mon Dieu, Florence! Sie kennen ihn? Und das sagen Sie mir erst jetzt?“
„Nein, nein. Ich kenne ihn nicht wirklich. Er wollte mir am Bahnhof meinen schwer erkämpften Sitzplatz streitig machen und da habe ich ihn zum ersten Mal in meinem Leben gesehen.“
Der Kommissar musste grinsen. Er winkte den Kellner herbei, bestellte sich noch einen zweiten Kaffee und lehnte sich in dem zerschlissenen Fauteuil zurück. Die Sache schien ihn zu amüsieren.
„Und das ist diesem Amontero natürlich nicht gelungen.“
„Natürlich nicht – und vorgestellt hat er sich mir auch nicht. Erst gestern beim Konzert habe ich ihn wiedergesehen, ohne zu wissen, wer er ist. Am Abend hat mich dann der Pfarrer darüber aufgeklärt, dass der Unbekannte im weißen Anzug der berühmte Pianist ist.“
„Na gut, sieht so aus, als hätten wir mit Ihnen eine weitere Zeugin. Da könnte ich Sie eigentlich auch ganz offiziell als Zeugin in das Kommissariat einladen!“
„Ach was, Antoine! Sagen Sie mir lieber, was der Chef der Spurensicherung zur Cellosaite zu sagen hatte!“
„Dass es sich dabei mit hundertprozentiger Sicherheit um eine der beiden Tatwaffen handle. Er ist sogar noch ins Labor gefahren und hat Blutspuren gefunden, die er dem Mordopfer zuordnen konnte. Die Tötungsart scheint ihn zu faszinieren, sonst hätte sich der alte Griesgram nicht um Mitternacht noch solche Mühe gemacht. Jedenfalls hatte ich danach keine andere Wahl mehr, als Monsieur Amontero als Tatverdächtigen festzunehmen.“
„Nein, die hatten Sie wahrscheinlich nicht. Jetzt sagen Sie mir aber noch, ob Sie einen Zusammenhang zwischen den Plakaten mit den Drohungen und dem Mord sehen?“
„Ach ja, in diese Geschichte sind Sie ja auch verwickelt. Mein Mitarbeiter Pierre Caspari hat mir schon berichtet, dass er die berühmte Florence Beaumarie zunächst als Kunstkennerin vor einer Plakatwand angetroffen hat. Er war es, der mir von Ihrer Anwesenheit in Avignon berichtet hat. Aber, nein, einen Zusammenhang zur Geschichte mit den Plakaten haben wir noch nicht gefunden. Gibt es denn noch etwas, was Sie uns nicht verraten haben?“
Gerade als Florence antworten wollte, betrat eine Polizistin in Uniform das Café. Sehr aufrechte Haltung, mittelgroß, sehr kurze hellblonde Haare, aufmerksamer Blick aus großen blaugrünen Augen, interessantes Gesicht – ein Alphatier, konstatierte Florence und Lambert hatte sich ihr sofort zugewandt.
„Ah, Leonie, Sie haben mich also ausfindig gemacht. Darf ich vorstellen, meine rechte Hand, Capitaine Leonie Perrin, von uns allen auch ‚die Expertin‘ genannt, weil sie in jede Materie, mit der wir uns gerade beschäftigen, rasch und tief einzudringen pflegt. Jetzt wird sie wohl in Kürze unsere Expertin für klassische Musik sein. Wenn sie hier auftaucht, ist es wichtig. Setzen Sie sich zu uns, Leonie!“
Leonie hatte die Beschreibung ihrer Person mit stoischer Miene über sich ergehen lassen. „Nein danke, Commandant. Ich muss gleich weiter. Es gibt eine neue Entwicklung im Fall Lemercier. Ein Cellist aus dem Orchester ist soeben im Kommissariat erschienen und hat gemeldet, dass eine Reservesaite aus seinem Cellokasten verschwunden sei. Ich gehe davon aus, Commandant, dass Sie ihn selbst verhören wollen.“
„Eine Reservesaite?“
„Jeder Streicher hat immer mindestens vier Saiten in einem kleinen Fach seines Koffers. Für den Fall, dass eine Saite während des Konzerts reißt. Der Cellist konnte die Saite sogar identifizieren. In diesem Fall handelt es sich um eine Saite der Marke Larson, die er dann aufzieht, wenn er keine Barockmusik spielt. Sie war auch schon etwas abgenutzt, weil er sie bereits in Verwendung gehabt hatte.“
„Na, was habe ich Ihnen gesagt, Florence. Schon ist meine geschätzte Kollegin zur Expertin für Streichinstrumente avanciert! Seit wann vermisst er denn die Saite?“
„Er hat gesagt, dass er sie bereits seit vier Tagen sucht. Gleich nach der ersten von drei Vormittagsproben des Orchesters in der Kirche sei es ihm aufgefallen.“
„Eigentümlich. Wenn Amontero tatsächlich vorgestern früh noch am Gare de Lyon war, wie meine ehemalige Kollegin hier bestätigen kann, kann er die Saite kaum selbst entwendet haben. Die Beweislage gegen ihn ist zu dünn, um ihn noch länger in Gewahrsam zu halten.“
Lambert erhob sich. „Es war schön, Sie wiederzusehen, Florence, aber jetzt ruft die Pflicht.“ Nach einem kurzen Augenblick des Zögerns fuhr er fort: „Leonie, ich möchte Ihnen noch Madame Florence Beaumarie vorstellen. Meine hochgeschätzte Kollegin aus dem Pariser Kommissariat, an dem ich lange Zeit meinen Dienst getan habe. Ihr Name ist Ihnen sicher nicht unbekannt. Sie ist mittlerweile pensioniert und privat hier in Avignon. Dennoch habe ich sie gebeten, uns im Fall Lemercier zu unterstützen und ein wenig hinter den Kulissen zu ermitteln. Schließlich hat sie einen Festivalpass und mit Sicherheit wird sie Wertvolles zur Aufklärung dieses Falles beitragen können.“
„Wie Sie meinen, Commandant. Ganz korrekt ist das vermutlich nicht. Pardon, Madame Beaumarie. Mein Chef hat manchmal etwas unkonventionelle Methoden, aber es freut mich, Sie kennen zu lernen. Wenn Sie Informationen brauchen, können Sie sich an mich wenden.“
„Danke, Capitaine. Mache ich. Ich werde mich nicht einmischen. Wenn ich aber etwas herausfinde, was Ihnen hier weiterhilft, wird es mich freuen und ich werde umgehend Bericht erstatten. Die ‚unkonventionellen Methoden‘ meines geschätzten Kollegen werden ja unter uns bleiben.“
„So ist es, Florence.“ Lambert streckte ihr die Hand hin. „Bitte trinken Sie noch in Ruhe Ihren Kaffee aus. Unser Wiedersehen hat mich außerordentlich gefreut!“
Als Florence fünf Minuten später am Tresen zahlen wollte, erfuhr sie, dass Lambert das bereits für sie erledigt hatte.