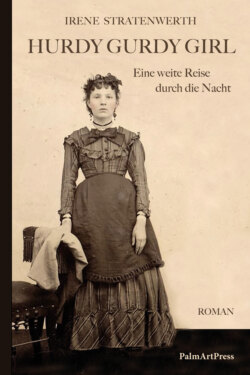Читать книгу Hurdy Gurdy Girl - Irene Stratenwerth - Страница 17
Zwölftes Kapitel
ОглавлениеJemand rüttelt an ihrer Schulter. Sie blinzelt unwillig. Ihr Kopf schmerzt, und es ist viel zu hell. Durch ein Loch im Dach fällt ein Sonnenstrahl und blendet sie.
Für einen Moment weiß sie nicht, wo sie ist.
Dann fällt ihr wieder ein, was Köberer am Abend angekündigt hat: Heute reisen sie weiter. Es sei an der Zeit für einen anderen Saloon in einer anderen Goldgräberstadt. Die Männer gäben mehr Geld aus, wenn man ihnen immer wieder frische Mädchen anböte. „Die sollen ruhig weiter daran glauben, dass sie eine von euch erobern können“, hat er mit einem schmierigen Grinsen zum Wirt gesagt.
„Aufwachen! Und zwar ein bisschen plötzlich!“, bellt Mathilde sie an.
Luise ist todmüde, fühlt sich wie zerschlagen, beginnt aber folgsam, sich aus ihrer Decke zu schälen. Vielleicht findet sich später im Planwagen ein Platz zum Weiterschlafen.
„Beeil dich“, drängt Mathilde.
„Sind alle schon bereit? Schickt dich Köberer?“, fragt sie verwirrt. Die Andere lacht verächtlich auf: „Der sagt nicht viel. Liegt mucksmäuschenstill in seinem Wagen und rührt sich nicht.“
„Es ist ja noch früh am Morgen. Befiehlt der Wirt, dass wir schon abreisen?“
„Der hat sich noch nicht blicken lassen. Schnarcht in seiner Kammer“, Mathilde klingt jetzt nicht mehr ganz so selbstsicher, „aber Köberer – er sieht krank aus. Oder ich weiß nicht. Es muss ganz plötzlich gekommen sein.“
Schlagartig ist Luise wach. Zitternd klettert sie hinter der anderen Deutschen die Stiege hinab und stolpert aus dem Saloon ins grelle Sonnenlicht.
Hinter dem Haus steht der Planwagen, in dem sich Köberer schlafen legt, sobald der letzte Gast den Saloon verlassen hat. Sein klappriger Gaul, den er an einen Baum gebunden hat, starrt sie trübsinnig an.
Vorsichtig schlägt Luise die Plane zurück. Ein Kopf mit fettigem, grauem Haar lugt unter einer schmuddeligen Decke hervor. Seltsam still liegt der Mann da.
„Herr Köberer?“, fragt sie leise.
Er rührt sich nicht.
„Wir müssen nach einem Arzt schicken“, stößt sie erschrocken hervor. Ihr Herz schlägt bis zum Hals.
„Dem hilft keiner mehr“, erwidert Mathilde grob.
Scheu streckt Luise ihre Hand nach der Stirn des Mannes aus: Sie ist eiskalt.
„Dann wecken wir den Wirt. Schnell! Er muss dem Sheriff Bescheid geben!“
„Polizei? Bist du noch bei Trost?“
Luise antwortet nicht.
„Den Köberer macht keiner mehr lebendig, das steht fest. Wenn der Sheriff kommt, glaubt er bestimmt, dass wir Mädchen den Alten kaltgemacht haben. Und nimmt sich seine Sachen: das Pferd, den Wagen und so.“ Kalt und drohend fährt Mathilde fort: „Und uns lässt er in San Quentin einsperren.“
Luise erschrickt: Von diesem Gefängnis hat sie schon gehört. Dorthin werden Schwerverbrecher aus San Francisco gebracht. Wer einmal in San Quentin landet, so heißt es, kommt nie wieder heraus. Egal ob Mann oder Frau.
„Vor ein paar Jahren haben sie hier oben ein Mädchen gehängt. Es war ihnen egal, dass sie schwanger war. Hat wohl einen Kerl erstochen, der ihr die Tür eingetreten hat oder so. Die Goldgräber haben kurzen Prozess mit ihr gemacht“, weiß Mathilde, „willst du, dass uns dasselbe passiert?“
„Aber wir haben doch nichts gemacht“, wendet Luise kläglich ein. Erst jetzt bemerkt sie die Schwestern, die mit weit aufgerissenen Augen stumm im Gras sitzen und ihre Bündel an sich pressen.
„Wie blöd bist du eigentlich? Ich habe dir doch schon einmal erklärt, dass alles, was wir hier tun, vom Gesetz verboten ist. Alles!“ Mathilde zieht ein Gesicht, als säße sie in einer Amtsstube und leiert mechanisch die Vorschrift herunter: „Das Tanzen, Herumziehen und öffentliche Auftreten in Lokalen, in denen Spirituosen, weinartige Getränke oder Bier ausgeschenkt werden, ist ein Vergehen und wird mit einer Geldstrafe oder mit Gefängnis bestraft.“
„Schneider hat es mir aber befohlen!“ Luise kämpft mit den Tränen. Sie mag nicht glauben, dass ihr Vater, der brave und gottesfürchtige Balthasar Ludwig, unter den Augen des Bürgermeisters von Langenhain einen Kontrakt unterschrieben hat, der gegen das Gesetz verstößt.
„Mach dir mal nicht ins Hemd“, herrscht Mathilde sie an, „hier oben in den Bergen lassen sie uns ja auch meistens in Ruhe. Wissen selbst, dass die Jungs ab und zu ein bisschen Abwechslung von der Schinderei brauchen. Aber es wäre schön blöd, jetzt zum Sheriff zu rennen und ihm die Ohren vollzuheulen.“
Mit einem langen Blick auf den Planwagen fügt sie hinzu: „Wen interessiert schon ein toter Mädchenhalter?“
„Er hätte mich nach San Francisco zurückgebracht. Zu Schneider. Er hat es versprochen“, schnieft Luise, während die Tränen über ihr Gesicht laufen.
„Was willst du denn bei dem? Hör auf zu heulen. Wir müssen hier weg, und zwar schnell.“
„Und Köberer?“
„Nehmen wir mit. Wenn der Wirt aufwacht, sind wir schon über alle Berge. Er lässt bestimmt nicht nach uns suchen. Lieber streicht er das Geld von gestern Abend alleine ein.“
Luise schluckt. Sie denkt an die vielen schönen Vierteldollarmünzen, die ihre Tanzpartner beim Wirt abgegeben haben.
Der Gaul, den Köberer günstig auf einem Viehmarkt erstanden hat, lässt sich nur widerwillig vor den Planwagen spannen. Schwitzend zerren die Mädchen an dem bockigen Tier herum, das ihnen mehrmals schmerzhaft vor die Schienbeine tritt.
Viele nehmen hier oben Ochsen als Zugtiere, weil sie kräftiger und billiger sind. Mit so einem Gespann würden sie aber erst recht nicht zurechtkommen.
Nachdem sie das Pferd und die Deichsel endlich miteinander verknotet haben, springen Luise, Marie und Elisabeth schnell unter das Stoffdach des Fuhrwerks. Mathilde setzt sich auf den Kutschbock und schwingt die Peitsche. Alle paar Meter scheut der Gaul. Dann schlägt und schreit sie so lang auf ihn ein, bis er wieder ein Stückchen weiter trottet.
Auf der staubigen Hauptstraße des Städtchens ist es noch menschenleer. Die Männer, die am frühen Morgen nicht zur Arbeit in den Goldminen sind, schlafen erst einmal ihren Rausch aus.
Bald erreichen sie die bewaldeten Hügel am Stadtrand. Auch hier geht es nur mühsam voran. Bei jedem Anstieg bleibt das Pferd einfach stehen. Die Mädchen müssen aussteigen und nebenherlaufen, manchmal sogar das Fuhrwerk schieben, um über den Hügel zu kommen. Kaum aber geht es wieder bergab, rast das Pferd los, als sei es auf der Flucht vor seiner schweren Fuhre.
Kreischend klammern sie sich dann an die Holzbogen unter der Plane. Alles, was im Wageninneren nicht festgezurrt ist, fliegt wild durcheinander. Sogar der starre Leichnam rollt auf der Ladefläche platschend hin und her, vom Rücken auf den Bauch und wieder zurück. Angewidert hält Luise den Toten mit den Füssen von sich weg.
Zwar könnte man das ganze Fuhrwerk mit einem hölzernen Hebel direkt neben dem Kutschbock bremsen. Aber Mathilde weiß diesen nicht zu bedienen. Wahrscheinlich hat sie daheim nur ein paar Mal neben dem Vater vorne gesessen, aber nie kutschieren gelernt.
Gelegentlich gibt ein Spalt zwischen den Stoffbahnen einen Blick auf die Landschaft draußen frei: Die riesigen Nadelbäume und bizarr geformten Felsbrocken am Wegesrand wirken viel größer und wilder als in der Heimat.
Sie fahren den ganzen Tag. Luise merkt kaum, wie hungrig und durstig sie ist. Zwischendurch fallen ihr manchmal die Augen zu, aber entsetzt wacht sie wieder auf, wenn der kalte, steife Leib des Köberers auf ihre Beine kippt.
Als die Sonne schon tief steht, bringt Mathilde das Fuhrwerk endlich zum Halten und wendet sich zu den Mädchen um: „Hier bleiben wir! Es wird bald dunkel. Ist Zeit zum Schlafen.“
„Hier?“, fragt Elisabeth erschrocken und klammert sich verängstigt an ihre Schwester.
„Wo sonst?“ Mit einem Blick auf die Leiche fügt Mathilde hinzu: „Bevor wir den da nicht los sind, können wir uns nirgendwo blicken lassen.“
„Im nächsten Ort gibt es bestimmt eine Kirche“, schlägt Luise eifrig vor, „und einen Pastor, der ihn bestatten kann.“ Einmal hat sie unterwegs einen solchen Friedhof mit Gräbern von deutschen Männern gesehen.
„Du hast es immer noch nicht kapiert?“, fragt Mathilde verächtlich, „was willst du dem Herrn Pastor denn erzählen?“
„Ich weiß schon, dass Köberer sich versündigt hat“, erwidert Luise. Sie hat den ganzen Tag darüber nachgedacht: „Er war bestimmt kein frommer Christ, und er ist auch nicht jeden Sonntag zum Gottesdienst gegangen. Doch unser Herr in seiner Güte vergibt allen. Er nimmt jeden in sein Himmelreich auf, wenn man ihn um Vergebung bittet.“ Sie erinnert sich genau, was sie im Konfirmandenunterricht gelernt hat: Dass Jesus am Kreuz gestorben ist, um für die irdischen Sünden der Menschen zu büßen und sogar für die schlimmsten Trinker. Nur die Katholischen in Ober-Mörlen glaubten noch an die Hölle und das Fegefeuer und fürchteten sich vor dem Teufel.
„Oha, wir haben eine Heilige unter uns!“, spottet Mathilde, „habe ich mir doch gleich gedacht, dass du ein ganz frommes Schäfchen bist.“ In einem Ton, der keinen Widerspruch duldet, bestimmt sie: „Heute Nacht bleibt Köberer bei uns. Im Wagen. Wenn wir ihn rausschmeißen, locken wir damit nur Aasfresser an.“
Die drei Mädchen starren sie erschrocken an.
„Keine Sorge. Der Alte kann euch jetzt nicht mehr antatschen.“
Zu viert teilen sie sich die schmale Ladefläche neben dem Leichnam und breiten, vor Kälte zitternd, Köberers Decke über sich aus. Luise, die direkt neben dem Toten zu liegen kommt, kann sich in dieser Enge kaum rühren. Die Haare stehen ihr zu Berge.
Seltsame Geräusche dringen von draußen herein. Das Rascheln, Trapsen und Jaulen im Wald klingt ganz anders als im Forst bei Langenhain. So oft haben Burschen ihr von den wilden Tieren hier oben erzählt. Riesige Bären, Luchse und Wölfe wagten sich manchmal bis zu den Hütten der Goldgräber vor. Außerdem schlichen Indianer durch die Wälder.
Schweißgebadet richtet sie sich auf: „Ich setze mich auf den Kutschbock und halte Wache. Dann könnt ihr jedenfalls schlafen.“
„So ein Quatsch!“, knurrt Mathilde gereizt, „willst du draußen den Lockvogel spielen? Leckeres, frisches Fleisch?“
Sie hat Recht. Und doch mag Luise keine Sekunde länger zwischen dem eiskalten Toten und den Mädchen eingequetscht liegen. Leise richtet sie sich auf, beginnt im Dunkeln herumzukramen und einen Wall aus Kisten und Bündeln am Fußende ihres Schlaflagers aufzuschichten. Als sie darüber krabbelt, um sich ganz hinten im Wagen quer zu legen, atmen die anderen drei erleichtert auf.
Zum Zudecken findet sie einen leeren Futtersack. Sie zieht ihre Knie bis zum Bauch hoch, schlingt die Arme darum und stemmt ihre Füße gegen die tragbare Drehorgel.
Einschlafen kann sie auch hier nicht. Sie zittert vor Angst und vor Kälte. Immer wieder kreisen ihre Gedanken um die Frage, was jetzt werden soll. Ob sie jemals nach San Francisco zurückkann? Und eines Tages sogar in die Heimat?
Luise erinnert sich noch ganz genau an Langenhain, an alle Gassen und Häuser, die Kirche, den Friedhof, den Brunnen, das Waschhaus, die Schule und das Schloss von Ziegenberg. Und die Menschen dort: ihre Namen, das Aussehen, die Kleidung, die Stimmen. Um sich die Zeit zu vertreiben, lässt sie ihre ganze Familie an sich vorbeispazieren: den Vater, die Mutter, die Dora und die Brüder. Dann die Nachbarn, den Pfarrer, den Bürgermeister und den Lehrer Faber. Die Mägde und Bauerntöchter im Waschhaus. Und alle Kinder, mit denen sie zusammen zur Schule gegangen ist.
Auch an die Frau, die ganz allein in einem Haus am Waldrand lebt und von allen in Langenhain „die Amerikanerin“ genannt wird, erinnert sie sich genau. Bettelarm sei diese gewesen und ein Waisenkind, so erzählten die Alten im Dorf, als sie mit einem Händler ins Land ging. Jahre später kam die Amerikanerin mit Taschen voller Geld zurück, kaufte einem verarmten Bauern seinen Hof ab und holte Handwerker aus Frankfurt, um das Wohnhaus fein herauszuputzen. Ihr Knecht, so hat Luise im Waschhaus aufgeschnappt, schlafe nicht immer bei den Tieren im Stall, sondern manchmal bei seiner Herrin im Bett.
Als Einzige in Langenhain hielt sie Pferde, und das anscheinend nur zum Zeitvertreib. An Sonntagen konnte man sie manchmal durch die Feldmark galoppieren sehen, angetan mit den Beinkleidern eines Mannes.
Einmal hat Luise mit ihr gesprochen. Als sie zum Wasserholen am Brunnen war, kam die Amerikanerin angeritten, schwang sich lässig aus dem Sattel und führte das Tier zur Tränke.
„Ganz schön heiß heute“, bemerkte sie grußlos und wedelte ein paar Fliegen weg.
„Guten Tag die Dame!“ Beinahe hätte Luise vor Ehrfurcht einen Knicks vollführt. Sie wusste nicht, was sich gegenüber einer Frau schickt, von der es hieß, sie besitze ein Schießeisen und wisse es auch zu bedienen.
„Fast wie drüben“, fuhr diese fort, als habe sie den artigen Gruß nicht bemerkt, „wie im Süden von Amerika, wo die Baumwolle wächst.“
„Ihr seid dort gewesen und habt es mit eigenen Augen gesehen?“ Luises Neugierde war stärker als ihre Scheu.
„Allerdings. Amerika ist phantastisch. Aber du musst dort alleine zurechtkommen. Da hilft dir keiner.“ Zum ersten Mal sah die Frau Luise direkt an: „Wenn du es wirklich wissen willst, fährst du am besten selbst hin.“
„Das wäre schön“, seufzte diese sehnsüchtig, „aber meine Eltern … der Vater bleibt in der Heimat. Hier ist unsere Scholle, sagt er. Der Herrgott hat uns nicht dafür gemacht, durch die weite Welt zu reisen.“
„Dann gehst du halt allein“, erwiderte die Amerikanerin aufmunternd, „junge Mädchen sind drüben immer gefragt.“ Luise starrte beklommen auf den dünnen Wasserstrahl, der aus dem Rohr in den Brunnen sprudelte.
„Setz einfach nur einen Fuß vor den anderen“, die Frau kletterte wieder auf ihr Pferd, „immer einen Fuß vor den anderen. So kommst du bestimmt an dein Ziel.“