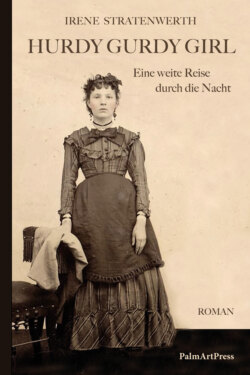Читать книгу Hurdy Gurdy Girl - Irene Stratenwerth - Страница 5
Erstes Kapitel
ОглавлениеNur bis Nauheim, hat die Mutter gesagt, nur bis dorthin allein zu Fuß. In zwei bis drei Stunden sei sie dort. Der Weg sei nicht zu verfehlen. Schneider erwarte sie am Abend im Kurpark.
Am Dorfrand steigt Luise den Hügel hinauf. Von hier aus kann sie schon den Kirchturm von Ober-Mörlen sehen und in der Ferne die Höhenzüge des Vogelsberges. Für einen Moment fühlt sie sich mutig und stark. Und dann wieder schrecklich allein.
Der Dora hat sie nicht einmal Lebewohl sagen können. Die Kleine ist gleich nach der Schule zum Vater aufs Feld.
Luise hat es zwar schon eine Zeitlang gewusst: Dass sie aus Langenhain fortgeht, als Erste aus der Familie. Aber sie hat es nicht übers Herz gebracht, es der Schwester zu sagen. Und heute Mittag hat ihr die Mutter plötzlich den sofortigen Aufbruch befohlen.
Rechts vom Feldweg senkt sich der Hang mit den winzigen Äckern der Tagelöhner und Landarbeiter ins Tal. Viele Frauen sind dort jetzt emsig beschäftigt, die Erde zu bestellen, Kartoffeln zu stecken, Weißkohl zu pflanzen und Hafer zu säen. Der Winter war lang und kalt, und jetzt ist es höchste Zeit.
Ihre Mutter würde hier niemals ackern. Sie baut ihr Gemüse auf einem ummauerten Hofplatz neben ihrem Wohnhaus an. Und Balthasar Ludwig, ihr Mann, pflügt seine größeren Felder jenseits des Dorfes, in der Talsenke zwischen Langenhain und Schloss Ziegenberg. Früher half ihm dabei ein Knecht.
Vor dem Mädchen spritzt ein Hase über den Weg und rennt im Zickzack über die Felder. Pass bloß auf, denkt Luise, sonst schießt dich der Wilderer tot. Viele im Dorf sehnen sich nach einem Sonntagsbraten, und der Jagdaufseher kann seine Augen nicht überall haben.
„He, Luise, grüß dich Gott! Wohin allein des Weges, so spät am Nachmittag?“
Die Frage schallt von Rosa herüber, einer kräftigen Magd. Andere Frauen unterbrechen ihre Feldarbeit, stützen sich auf ihre Harken und Spaten und starren das Mädchen neugierig an.
„Zur Cousine nach Nauheim“, gibt Luise knapp zurück.
„Zur Cousine, so so!“, Rosa prustet laut los, „hast es nicht noch ein bisschen weiter? Gehst vielleicht sogar für drei Jahre fort? Nimmst mich mit?“
Luise wird warm im Gesicht. Sie kennt ja das achte Gebot: Du sollst nicht lügen. Kaum ist sie von zu Hause fort, begeht sie die erste Sünde.
„Ich reise nach Amerika!“ Nur allzu gerne würde sie die Wahrheit laut herausposaunen und die zudringliche Magd damit zum Schweigen bringen. Alle anderen, die jetzt so tun, als machten sie sich wieder an die Arbeit, aber heimlich die Ohren spitzen, könnten es auch gerne hören.
Doch die Mutter hat ihr streng verboten, etwas zu sagen. Niemand soll wissen, wohin sie geht. Erst in ein paar Tagen werden es die Spatzen von den Dächern pfeifen: Dass die älteste Tochter vom Bauern Ludwig vorerst nicht zurückkommt. Dass sie ins Land gegangen ist wie schon so viele andere Mädchen aus Langenhain.
Nur noch ein paar Schritte und dann ist sie aus dem Blickfeld der Frauen verschwunden. Sie lässt den Feldweg links liegen, steigt über Wiesen und wilde Äcker zum Flüsschen hinab. Hoch aufgeschossen stehen Gräser und Buschwerk am Ufer. Dort ist sie vor neugierigen Blicken geschützt.
Ich gehe nach Amerika, summt Luise vor sich hin und erfindet gleich noch ein paar Reime dazu: Eins, zwei, drei, vier, keinen Tag bleib ich mehr hier. Fünf, sechs, sieben, acht, nimm dich vor jedem Mann in Acht.
„In Amerika ist alles besser.“ Wie oft hat sie diesen Satz schon gehört. Wenn Frauen in prächtigen Kleidern zu Besuch ins Dorf kamen, um ihre bunten Wolltücher, die feinen Schuhe und den fremdartigen Kopfputz vorzuführen. Und wenn im Waschhaus davon die Rede war, dass wieder einmal ein braves Mädchen aus der Wetterau in der neuen Welt einen achtbaren Bräutigam gefunden hatte.
Luise ist im letzten Winter siebzehn geworden. Schon lange ist sie so hoch gewachsen, dass sie mit dem Kopf an den Bettkasten stößt.
„Es reicht. Als Mädchen brauchst du kein Gardemaß!“ So scherzte der Vater, als seine Tochter ihn zu überragen begann. Doch die Mutter sah sie besorgt an. Sie fand es auch gar nicht gut, wenn Luise den ganzen Sommer auf dem Feld und im Viehstall schuftete, so dass ihre Arme muskulös und sehnig wurden.
„Wie eine Magd siehst du aus“, schimpfte sie, „wem willst du denn so gefallen?“ Oft fügte sie mit gesenkter Stimme hinzu, als würde sie zu jemand anderem sprechen: „Sie könnte so eine schmucke Braut sein. Wenn sie nur mehr aus sich machen würde.“
Als käme es darauf an, wie eine gebaut ist oder wie sie sich putzt. Kein Bursche im Großherzogtum Hessen kann sich das Mädchen, das ihm am besten gefällt, einfach zur Braut nehmen, das weiß in Langenhain jedes Kind. Bevor einer heiraten darf, muss er seinen Militärdienst absolviert haben und über ein eigenes Einkommen verfügen. Und auch dann geben die meisten Väter erst einmal ihre ältesten Töchter zum Heiraten weg.
Bis es so weit ist, hätte Luise als nutzlose Esserin zu Hause herumsitzen und sich langweilen müssen. Zwischen der Konfirmation und der Hochzeit können zehn Jahre vergehen.
So lange halten es viele nicht aus. Sie gehen stattdessen mit einem Landgänger fort: einem wie Schneider, der Mädchen zum Tanzen in der Fremde dingt. Was sie dort zu tun haben, weiß Luise nicht so genau. Sie hat nur die sorgenvollen Mienen der alten Weiber gesehen und das anzügliche Grinsen der Männer, wenn auf dem Kirchplatz von den Tanzmädchen die Rede war.
In Amerika störe es keinen, dass sie noch so jung sei und außerdem ein bisschen lang geraten, hat Schneider gesagt. Im Gegenteil. Dort suchten die Männer regelrecht nach stattlichen Frauen, die ordentlich zupacken können. Wie ein Stück Vieh hat er Luise von Kopf bis Fuß gemustert. Mit dem Ergebnis seiner Begutachtung war er zufrieden: „Für dich braucht man jedenfalls kein Podest.“
Johann Georg Schneider ist ein Neffe von Balthasar Ludwig und somit Luises Vetter. Sie könnte ihn einfach „Georg“ nennen, denn schließlich ist sie mit ihm verwandt. Aber das käme ihr nicht richtig vor: Schneider ist ein verheirateter Mann und zehn Jahre älter als sie. Außerdem war er fast immer in der Fremde.
„Ich fahre nach Amerika.“ Der Satz fährt in ihrem Kopf Karussell. Wie das bunt geschmückte Pferd, das sie auf dem Jahrmarkt in Nauheim gesehen hat, immer im Kreis herum, schleppt er einen Reigen bunter Bilder hinter sich her: Von Bauern, die sich ein Stück Land einfach mit Holzpflöcken abstecken. Von Goldklumpen, die man in Kalifornien findet wie Hans im Glück. Von Tanzvergnügen, bei denen es am Sonntag lustig und unbeschwert zugeht.
Luise hat jeden Bericht, den sie in der Gartenlaube über Amerika finden konnte, genau gelesen und viele davon mehrmals. Freiwillig ist sie jeden Sonntagnachmittag ins Schulhaus gegangen.
Um Punkt zwei Uhr, nach dem Gottesdienst und dem Mittagsmahl, öffnete der Schulmeister Faber regelmäßig seine Klassenstube und legte Zeitschriften und Bücher aus: für alle, die sich bilden wollten. Manche Hefte waren schon ziemlich zerlesen, aber das machte ihr nichts aus. Denn sie weiß: Wer heutzutage in der Welt zurechtkommen will, muss sich informieren.
Der Vater verzog zwar ärgerlich das Gesicht, wenn seine Tochter am heiligen Sonntagnachmittag in die Schule lief. Wozu musste sich ein Bauernmädchen im Lesen üben? Wozu brauchte sie das moderne Zeug, das in einem so genannten Familienblatt stand? Aber was konnte ein einfacher Landwirt schon gegen den Schulmeister ausrichten, dessen Wort im Dorf fast so viel galt wie das des Pfarrers?
Einmal ist Faber in einer Lesestunde zu Luise ans Pult getreten und hat ihr ein dickes, in braunes Leder gebundenes Buch gezeigt.
„Du interessierst dich doch für Amerika?“
Luise senkte verlegen den Kopf.
„Dies ist der Reisebericht einer berühmten Schriftstellerin. Ganz allein hat sie sich die weite Welt angesehen. Auch Amerika. Vielleicht magst du einmal darin lesen?“
Meine zweite Weltreise, Dritter Theil stand auf dem Titelblatt und ein Name: Ida Pfeiffer. Vorsichtig nahm Luise das Buch in die Hände und blätterte die ersten Seiten auf: Gleich am Anfang ging es um die Ankunft der Schriftstellerin in Kalifornien. Stadt der Wunder stand über dem ersten Kapitel. Ein anderes handelte von den Spielhäusern in San Francisco.
Wie gerne hätte sie sich sofort in die Lektüre vertieft! Doch solange Faber sie so unverwandt anstarrte, verschwammen die Zeilen vor ihren Augen.
„Ist vielleicht noch zu schwierig für dich“, hörte sie ihn sagen, während er das Buch wieder an sich nahm.
Ob der Lehrer da bereits wusste, dass der Vater einen Kontrakt über sie abgeschlossen und im Haus des Bürgermeisters unterzeichnet hatte?
Für drei Jahre vermietet der Landwirt Balthasar Ludwig seine Tochter Dorothea Luise, geboren am 6. November 1845 in Langenhain, Großherzogtum Hessen, als Tanzmädchen an den Landgänger Johann Georg Schneider.
Der Kontrakt wurde am 31. März 1863 besiegelt. Kaum zwei Wochen später hat die Mutter sie auf diese Reise geschickt.
Viel Gestrüpp überwuchert den Uferpfad, durchnässt ihre Schuhe und Strümpfe und zwingt sie, allen Windungen des Flüsschens zu folgen. Der Saum ihres abgewetzten Wollrockes hängt, schwer von der Feuchtigkeit, weit herunter und scheuert zwischen den Beinen. Einmal versucht sie, eine Abkürzung zu nehmen, doch dabei gerät sie ins Himbeergesträuch und zerreißt sich beinahe die Schürze.
Zweifelnd und verwirrt blickt sie sich um, streicht sich eine Locke aus der verschwitzten Stirn. Sie hat ihr Haar vor dem Aufbruch zwar sorgfältig unter der Haube festgesteckt, doch einige Strähnen lassen sich einfach nicht bändigen.
Ob sie besser wieder zum Fahrweg nach Nauheim hinaufsteigen soll? Oder ist das viel zu weit?
Die Mutter hat ihr außerdem streng verboten, diese Landstraße zu benutzen. Wo sich fahrendes Volk oder gar Räuber herumtreiben, sei es viel zu gefährlich.
Und was, wenn ihr dort oben eine Kutsche aus dem Schloss begegnet und jemand nach ihrem Ziel fragt?
Besser sie setzt ihren Weg am Ufer der Usa fort.
Schon nach wenigen Schritten gelangt sie zu einem schmalen Steg über das Flüsschen. Vorsichtig tritt sie auf die glitschigen Planken. Wenn sie in der Mitte kurz stehenbleibt und sich umwendet, kann sie vielleicht einen letzten Blick auf die Dächer von Langenhain erhaschen. Oder auf Schloss Ziegenberg, das auf einem Felssporn über dem Flüsschen thront. Doch die Bretter beginnen schon nach ihrem ersten Schritt bedenklich zu schwanken. Sie rettet sich mit einem großen Satz ans andere Ufer.
Nach einem wehmütigen Blick zurück wäre ihr ohnehin nicht zu Mute gewesen. Der Dreck in den schmalen Gassen des Dorfes, der Gestank nach Kuhmist, die Kälte, die täglich gleiche Grütze, der Hunger im Winter und die Enge in ihrer winzigen Stube – sie mag nie wieder daran denken. Und auch nicht an die vielsagenden Blicke der Mutter und ihre ständigen Ermahnungen, sich ihre Sittlichkeit zu bewahren.
Der Vater hat ohnehin so getan, als wisse er von ihrer baldigen Abreise nichts. Dabei hat er selbst den Kontrakt geschlossen und vom Schneider die Hälfte des Mietpreises im Voraus bekommen.
Ganze fünfhundert Gulden.
Dora. Die Gedanken an die Kleine umschwirren Luise wie ein lästiger Fliegenschwarm. Vor zehn Jahren kam die Schwester zur Welt, nur wenige Tage vor Weihnachten. Die Mutter hatte längst nicht mehr mit Nachwuchs gerechnet. Krank und entkräftet lag sie danach eine halbe Ewigkeit im Bett. Man wusste nicht, ob sie überhaupt wieder aufstehen würde. Drei der vier Kinder, die sie geboren hatte, waren noch am Leben. Sie machte keinen Hehl daraus, dass sie dieses Fünfte nicht gewollt hatte und sich auch nicht darauf freute, noch ein weiteres Mädchen durchzufüttern.
So war es von Anfang an Luises Aufgabe, sich um das winzige, rosige Bündel zu kümmern, dem Neugeborenen die Windeln zu wechseln, es in den Schlaf zu wiegen und es in einem Tuch durchs Dorf zu schleppen. Auch als die Kleine laufen und sprechen lernte, blieben die Mädchen unzertrennlich.
Dora wird weinen und zetern, wenn sie begreift, dass sie mit den Brüdern allein zurückgeblieben ist, denkt Luise. Jetzt hat sie keine große Schwester mehr, die sie in Schutz nimmt, wenn die Jungs sie piesacken und necken.
Ein Fahrweg kreuzt das Flüsschen. Nur eine Furt führt auf die andere Seite, in Richtung Ober-Mörlen. In der Ferne kann sie schon die ersten Gebäude der Ortschaft sehen, in der sich die schmalen Behausungen der Tagelöhner und Handwerker eng aneinanderreihen.
Viele Leute werden am Nachmittag im Dorf unterwegs sein: Mägde und Frauen auf dem Weg zum Brunnen. Und Kinder, die Botengänge erledigen oder einander jagen. Bald werden auch die Männer von der Forstarbeit heimkommen. Eine Siebzehnjährige, die allein in Richtung Nauheim wandert, würde bestimmt neugierig beäugt. Wenn jemand sie nach ihrem Weg fragen würde, müsste sie schon wieder lügen.
Da wandert Luise lieber weiter an dem Flüsschen entlang, das direkt in den neuen Kurpark von Nauheim führt.
Amerika. Für Luise klingt dieses Wort wie Musik. Wie jene Töne, die im Winter überall aus den Häusern von Langenhain dringen. Wenn die Instrumentenbauer aus dem Schwarzwald kommen, um ihre Spieluhren und Drehorgeln vorzuführen und zu richten, was auf den Reisen im Sommer Schaden genommen hat. Das schrille Pfeifen, Quäken und Seufzen aus diesen Kästen verbindet sich dann in den engen Gassen zu einem seltsamen Lied, dessen Text aus einem einzigen Wort besteht: Amerika.
Luise hat oft davon geträumt, selbst einmal in die Neue Welt zu gehen. Aber erst, wenn sie erwachsen ist und die Dora mitnehmen kann.
Als sie am Abend endlich den Kurpark erreicht, bekommt sie es zum ersten Mal mit der Angst zu tun. Am Ufer der Usa hat sie sich nicht gefürchtet, wenn es in der Böschung raschelte, wenn etwas vor ihren Füßen fortsprang und laut ins Wasser platschte. Das waren ja nur kleine Tiere, ein Frosch vielleicht oder eine Kröte.
Doch der große, stille Teich im Park ist ihr unheimlich. So viele Geschichten hat sie schon gehört von glücklosen Spielern, die ihr Leben in diesem Wasser ließen. Von in Schande geborenen Säuglingen, die ertränkt wurden, bevor ein Pastor sie taufen konnte. Und vom ruchlosen Treiben der Gestalten, die nachts unter den Bäumen im Park ihr Lager aufschlagen, weil sie in Nauheim kein Dach über dem Kopf haben.
Der Kies knirscht so laut, dass sie auf die Wiese ausweichen muss. Ihr Atem geht schnell, die Hände sind schweißnass. Aus dem Gebüsch vernimmt sie ein stetes Wispern und Rascheln. Der Weg durch den Park kommt ihr endlos lang vor. Ganz in der Ferne sieht sie das gelbe Licht einer Gaslaterne glimmen. Dort muss es zum Bahnhof gehen.
Plötzlich löst sich ein Schatten aus dem Gebüsch und tritt ihr in den Weg. Erschrocken fährt Luise zusammen. Dann erkennt sie die Stimme: Es ist Schneider.
„Du kommst spät“, er klingt eher besorgt als streng, „ich habe dich schon erwartet. Bist du aufgehalten worden?“
„Nein, nein, ich bin ohne Pause gelaufen.“ Luise ist weich in den Knien.
„Hast du Hunger?“
Sie brauche nichts, schwindelt sie, die Mutter habe ihr eine Brotzeit mitgegeben.
„Dann bring ich dich jetzt zu deiner Schlafkammer. Die anderen sind schon dort.“
Das schmale Gasthaus liegt nur wenige Schritte vom Bahnhof entfernt. Schneider führt Luise die Stiege hinauf, schließt eine Zimmertür auf und schiebt das Mädchen hinein: „Ruh dich aus! Morgen früh geht es weiter.“
Dann sperrt er hinter ihr ab.
Für einen kurzen Moment fällt Licht in den karg möblierten Raum. Auf einer Bettstelle sieht Luise zwei Mädchen liegen, die sich unter einer Decke eng aneinanderschmiegen. Nur ihre Haarschöpfe lugen heraus. Dann schiebt sich eine Wolke vor den Mond, und es wird stockdunkel.
Beklommen lässt sie sich auf dem Rand des Bettkastens nieder, wagt kaum zu atmen. Nach einer Weile kriecht eine Hand unter der Decke hervor und tastet nach ihr.
„Was ist? Kennst mich nicht mehr?“, fragt eine Mädchenstimme.
„Ich muss mal“, raunt Luise unglücklich. Sie hat sich nicht getraut, den Schneider nach einem Abort zu fragen. Jetzt ist es dringend.
„Am Fenster steht ein Nachtgeschirr.“
Im Dunklen ertastet sie das kühle Porzellan und hockt sich darauf.
„Du bist doch die Anna“, flüstert sie in die Schwärze, „die Möckel, Anna“. Sie erinnert sich noch genau an das kräftige, dunkelhaarige Mädchen mit dem offenen Gesicht, das in der Schulstube eine Reihe hinter ihr saß. Von Anna hieß es, sie sei schon bald nach der Konfirmation ins Land gegangen.
Etwas regt sich auf dem Lager. Die beiden Gestalten richten sich auf und rücken beiseite, um der Dritten Platz zu machen. Vorsichtig setzt sich Luise zu ihnen, zieht ein Stück Decke zu sich herüber und legt es sich über die Beine.
„Ich weiß noch, wie wir beide in der Schulstube saßen“, flüstert sie Anna zu, „ein Jahr vor mir warst du fertig.“
„Stimmt. Ist lange her.“
„Und wer bist du?“, fragt Luise die Andere, „im Dunkeln kann ich dich nicht erkennen.“
„Sie heißt Therese. Aber alle nennen sie Tesi“, antwortet Anna an ihrer Stelle, „ihr Vater ist der Will, Lorenz.“
Den Schafhirten, der mit seiner hageren Frau und einem Dutzend Söhnen und Töchtern in einer armseligen Kate am Feldrain haust, kennt Luise. Im Dorf hieß es, seine zerlumpten Kinder seien schon ein paar Mal von den Gendarmen in Nauheim aufgegriffen worden, als sie dort Kurgäste anbettelten. In der Schule ließen sie sich nur selten blicken.
„Ist sie denn schon alt genug, um in Stellung zu gehen?“, fragt Luise erstaunt.
„Vierzehn“, erklärt Anna wichtigtuerisch, „nach Amerika darf sie nur mit, weil ich versprochen habe, auf sie aufzupassen. Das hat der Will zur Bedingung gemacht.“
Was will der denn schon für Bedingungen stellen, denkt Luise verächtlich. Jeder im Dorf weiß, dass der Schafhirt ein bettelarmer Mann ist. Niemand hat ihm auch nur einen einzigen Scheffel Getreide geliehen, nicht einmal im kältesten Winter. Der Will wird froh sein, dass ihm jemand eins seiner hungrigen Mäuler abnimmt und dafür sogar noch zahlt.
Von draußen schlägt eine Faust hart an die Tür: „Ruhe da drinnen! Es wird geschlafen! Zum Schwatzen habt ihr morgen noch Zeit!“
Brav strecken sich die drei Mädchen nebeneinander aus.
Als die Atemzüge der Anderen ruhiger werden, kriecht Luise noch einmal unter der Decke hervor, kniet sich vor ihr Lager.
Jetzt, wo sie von zu Hause weg und in Stellung geht, würde es ihrem Herrn bestimmt nicht gefallen, wenn sie nur das einfache Kindergebet herunterleierte, das sie so oft mit Dora gesprochen hat. Sie versucht, sich an die Zeilen zu erinnern, die sie im Konfirmandenunterricht gelernt haben: den Abendsegen von Martin Luther.
„Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diesen Tag gnädig behütet hast, und bitte dich, du wollest mir vergeben alle meine Sünde, wo ich etwas Schlimmes gemacht … ehm, wo ich Unrecht getan habe“, murmelt sie leise und hofft, dass sie die Wörter richtig aneinanderreiht. Dann fallen ihr auch die letzten Sätze wieder ein: „Ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Amen.“
Schnell schlüpft sie wieder zu den Anderen unter die Decke. Luise hat ihr Lager immer geteilt. Jeden Abend ist Dora bei ihr im Arm eingeschlafen.
Doch diese Mädchen hier riechen anders als ihre Schwester. So eng liegen die beiden neben ihr, dass Annas Atem in ihrem Nacken kitzelt.