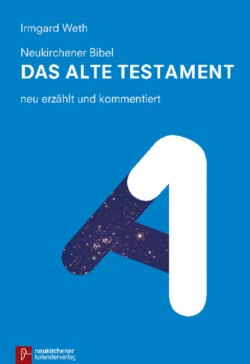Читать книгу Neukirchener Bibel - Das Alte Testament - Irmgard Weth - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vom Ursprung der Menschheit | Genesis 2–11 Mann und Frau
ОглавлениеGenesis 2
So schuf Gott den Menschen:
Er formte ihn aus Erde
und hauchte ihm
den Atem des Lebens ein.
Darum heißt der Mensch Adam,
das heißt Erdling,
weil er aus Erde gemacht ist.
Durch Gottes Lebensatem
wurde er ein lebendiger Mensch.2,7
Und Gott pflanzte für den Menschen
einen Garten im Land Eden.
Darin wuchsen vielerlei Bäume
mit köstlichen Früchten.
Der Mensch durfte ihn pflegen
und seine Früchte ernten.
Und vom Garten ging ein Strom aus,
der teilte sich in vier Arme
und machte das ganze Land fruchtbar.
In diesem Garten
durfte der Mensch leben.2,8ff
Aber mitten im Garten stand ein Baum,
der gehörte allein Gott:
der Baum der Erkenntnis.
Wer von diesem Baum aß,
wusste, was gut und was böse ist.
Darum sprach Gott zum Menschen:
„Von allen Bäumen darfst du essen.
Aber vom Baum der Erkenntnis
sollst du nichts essen.
Denn wenn du davon isst,
wirst du sterben.“2,16f
Und weiter sprach Gott:
„Es ist nicht gut,
dass der Mensch allein bleibt.
Ich will ihm ein Gegenüber schaffen,
das ihm entspricht,
das ihn versteht und mit ihm spricht.“2,18
Darauf brachte Gott die Tiere zu ihm,
die er geschaffen hatte.
Und der Mensch gab ihnen Namen,
jedem Tier seinen eigenen Namen.
Aber unter allen Tieren
fand sich kein Tier,
das dem Menschen entsprach.
Mit keinem konnte er sprechen.
Und keines
konnte den Menschen verstehen.2,19f
Da ließ Gott den Menschen
in einen tiefen Schlaf sinken.
Und als er aufwachte, sah er:
Eine Frau stand vor ihm.
Gott hatte sie ihm
als sein Gegenüber gegeben,
ihm gleich, aus seiner Rippe geformt,
und dennoch ein eigener Mensch,
von Gottes Händen geschaffen.2,21f
„Da ist sie ja“, rief der Mensch froh,
„sie, die zu mir gehört!
Der Mensch, der mir gefehlt hat!“
Und Adam nannte sie Eva,
das heißt: Leben.3,20
Darum wird ein Mann
Vater und Mutter verlassen
und seiner Frau angehören.
Und sie werden eins sein,
Mann und Frau, Frau und Mann.
Gott hat sie füreinander geschaffen. 2,24
– – –
Herr, unser Herrscher,
wie herrlich ist dein Name!
Wenn ich den Himmel betrachte,
das Werk deiner Hände,
den Mond und die Sterne,
die du gemacht hast:
Was ist der Mensch,
dass du an ihn denkst,
und was ist des Menschen Kind,
dass du dich seiner annimmst?
Du hast ihn wenig niedriger
als Gott gemacht.
Mit Ehre und Schmuck
hast du ihn gekrönt.
Du hast den Menschen
über das Werk deiner Hände gesetzt.
Alles hast du ihm unterstellt:
Schafe und Rinder,
dazu auch die wilden Tiere,
die Vögel unter dem Himmel
und die Fische im Meer.
Herr, unser Herrscher,
wie herrlich ist dein Name!
aus Psalm 8
Was ist der Mensch? Sobald der Mensch ins Blickfeld rückt, fängt das Genesisbuch an zu erzählen. Es erzählt vom ursprünglichen Einssein des Menschen mit Gott und seiner Schöpfung, von seinem Schöpfungsauftrag und von seiner geschöpflichen Bestimmung als Mann und als Frau. Im Unterschied zum einleitenden Schöpfungshymnus wird hier ganz schlicht und ganz menschlich von Gott erzählt und von den Gaben und Aufgaben, die er dem Menschen zugeteilt hat. Aber gerade darin ist diese scheinbar so altertümliche Erzählung zeitlos. Sie zeigt auf, wodurch aus biblischer Sicht der Mensch seine einzigartige Würde, aber auch seine Begrenzung erfährt:
• Gott formt den Menschen aus Erde, d.h. aus einem Klumpen Lehm. Das bedeutet: Der Mensch ist ein Meisterwerk Gottes, jeder einzelne Mensch ein Unikat, geformt von Gottes Hand, kein namenloses Massenprodukt. Aber auch das andere gilt: Der Mensch, ein „Erdmensch“ (das bedeutet der Name Adam, abgeleitet von adamah = Ackerboden), ist aus vergänglichem Material geschaffen (vgl. 3,19: „Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren“). Daraus folgt für den Menschen ein klares Ja zu seiner Leiblichkeit, aber zugleich auch die Einsicht in seine Vergänglichkeit.
• Gott haucht den Odem des Lebens in seine Nase. Das heißt: Der Mensch erhält sein Leben nicht aus sich selbst, sondern aus dem Lebensgeist Gottes. So erfährt sich der Mensch, wie auch alle anderen Lebewesen, mit jedem Atemzug von Gott abhängig. So drückt es auch der 104. Psalm aus. „Du sendest aus deinen Lebensgeist, so werden sie geschaffen. Nimmst du weg ihren Lebensgeist, so kommen sie um und werden wieder Staub“ (104,30.29).
• Gott gibt dem Menschen Lebensraum und Arbeit. Er setzt ihn in den Garten Eden, den er bewohnen und bearbeiten darf. Der Garten ist kein Schlaraffenland, sondern ein Ort, den der Mensch durch seiner Hände Arbeit pflegen und gestalten kann. Er wird auch nicht als jenseitiges Paradies vorgestellt, sondern als ein besonderer Ort mitten in unserer Welt, der von Gott für den Menschen geschaffen ist, ein Ort, von dem alles Leben auf dieser Erde ausgeht. Dies zeigen die vier Paradiesströme an: Sie kommen von Gott und bewässern unsere Erde. Bei ihm ist die Quelle des Lebens (Ps 36,10). Ohne dieses Wasser gäbe es kein Leben auf der Erde.
• Gott überträgt dem Menschen die Verantwortung für die Tierwelt. Er darf die Tiere „benennen“, das heißt: Er darf über sie bestimmen, aber er hat kein Recht, sie auszubeuten oder sie nur auf ihren Nutzwert hin zu betrachten. Die Tiere sind dem Menschen vielmehr als eigenständige Geschöpfe Gottes an die Seite gestellt (vgl. auch Ps 8,7ff).
• Aber das kostbarste Geschenk ist der Mitmensch, den Gott dem Menschen an die Seite stellt. Gott schafft ihm ein „Gegenüber“, sein Ebenbild, das ihm entspricht (2,18). Erst im Du, in der Gleichheit und Verschiedenheit von Mann und Frau, findet der Mensch zu seiner wahren Identität (hebr. isch und ischah). Ein großes Geheimnis liegt über der Erzählung von der Erschaffung der Frau. Feinsinnig vermeidet sie jeden Verdacht auf männliche Vorherrschaft, wie sie in patriarchalischen Gesellschaftsformen üblich war. Stattdessen heißt es: Gott lässt den Menschen in einen tiefen Schlaf fallen (2,21). Damit wird ausgedrückt: Der Mensch ist bei der Erschaffung seines Gegenübers selbst nicht beteiligt. Sein Gegenüber ist zwar aus seiner Rippe genommen – Zeichen der Gleichwertigkeit –, aber es ist Gottes ureigenes Schöpfungswerk und nicht nur seine Kopie (2,22). Hochzeitliche Freude liegt über dieser Szene: Wie der Brautvater die Braut dem Bräutigam zuführt, so führt Gott die Frau dem Mann entgegen (2,22b). Beide, Mann und Frau, dürfen einander als Gottes Gabe annehmen.
• Doch über allem steht das Gebot Gottes, das dem Menschen eine klare Grenze setzt: Alles ist dem Menschen von Gott übergeben. Nur eines ist ihm verwehrt: Er darf sich nicht an Gottes Stelle setzen und sich anmaßen, über gut und böse zu entscheiden, was allein Gott zusteht. Daran erinnert der „Baum der Erkenntnis“. Das Verbot Gottes, von diesem Baum zu essen, ist aber nicht als Einschränkung des Menschen zu verstehen, sondern als Ausdruck seiner besonderen Stellung innerhalb der Schöpfung: Als mündiger Mensch ist er aufgerufen, in Freiheit sein Ja zu Gottes Gebot zu sagen.
Damit unterstreicht dieses Kapitel: Am Anfang allen Nachdenkens über den Menschen steht Gottes Ja zu seinem Geschöpf. Die Antwort des Menschen auf die ihm verliehene Würde kann nur dankbares Staunen sein, wie es in Psalm 8 ausgedrückt wird: „Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? … Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Hoheit hast du ihn gekrönt“ (Ps 8,5f).