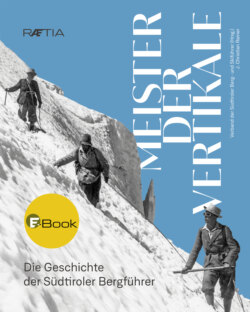Читать книгу Meister der Vertikale - j. Christian Rainer - Страница 10
Bergführer mit Brief und Siegel
ОглавлениеNicht nur alpinistisch leisten die Bergführer in den Anfangsjahren Großes. Sie sind auch als touristische Pioniere gefragt und – wie man im Mai 1870 im „Boten für Tirol und Vorarlberg“ liest – „vorzugsweise geeignet, Touristen in die bisher wenig begangenen, an Naturschönheiten und romantischer Abwechslung reichen Berggegenden zu ziehen, diese allmälig mehr bekannt und zugänglich zu machen“. Letzteres bezieht sich vor allem auf die damals noch von Bergführern übernommenen Aufgaben des Wege- und Hüttenbaus, um „dem gerade in Tirol gegenüber andern Alpenländern sehr vermißten Comfort in den Alpengegenden einigermaßen Fürsorge tragen zu können“. Zwar überlassen die Bergführer schon nach wenigen Jahren diese Arbeiten mehr und mehr dem Alpenverein, trotzdem sind sie aber weiterhin zentrale Figuren im touristischen Angebot Tirols.
Das bleibt selbstverständlich auch den Behörden nicht verborgen, die Ende der 1860er-Jahre in vielen Orten und ganzen Tälern vor einem Problem stehen: dem Mangel an Bergführern. Von der k. k. Bezirkshauptmannschaft in Innsbruck ergeht daher die Aufforderungen an die Magistrate, aktiv nach geeigneten Leuten zu suchen, um diese als Bergführer anzuwerben. So werden Kandidaten direkt von Beamten und Ortsvorstehern angesprochen, zudem setzt man auf die Breitenwirkung von Plakaten: „Bergführer gesucht“.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wird der Alpintourismus zu einem wichtigen Standbein – auch in den Seitentälern (im Bild der Hochgall).
So rücken die Bergführer in den späten 1860er- und frühen 1870er-Jahren immer mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit. Weil man um ihre Bedeutung weiß, kümmert sich etwa der Österreichische Alpenverein (OeAV) immer aktiver um die Führer – auch finanziell. So liest man 1870 erstmals von einer „Gratifikation“, die besonders bewährten Führern vom OeAV zuerkannt und über den Bezirkshauptmann ausgezahlt wird. Es sind 30 Gulden, heute immerhin etwa 400 Euro, über die sich ein Bergführer aus Neustift und einer aus Gschnitz freuen können. Noch wichtiger als die finanzielle Unterstützung ist die rechtliche, die – immer im Jahr 1870 – zunächst im politischen Bezirk Innsbruck festgeschrieben wird: in Form der ersten Bergführerordnung und des ersten Bergführertarifs in Tirol, erlassen von der k. k. Bezirkshauptmannschaft.
Tüchtig = autorisiert
„Jedenfalls mögen nur solche Führer genommen werden, welche mit den behördlichen Führerbüchern versehen sind, und da Excursionen in diesem Theile der Alpen keine einfachen Spaziergänge sind, möge sich Niemand andere als anerkannt tüchtige, also behördlich auto- risirte Führer aufdringen lassen.“
„Der Ortlerführer“, 1876
Sie wird zur Vorlage für die nur ein Jahr später erlassene einheitliche Bergführerordnung für ganz Tirol und Vorarlberg, die über weite Strecken deckungsgleich mit der Innsbrucker Ordnung ist. Einige interessante Abweichungen gibt es allerdings und diese lassen sich aus der Vorgeschichte der Regelung und mit der zentralen Rolle, die der Alpenverein darin spielt, erklären. Schon 1870 beauftragt die Generalversammlung des Deutschen Alpenvereins (DAV) „die bekannten Alpenfreunde“ Johann Stüdl, Kaufmann in Prag, und den Venter Kuraten Franz Senn damit, eine Bergführerordnung für ganz Tirol und Vorarlberg zu entwerfen, um diese der kaiserlich-königlichen Statthalterei in Innsbruck zur Verabschiedung vorzulegen. Stüdl und Senn kommen ihrem Auftrag nach, nicht ohne dem Alpenverein eine wichtige Rolle in der künftigen Regelung des Bergführerwesens zuzuschreiben. So räumt der Alpenverein seinen Sektionen schon in § 1 des Entwurfs das Recht einer „speciellen Prüfung, Ueberwachung, Kontrolle der Führer“ ein, macht also deutlich, dass man der Entwicklung des Bergführerwesens nicht untätig zuschauen wolle. Zugleich wird der mediale Druck auf die Behörden erhöht, dem Alpenverein einen Zugriff auf das Bergführerwesen zu eröffnen und die Auswahl der Führer nicht allein den politischen Vertretern vor Ort zu überlassen.
Bitte (nicht) lächeln: Wohl in den 1890er-Jahren posieren Ridnauner Bergführer in voller Montur vor dem Hotel Sonklarhof für den Fotografen.
Sie wissen alles besser …
„Die Gemeindevorsteher erhalten von der k. k. Bezirkshauptmannschaft den Auftrag, zum Bergführerdienste taugliche Individuen namhaft zu machen […]. Was thun nun die Berg- und Gletscherkundigen Vorsteher? Sie heften eine Aufforderung zur Anmeldung zum Fremdenführerdienste an die schwarze Tafel bei der Kirche und warten in ihrer Kanzlei auf die sich Meldenden. An dem einen Orte kommt Niemand, am anderen zwölf, aber mit Ausnahme eines Einzigen, alle unkundige oder nichtsnutzige Leute. Diese sollen nun als Führer autorisirt werden und von der k. k. Bezirkshauptmannschaft vidirte Führerbücher erhalten. Damit ist die Organisation des Führerwesens beendet. […] Löset euch auf ihr Sektionen des deutschen Alpenvereins in Tirol und Vorarlberg und leget, ihr Alpenfreunde, eure mühsam gesammelten Erfahrungen und Kenntnisse über Berge und Gletscher, gute oder schlechte Führer, deren nothwendige Eigenschaften u.s.w. bei Seite; die Gemeindevorsteher in ihren Kanzleistuben wissen Alles viel besser.“
„Pustertaler Bote“, 7. Dezember 1871
Ganz geht die Rechnung des Alpenvereins nicht auf, in der am 4. September 1871 von der k. k. Statthalterei für Tirol und Vorarlberg erlassenen „Bergführerordnung giltig für Tirol und Vorarlberg“ heißt es in § 1: „Das Bergführerwesen steht unter der Aufsicht und Leitung der politischen Behörde.“ Vom OeAV oder DAV ist darin nicht die Rede, allerdings werden die „gesetzlich bestehenden Alpenvereine“ in zwei weiteren Artikeln als Ansprechpartner der Bergführer genannt. Oder besser gesagt: Die Führer sind den Vereinen Rechenschaft schuldig, womit Letztere den Fuß in die Tür bekommen und in den folgenden Jahren ihre Macht innerhalb des Bergführerwesens Schritt für Schritt ausbauen.
Die erste Tiroler Bergführerordnung von 1871 ist aber nicht nur hinsichtlich der Rolle der Alpenvereine interessant. Sie regelt auch erstmals den Zugang zum Beruf des „behördlich autorisierten Bergführers“ und die Ausübung desselben. In der Ordnung sind die Rechte und Pflichten der Führer ebenso festgeschrieben wie jene der Gäste. Und zwar detailliert. So dürfen nur Personen als Bergführer anerkannt werden, die unbescholten sind, also ein blütenweißes Leumundszeugnis vorweisen können, und vom Gemeindevorsteher mit einem Befähigungszeugnis ausgestattet werden. Wird ein Bewerber für tauglich befunden, erhält er von der Bezirkshauptmannschaft ein Führerbuch, das Jahr für Jahr von den Behörden beglaubigt werden muss. In diesem Buch sind all jene Touren oder vielmehr Gebiete eingetragen, für die der Führer als geeignet befunden worden ist. Allein daraus erkennt man, dass das Bild des Bergführers als ortskundiger Wegweiser immer noch tief im allgemeinen Verständnis verankert ist. Das Führerbuch gilt einerseits als Nachweis der behördlichen Genehmigung, also als Bergführerausweis, andererseits dient es dem Bergführer aber auch als Sammlung seiner Referenzen. Dafür ist eine genügend große Anzahl leerer Blätter vorgesehen, auf denen die Gäste ihre Erfahrungen mit dem Führer niederschreiben sollen.
„Schließlich glauben sie selber an ihre Unfehlbarkeit“
Das Bergführerbuch wird über die Jahre immer wieder zum Stein des Anstoßes. Die Führer selbst ärgert, dass sie von – meist völlig unbedarften – Gästen beurteilt werden, die Gäste ärgern kaum fundierte Lobhudeleien. Irgendwann (1915) wird es dem Deutschen und Österreichischen Alpenverein (DuOeAV) zu bunt. Er gibt in seinen „Mitteilungen“ eine Reihe von Weisungen für seine Mitglieder aus, was sie ins Führerbuch eintragen sollten – und vor allem, was nicht. So heißt es darin, man solle die Führer nicht über den grünen Klee loben, das „erhöht unnötigerweise das Selbstgefühl der Führer. […] Schließlich glauben sie selber an ihre Tüchtigkeit und Unfehlbarkeit.“ Deshalb solle man auch Missstände offen ansprechen, damit die Aufsichtsorgane diesen nachgehen könnten. War der Führer also unfähig, war er ein „mürrischer, schnippischer oder ein den Reinlichkeitsgewohnheiten des Touristen widersprechender Mensch“? Weil der Alpenverein offensichtlich nicht nur die Führer belangen will, teilt er auch in Richtung Gäste aus: „Die meisten Touristen sind gar nicht in der Lage, die Qualität der Führer und der gemachten Tour zu beurteilen. […] Im gewöhnlichen Leben fällt es ja auch keinem Kaufmann oder Arzt ein, über die Betriebssicherheit einer Drahtseilbahn zu urteilen, warum also hier?“
Als Aufgabe des Bergführers wird in der ersten Tiroler Bergführerordnung definiert, „das reisende Publikum auf der bestimmten Route zu begleiten, Verirrungen zu verhüten und Unglücksfälle von Touristen thunlichst hintanzuhalten“. Es sei seine Pflicht, „sich anständig, artig, freundlich und zuvorkommend gegen dieselben zu benehmen und ihnen alle thunliche Beihilfe zu leisten“. Auch wird der Führer verpflichtet, mindestens 15 Kilo Gepäck kostenlos für seine Gäste zu schultern, ein geeignetes Seil bei sich zu haben, sich selbst zu verpflegen und keine Gebühren zu verrechnen, die über die festgelegten Tarife hinausgehen. Die Rechte seinem Gast gegenüber reichen dagegen weit weniger weit: „Ungebührliche Zumuthungen oder üble Behandlung von Seite der Reisenden hat er [der Führer] mit ruhigem Ernste zurückzuweisen“, heißt es im Reglement. Mehr nicht.