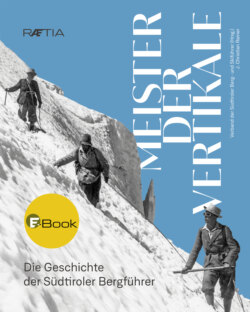Читать книгу Meister der Vertikale - j. Christian Rainer - Страница 12
Der Motor ist angeworfen
ОглавлениеDie Bergführerordnung von 1871 ist der Grundstein, auf dem sich in Tirol ein geordnetes Bergführerwesen entwickeln kann. Auch in finanzieller Hinsicht. So werden ab Sommer 1872 im Amtsblatt die Tarifverzeichnisse der Bergführer Bezirk für Bezirk veröffentlicht. Zugleich werden darin auch die Namen der autorisierten Bergführer angeführt. Damit ist für die Gäste von vornherein (und amtlich) klar, wer für eine bestimmte Tour über die nötigen Voraussetzungen verfügt und was die Tour kosten wird. Interessant ist, dass sich die Südtiroler Bezirke mit der Festlegung der Bergführertarife viel Zeit lassen. Erst vier Jahre nach Innsbruck als erstem Bezirk erkennt die Bezirkshauptmannschaft Meran 1876 ihre Führer amtlich an, zwölf davon allein in Sulden. 1878 ist das Hochpustertal mit seinem Tarif zur Stelle, der politische Bezirk Bozen braucht sogar noch ein Jahr länger. Sein Tarif für damals 33 Bergführer und 160 Touren in Bozen, im Überetsch, am Ritten, im Sarntal, im Rosengarten- und Schlerngebiet, in Gröden und Villnöß erscheint 1879 und wird „in jedem Gasthause an in’s Auge fallender Stelle angebracht“.
Was kostet der Ortler?
Der von der Meraner k. k. Bezirkshauptmannschaft 1876 genehmigte Führertarif listet für Sulden 48 Touren auf, darunter allein fünf auf den Ortler. So kostet die Besteigung des „höchsten Spitz’ von Tirol“ auf dem Normalweg mit Übernachtung in der Payerhütte 10 Gulden, über den Hintergrat mit Übernachtung in der Schaubachhütte 13 Gulden und über das Hochjoch 16 Gulden. Günstiger ist die Tour auf die Königspitze (12 Gulden) bzw. auf den Cevedale (7 Gulden). Zum Vergleich: Ein durchschnittlicher Monatslohn belief sich damals auf rund 16 Gulden.
Interessante Kombination: Johann Innerhofer, Jahrgang 1870, war in Steinhaus nicht nur als Bergführer tätig, sondern auch als Briefträger.
Der Bergführertarif, hier jener von 1893 für Sulden, war weit mehr als eine Information für potentielle Gäste. Er wurde vom Alpenverein festgelegt und war für die Führer bindend.
Neben der behördlichen Regelung des Bergführerwesens beginnen die Bergführer, sich auch selbst zu organisieren. Bereits vorangegangen waren jene Bezirke, in denen die Nachfrage am größten war. So gab es ab 1865 etwa den Bergführerverein Sulden-Trafoi. Die Führervereine sind allerdings nicht als Konkurrenz zum Deutschen und Österreichischen Alpenverein (DuOeAV) gedacht, sondern von diesem gewollt. „Es soll möglichst auf die Bildung von Führervereinen hingewirkt werden, die unter der Aufsicht der Sektion stehen“, schreibt der Alpenverein. Die Vereine sollen vor Ort die Bergführerschaft organisieren, als Bindeglied zum Alpenverein fungieren, Kandidaten an den Beruf heranführen sowie Hütten und Wege bauen und instand halten. In eigenen Bergführerbüros werden mancherorts auch Anfragen von Touristen an die Bergführer weitergeleitet, wobei der Obmann darauf achten soll, alle Führer gleichmäßig zum Zuge kommen zu lassen.
„Allerlei Verdrießlichkeiten“
Für die Bergführer in alpinen Zentren war die Kehrordnung von zentraler Bedeutung. Die hat aber nichts mit einem Besen zu tun, sondern regelt das Zusammenbringen von Angebot und Nachfrage, von Bergführern und Gästen. „Die Handhabung der Kehrordnung ist allerdings nicht leicht und bleiben allerlei Verdrießlichkeiten nicht aus“, schreibt der DuOeAV noch Anfang des 20. Jahrhunderts. Und: „Notwendige Voraussetzung ist natürlich, daß der Obmann, welcher die Zuweisung vornimmt, streng unparteiisch vorgeht, andererseits die Führer sich nicht selbst den Reisenden aufdrängen.“ Eine Ausnahme von der Kehrordnung gibt es aber: Verlangt ein Kunde ausdrücklich einen bestimmten Führer, „so muß er natürlich diesen erhalten“.
Wo ein Büro fehlt, treffen sich Angebot und Nachfrage beim „Bergführerbankl“, auf dem es sich all jene Führer gemütlich machen, die gerade kein Engagement haben, und dort von den Gästen unter die Lupe genommen werden können. Nur in Sulden handhabt man zu Beginn die Beziehungen zwischen Gast und Führer anders: Treffpunkt der Führer ist das Gasthaus Eller, das von der Familie des Suldner Pfarrers Johann Eller geführt wird. Der ist es auch, der die Anfragen der Gäste entgegennimmt und den Führern ihre (zeitweiligen) „Herren“ zuteilt. Später rückt das „Bankl“ dann vor das Hotel, der Segen von ganz oben bleibt aus.