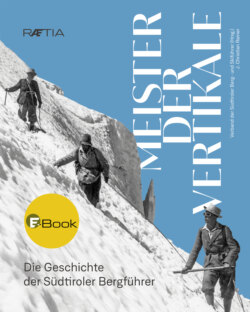Читать книгу Meister der Vertikale - j. Christian Rainer - Страница 16
Das goldene Zeitalter des Bergführerwesens
ОглавлениеNie zuvor und auch nie wieder danach sind die Bergführer gesellschaftlich so angesehen und wirtschaftlich derart gut gestellt wie in den Jahrzehnten von 1880 bis zur Jahrhundertwende. Bergführer sind Autoritäten, ihre Meinung zählt, sie sitzen in den Gemeinderäten und in führenden gesellschaftlichen Positionen, können sich ein ansehnliches Vermögen aufbauen, investieren in die touristische Infrastruktur und werden selbst oft zu Schutzhütten- oder Hotelbetreibern. Das liegt auch daran, dass die Führerlöhne verglichen mit dem bäuerlichen Auskommen fürstlich sind. So schlägt etwa die Zwei-Stunden-Wanderung von Blumau nach Tiers für den Gast mit 1,50 Gulden zu Buche. Für die reichen Gäste ist eine solche Summe zwar kein Problem, ein Arbeiter aber muss dafür drei Tage schuften. Und dabei ist die angegebene Wanderung die bei Weitem günstigste im Führertarif für das Rosengartengebiet. Die teuerste Tour, die Überschreitung der Rosengartenspitze, schlägt dagegen mit 11 Gulden zu Buche. Kommt der Bergführer also abends von dieser Tour nach Hause, hat er zwei Drittel des Monatslohns eines Arbeiters in der Tasche.
Den Braten gerochen
Dass der Beruf des Bergführers (und auch jener des Trägers) in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begehrt war, lag nicht zuletzt an den Verdienstmöglichkeiten, die es nun für Bauern, aber auch für Knechte oder Tagelöhner gab. In Tiers etwa heuerte ein Tourist einen Tagelöhner an, seinen Rucksack zum Karersee-Hotel zu tragen. Oben angekommen, gab ihm der Tourist 5 Kronen, eine unerhörte Summe für ein paar Stunden Arbeit. Schließlich hätte der Taglöhner bei seinem Bauern mehr als neun Tage Schwerstarbeit leisten müssen, um gleich viel zu verdienen. Fast noch mehr als über diesen fürstlichen Lohn soll sich der Träger allerdings über den Braten gefreut haben, den ihm der Tourist zum Mittagessen spendiert hatte. Einen Braten kannte der Tagelöhner schließlich nur vom Hörensagen…
Gesellschaftlich stehen die Bergführer im ausgehenden 19. Jahrhundert also auf dem Gipfel. Und auch alpinistisch sind sie es nun, die die Entwicklung in ihren Bergen bestimmen. Das war weiß Gott nicht immer so. Noch Mitte des 19. Jahrhunderts „importiert“ der Ire John Ball für seine Erstbesteigungen in den Ampezzaner Dolomiten Führer aus Chamonix, weil er vor Ort keine ausgebildeten Bergführer findet. Für Ball zählen also vor allem alpinistisches Geschick und die Erfahrung als Führer, während er von seinen Begleitern keine Ortskenntnis verlangt. Paul Grohmann, als Alpinist höchstens mittelmäßig, hält dies anders. Er engagiert stets vor Ort Begleiter, die ihn auf die Gipfel führen. Die Besteigung der Marmolata di Rocca, auf der er 1862, wie er selbst schreibt, „wahrscheinlich als erster Tourist“ steht, gelingt ihm etwa mit Pellegrino Pellegrini aus Rocca Pietore. Ihm verweigert Grohmann zwar den Titel „Bergführer“, er ist in Wirklichkeit aber genau das. Dasselbe gilt für die Ampezzaner Angelo Dimai, Francesco Lacedelli und Santo Siorpaes, die Grohmann bei den Erstbesteigungen der Tofana di Mezzo (1863), der Tofana di Rozes (1864) und des Monte Cristallo (1865) führen. Sie alle sind Bergführer ante litteram, Profis ohne Titel. Siorpaes etwa spezialisiert sich später mit großem Erfolg auf Erstbesteigungen mit englischen Gästen. Am Ende seiner Karriere stehen nicht weniger als 27 davon in seinem Tourenbuch.
Nicht immer müssen die Kunden aber zwischen alpinistischem Vertrauen und Ortskenntnis entscheiden, manchmal lässt sich beides durchaus verbinden. In seinem großen Sommer 1869 findet etwa Paul Grohmann im Kärntner Peter Salcher einen „erprobten Führer“, dem er in alpinistischer Hinsicht voll vertraut. Weil Salcher aber genauso wenig ortskundig ist wie sein „Herr“, engagiert Grohmann für diese Touren zusätzlich den Sextner Führer Franz Innerkofler. Dieser bringt neben alpinistischem Können auch seine Ortskenntnis ein, sucht am Berg nach gangbaren Wegen und ist so etwas wie ein Wegbereiter für das Gespann Salcher-Grohmann. Im Schlepptau seiner „beiden Unzertrennlichen“ Salcher und Innerkofler gelingen Grohmann die drei Erstbesteigungen, die ihn endgültig zur Ikone machen: der Dreischusterspitze am 18. Juli, des Langkofels am 13. August sowie der Großen Zinne am 21. August 1869.
Zwar erntet Paul Grohmann für diese alpinistischen Großtaten den ganzen Ruhm, auch Franz Innerkofler eröffnen sie aber neue Chancen. Hat er sich bis dahin als Tagelöhner und Steinmetzgeselle verdingt, schlägt er nun als erster Sextner die Karriere eines Bergführers ein, wenn auch nur im Nebenberuf. Er gilt „als guter Mann für schwierige Aufgaben“, allerdings auch – so beklagt sich ein englischer Gast in den 1870ern – als „langsamer Geher und zu Wucherpreisen neigend“. Auf Innerkoflers Konto geht neben den drei Pionierleistungen mit Grohmann unter anderem auch die Erstbesteigung des Paternkofels 1882. Das Paradox, dass heute allein Grohmann als Erstbesteiger der großen Dolomitengipfel gefeiert wird, obwohl er diese nur mit Hilfe seiner Führer überhaupt betreten konnte, hat wohl historisch-soziale Wurzeln. Grohmann war der „Herr“, die Führer waren bloßes Dienstpersonal, das es nicht nur zu finden und zu finanzieren, sondern auch zu „erziehen“ galt. „Alle – ohne Ausnahme – haben mit mir ihre ersten Wege als Führer gemacht“, schreibt Grohmann. „Sie haben sich alle bewährt, sind ausnahmslos brave Leute, zuverlässige Führer und grösstentheils treffliche Steiger gewesen.“
Grohmann ist mit dieser Haltung nicht allein. Auch Viktor Wolf von Glanvell, heute als der Erschließer der Pragser Dolomiten bekannt, macht in „seinen“ Bergen kaum einen Schritt ohne Begleitung, ist vielmehr ausnahmslos am Seil von Pragser und Sextner Führern unterwegs. Interessant ist sein Bericht über die Erstbesteigung des Herrsteinturmes 1891, die uns einen Einblick in die damalige Rollenverteilung zwischen „Herr“ und Führer gewährt. Während Wolf-Glanvells Führer Josef Appenbichler nämlich am Vortag der Besteigung allein durch einen Großteil der Wand klettert, alle Schlüsselstellen meistert und erst umkehrt, als der Weg auf den Gipfel klar ist, liegt der „Herr“ genüsslich im Gras und verfolgt seinen Führer durch das Fernglas. „Appenbichler erklärte, es sei auf dem von ihm heute probirten Wege wohl hinaufzukommen, die weisse Wand sei das schwerste Stück, oberhalb derselben ‚könne man eine Kuh auf den Gipfel hinauftreiben‘“, schreibt Wolf-Glanvell. Der Ausdruck „im Vorstieg“ bekommt hier eine ganz neue Bedeutung.
Mit Seil, Pickel und Schneeschuhen rücken die Grödner Bergführer im ausgehenden 19. Jahrhundert zum Fototermin an. Und auch der Hund muss mit aufs Bild.
Trotzdem ist die Beziehung zwischen Kunden und Führern keine Einbahnstraße, vor allem weil es den Bergführern nicht vorrangig um den Ruhm einer Erstbesteigung geht. Vielmehr sind solche Besteigungen für sie ein einträgliches Geschäft, sie werden von den Gästen am Seil, die sich dadurch einen Platz in den alpinen Geschichtsbüchern sichern, großzügig bezahlt. Zugleich sind die Erstbesteigungen auch so etwas wie die Visitenkarte der Führer: Je mehr und je schwierigere sie schaffen, desto höher steigen sie in der Führerhierarchie. Und desto höher werden auch die Gagen. Als Meister dieses Fachs gilt der Sextner Michl Innerkofler, der eine ganze Reihe bis dahin als unbezwingbar geltender Gipfel ersteigt: den Zwölfer, den Elfer, den Einser, die Sextner Rotwand, die Westliche und die Kleine Zinne, die Croda da Lago und die Grohmannspitze – manchmal mit, manchmal ohne zahlenden Gast, aber immer als Erster. Seine alpinistischen Pionierleistungen machen Innerkofler zum „Dolomitenkönig“, der von diesem Ruf gut leben kann.
Seiner Zeit voraus: Auch wenn er selbst nicht „Bergführer“ genannt wird, wäre die Erschließung der Ampezzaner Dolomiten ohne Angelo Dimai – hier porträtiert von Toni Hiebeler – nicht möglich gewesen.