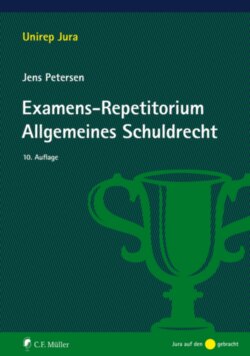Читать книгу Examens-Repetitorium Allgemeines Schuldrecht - Jens Petersen - Страница 50
На сайте Литреса книга снята с продажи.
a) Anspruch auf Vertragsaufhebung
Оглавление93
Ein viel diskutiertes Problem besteht in der Frage, ob im Falle der arglistigen Täuschung oder widerrechtlichen Drohung neben der Anfechtungsmöglichkeit des § 123 I auch ein Anspruch aus §§ 311 II, 280 I 1, 241 II besteht, der nach § 249 I auf Vertragsaufhebung gerichtet ist[71]. Da nämlich jede arglistige Täuschung oder widerrechtliche Drohung bei Vertragsschluss tatbestandlich zugleich eine Pflichtverletzung darstellt, wäre nach dem Grundsatz der Naturalrestitution der Zustand herzustellen, der ohne das schädigende Ereignis jetzt bestehen würde (§ 249 I). Ohne die Täuschung bzw. Drohung wäre der Vertrag aber nicht geschlossen worden.
94
Gleichwohl ist die Anwendbarkeit des § 280 I 1 problematisch, da die Jahresfrist des § 124 durch die dreijährige Verjährungsfrist des § 195 unterlaufen würde[72]. Dass die schon bei leichter Fahrlässigkeit (§ 276 I) mögliche Haftung aus culpa in contrahendo verjährungsmäßig besser gestellt wird als die vorsätzliches Handeln voraussetzende Anfechtung nach § 123 wird z. T. als wertungswidersprüchlich angesehen[73]. Der Bundesgerichtshof hält die Regeln der c. i. c. dennoch für anwendbar, hat dies jedoch in einer neueren Entscheidung präzisiert: Nur wenn unter Zugrundelegung der Differenzhypothese eine Vermögenseinbuße im Sinne eines Schadens vorliegt, kommt ein Anspruch aus §§ 311 II, 280 I 1, 241 II wegen Pflichtverletzung neben § 123 I in Betracht[74]. Anders argumentiert ein Teil der Lehre: Der Anspruch auf Vertragsaufhebung sei auf Naturalrestitution gerichtet, die mitnichten auf Vermögensschäden limitiert sei, zumal § 253 eben nur die Geldentschädigung ausschließe[75].
95
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass § 311 II Nr. 2 neben den Rechten und Rechtsgütern auch die Interessen des einen Teils aufzählt. Mit diesen ist insbesondere die Entscheidungsfreiheit angesprochen, die beim unerwünschten Schuldvertrag tangiert ist. Die Nennung der Interessen in § 311 II Nr. 2 stellt klar, dass die culpa in contrahendo das einschlägige Institut für den Schutz vor dem unerwünschten Vertrag ist.
Die Konkurrenz von culpa in contrahendo und Anfechtung nach § 123 soll unser Fall 10 illustrieren: M benötigt dringend einen Kredit. Seine Frau F soll sich bei der Bank dafür verbürgen. Der Sachbearbeiter S sagt F, ihre Unterschrift sei „nur für die Akten“, obwohl ihm klar ist, dass die Bank F gegebenenfalls voll in Anspruch nehmen wird. F unterschreibt im Vertrauen darauf, dass es sich um eine reine Formalität handelt. Kann sich F von ihrer Erklärung lösen?
96
1. Die Bürgschaft nach § 765 könnte infolge arglistiger Täuschung (§ 123 I Fall 2) nach § 142 I nichtig sein. S hat die F über die Bedeutung der Unterschrift getäuscht[76]. Die erforderliche Kausalität liegt vor, weil F daraufhin unterschrieb. Die Anfechtung ist auch nicht nach § 123 II ausgeschlossen, weil S gleichsam „im Lager“ der Bank stand und somit kein Dritter im Sinne dieser Vorschrift war[77].
97
2. Denkbar ist weiterhin ein Anspruch der F auf Vertragsaufhebung aus §§ 311 II, 280 I 1, 241 II. Zwischen F und B besteht ein Schuldverhältnis i. S. d. § 311 II. Die arglistige Täuschung stellt auch eine Pflichtverletzung dar. Die Pflichtverletzung und das Verschulden des S müsste sich die B nach § 278 S. 1 zurechnen lassen. Gemäß § 249 I könnte danach die Vertragsaufhebung verlangt werden, da F den Vertrag ohne die Täuschung nicht unterschrieben hätte.
98
Problematisch ist allerdings, ob der Anspruch aus der Pflichtverletzung nach § 280 I 1 neben § 123 I anwendbar ist, weil dadurch die Frist des § 124 II 1 unterlaufen werden könnte[78], zumal die Pflichtverletzung bereits bei leichter Fahrlässigkeit einschlägig wäre und damit das Vorsatzerfordernis des § 123 I ausgehebelt werden könnte[79]. Die Frage ist umstritten: Die Rechtsprechung hält die culpa in contrahendo neben § 123 I für anwendbar[80]. Der Bundesgerichtshof hat dies noch einmal unter Hinweis darauf bekräftigt, dass § 123 I die Entschließungsfreiheit schütze, während der Schadensersatzanspruch aus § 280 I 1 das Vermögen betreffe[81]. Voraussetzung sei allerdings, dass unter Zugrundelegung der Differenzhypothese auch ein Vermögensschaden bei F entstanden sei[82]. Fraglich ist also, wie sich die Vermögenslage ohne den Vertrag entwickelt hätte. Falls sich dabei ein rechnerisches Minus in der Form ergibt, dass der Vertragsschluss für den Betroffenen wirtschaftlich nachteilig ist, liegt neben der arglistigen Täuschung zugleich eine c. i. c. vor[83].
99
Das ist hier zu bejahen, weil die F durch die Inanspruchnahme aus der Bürgschaft, einem für sie nachteiligen Vertrag, empfindliche Vermögensnachteile zu befürchten hat, denen kein entsprechender Vorteil gegenübersteht. Demnach liegt hier auch ein Anspruch aus §§ 311 II, 280 I 1, 241 II vor.