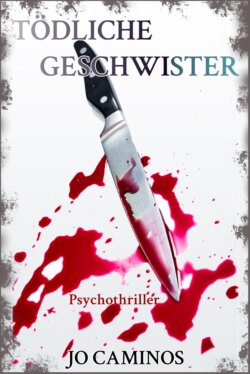Читать книгу Tödliche Geschwister - Jo Caminos - Страница 10
6. Kapitel
Оглавление
„Tobey McDuncan, ich sag´s dir nicht noch einmal! Schaff den Müll endlich runter! Jetzt! Nicht irgendwann. Hörst du?“
Tobey verdrehte die Augen. Seine Mutter hatte mal wieder einen ihrer berühmt-berüchtigt schlechten Tage. In der Bar war es offenbar nicht so gut gelaufen: zu wenig Trinkgeld, zu viele fiese Kerle, die ihr an die Wäsche wollten. Wahrscheinlich hatte sie irgendein schmieriger Kerl angemacht und mit ihr nach Hause gehen wollen - kostenlos eine Nummer schieben. Oder zwei oder mehr … Es war immer das Gleiche.
Ich muss hier raus!, durchfuhr es ihn. Hier in L.A., das war die Hölle auf Erden. Eine heruntergekommene Bude, die seine Mutter Wohnung nannte, wo niemals Ruhe herrschte, wo immer Irgendeiner der Scheißnachbarn nervte. An Carlo und seine Gang wollte er gar nicht erst denken. Einmal zu oft war Tobey von Carlo Moretti und seinen Jungs in die Mangel genommen worden. Das passiert Außenseitern halt so, hatte sich Tobey selbst vertröstet, wenn er im Dreck gelegen hatte und Carlo breitbeinig über ihm stand. „Na, McDuncan, mal wieder über deine Füße gestolpert …?“ So oder ähnlich hatte es zu viele Szenen gegeben, an zu vielen Tagen. Tobey war schon immer ein Außenseiter gewesen - das verzärtelte, träumerische Bübchen, wie ihn sein Vater immer genannt hatte. Vielleicht war ja wirklich etwas dran. Es spielte keine Rolle, denn sein Vater - wenn er denn sein richtiger Vater war, bei seiner Mutter konnte man da nie so richtig sicher sein - hatte schon lange die Flatter gemacht.
Ich bin Künstler! Das wusste Tobey schon seit einer kleinen Ewigkeit. Er musste hier raus! Weg von seiner Mutter! Weg von dem ganzen Müll, mit dem er hier tagtäglich konfrontiert wurde. Es erstickte ihn langsam, es brachte ihn um. Heute war es so weit. Heute würde er die Stadt verlassen und alles hinter sich lassen. Er hatte eine kleine Ewigkeit für den kleinen japanischen Wagen gespart, der im Hinterhof stand. Sein Koffer mit den wenigen Sachen, die er mitnehmen würde, lag schon im Kofferraum. Und genau mit dieser Schrottkiste würde er nach Las Vegas aufbrechen. Bis dorthin würde es die Kiste hoffentlich noch schaffen. Tobey glaubte fest daran, dass er in Las Vegas ganz groß herauskommen würde. Es musste ganz einfach so sein. Hier - das war kein Leben, das war nur ein sinnloses Dahinvegetieren von einem Tag in den nächsten, ohne Aussicht auf Besserung.
Las Vegas war schon immer sein Traum gewesen. Er wollte wie Elvis sein - oder all die anderen Stars, die in Las Vegas eine Millionengage einstrichen und ein Leben in Saus und Braus führen konnten. Er hatte Talent, mehr vielleicht als so mancher etablierte Star, das hatten ihm viele seiner Lehrer attestiert, selbst jene, die ihn nicht leiden mochten, und das waren nicht wenige.
„McDuncan, du kannst nichts, aber singen, das muss ich dir lassen, das kannst du!“, hatte die widerliche Miss Miller mehr als einmal mit einem sarkastischen Lächeln zu ihm gesagt. Carol Miller, die graue Maus mit der spitzen Zunge. Keiner an der Schule mochte sie - mehr noch, die Miller war gefürchtet. So klein, wie sie war, so giftig konnte diese Natter werden.
Ja, dachte Tobey McDuncan. Ich werde singen. Singen und tanzen in einer Las Vegas Show. Und danach werde ich die ganze Welt erobern, ein Star sein, reich und berühmt. Ein Megastar …
„Was ist jetzt mit dem Müll?“, brüllte seine Mutter vom Balkon herunter. „Träumt der angehende Weltstar von der Müllpolka, oder was? Setz deinen gottverdammten Hintern in Bewegung. Du bist schon genauso ein Lahmarsch wie dein Vater. Ach, fahr doch zur Hölle!“ Seine Mutter knallte das Fenster zu. Irgendein Nachbar brüllte: „Schlampe“, ließ sich aber nicht blicken. So mutig war der Gute also doch nicht …
Tobey ignorierte beide. Es war die Regel hier im Viertel. Keiner mochte keinen, und jeder würde jedem zu gerne an die Kehle gehen. Tobey ertrug seine Mutter nicht mehr. Wenn er ehrlich mit sich war, war das niemals anders gewesen - und wenn doch, dann konnte er sich nicht mehr daran erinnern. War sie eine gute Mutter - gewesen? Damals, als er Kind war? Nein, war sie nicht! Aber früher war sie wenigstens hübsch, daran konnte er sich noch erinnern. Doch jetzt war sie nur noch eine Frau, deren beste Jahre schon seit einer Ewigkeit hinter ihr lagen: zu stark geschminkt, ständig eine Zigarette im Mundwinkel, Lockenwickler im Haar. Nein, Tobey wollte nicht mit seiner Mutter streiten; mit überhaupt niemandem hier. Es machte keinen Sinn. Heute Abend würde er sowieso weg sein. Wenn alles so lief, wie er es geplant hatte, würde er diese Frau - seine Mutter - niemals wiedersehen. Er hatte noch nicht mal eingeplant, irgendwann an ihrem Grab zu stehen, dafür verband sie einfach zu wenig - und das nicht erst seit gestern.
„Hey, McDuncan!“
Tobey, der den Mülleimer in den Container ausgekippt hatte, drehte sich um. Die Stimme gehörte Lorenzo, ein kleiner Hispano mit einer Gehbehinderung, der im Nachbarhaus wohnte. Sie beide waren immer gut miteinander ausgekommen, auch wenn es nie zu einer echten Freundschaft gereicht hatte, was wohl daran lag, dass Lorenzo stockschwul war und auf ihn stand. Nicht, dass Tobey Vorurteile gehabt hätte, aber Lorenzo war ihm mehr als einmal etwas zu sehr auf die Pelle gerückt. Offensichtlich machte er sich immer noch Hoffnung, dass vielleicht doch noch was aus ihnen beiden werden könnte.
Nicht in diesem Leben, sagte sich Tobey. Er nickte dem kleinen Mann zu. „Hi, Lorenzo, was steht an?“
Lorenzo humpelte näher und begutachtete dann kritisch das alte japanische Auto, das sich Tobey zugelegt hatte: ein ziemlich mitgenommen aussehener Honda Civic in ehemals Rot - oder so. Er enthielt sich allerdings eines Kommentars, obwohl die Dellen und Roststellen einem förmlich ins Auge sprangen.
Lorenzo stützte sich am Wagen ab und ächzte kurz. „Carlo und die Gang sind heute schlecht drauf, Tobey. Ich glaube, die haben es auf dich abgesehen. Hab so was läuten hören. Also, pass auf! Carlo hat einen aus seiner Gang bei einer Messerstecherei verloren. Der Arsch kocht innerlich. Du weißt, was das für dich heißt …“
Tobey winkte ab. Heute Abend bin ich sowieso weg! Aber das würde er Lorenzo nicht sagen. Genauso wenig wie seiner Mutter. Sie würde erst wieder von ihm hören - wenn überhaupt - wenn er ein Star war. Oder vielleicht besser doch nicht: Nachher würde sie noch Geld von ihm verlangen und ihn verklagen. „Oh Herr Richter, ich arme, ich gute, ich perfekte Mutter - dieses Kind war eine Plage. Und dann noch der Vater …“
Tobey wusste nur zu genau, was für eine geldgierige Schlange seine Mutter sein konnte. Sie hatte es fertiggebracht, sein Sparschwein zu plündern, in das Grandma Martha immer etwas hineingeworfen hatte. Arme Grandma, kein Wunder, das du schon lange im Grab liegst, bei der Tochter … Tja, leider gab es bei dir nichts zu erben. Und da sind deiner Tochter doch bei der Testamentseröffnung tatsächlich die Gesichtszüge entglitten. „Nichts!“, hatte seine Mutter gegiftet, als das Testament verlesen wurde. „Nichts!“ Dann hatte sie Tobey bei der Hand gepackt und ihn hinter sich her weggeschleift. Niemals hatte er danach irgendjemanden von seiner Verwandtschaft je wiedergesehen. Ach ja, einen Monat später war es wohl, als sein komischer Vater sich dann auf und davon gemacht hatte. So war das halt, im Leben der McDuncans …
„Danke für die Warnung, Lorenzo. Ich werde schon auf mich aufpassen.“
Lorenzo wischte sich über die Stirn. Der Sommer war mörderisch. L.A. brannte an etlichen Stellen. Nach wie vor war keine Wetterbesserung vorhergesagt, kein Regen in Sicht. Die Schwüle schien zwischen den Häusern zu stehen und machte die Menschen aggressiv.
„Hast du Lust auf ein Bier. Nachher bei mir? Ich habe auch noch ein paar neue DVDs … frisch downgeloadet aus den besten Quellen. Sind auch ein paar Pornos dabei. Keine Sorge, nicht nur Homozeugs - ist auch was für dich dabei.“
Tobey verdrehte die Augen. „Och, Lorenzo. Lass es doch bleiben, ich …“
„Hey!“ Lorenzo hob beschwichtigend die Arme. „Soll keine Anmache sein, wirklich nicht. Nur ein Bier unter Freunden - oder zwei - völlig ohne Hintergedanken. Ich hab´s mitbekommen, dass du nicht auf mich stehst. Also, was ist?“
Tobey schüttelte den Kopf. Komm, ratsche eine Lüge raus, das kannst du doch, das hast du doch gelernt …! „Nein, ich muss nachher noch ins Diner. Samy ist krank geworden. Ich muss für sie einspringen, sonst schmeißt mich Elroy raus. Ich brauche das Geld.“ Tobey sah hoch zum Fenster, doch seine Mutter ließ sich nicht blicken. Aber garantiert hatte sie gelauscht. Sie mochte Lorenzo nicht. „Widerliche Schwuchtel! Da könnte ich ja nur noch kotzen bei so einem Perversling …“ So oder ähnlich hatte sie sich mehr als einmal über Lorenzo ausgelassen.
Lorenzo zuckte resigniert die Achseln. Fast tat er Tobey leid. Lorenzo war kein schlechter Kerl. Vor allem war er einsam. Und die Chancen, jemals hier aus der Gegend herauszukommen, standen mehr als schlecht für ihn. Wenigstens ließen ihnen die Gangs in Ruhe. Aufgrund seiner Behinderung galt er fast als unberührbar. „Ah. Also kein Bier … Okay.“ Lorenzo lächelte verkniffen. „Ich geh dann wieder hoch. Aber - falls du nachher doch noch Lust auf ein Bierchen haben solltest, kannst du gerne bei mir klopfen. Bei der Hitze kann doch kein Schwein schlafen.“
Er kann es nicht lassen! Tobey lächelte. „Wird spät bei mir werden, Lorenzo, aber schauen wir mal. Also dann, bis dieser Tage.“ Oder irgendwann …
Tobey sah Lorenzo nach, wie er zurück zu dem Seiteneingang des Mietshauses humpelte und kurz darauf darin verschwand. Irgendjemand knallte ein Fenster zu. Ein Mann schrie seine Frau an, sie kreischte zurück. Urban Life, dachte Tobey. Oder nannte man das Hölle auf Erden?
Carlo und die Gang haben es also wieder auf mich abgesehen! Tobey schlug innerlich ein Kreuz. Der Tag für seinen Absprung hier aus L.A. hätte nicht besser gewählt sein können. Doch er schwor sich, dass dieser Arsch von Carlo Moretti irgendwann seine verdiente Abreibung bekommen würde. Nicht heute, aber irgendwann bestimmt. Nichts war vergessen. Nicht die Schläge auf dem Schulhof, nicht die Demütigungen in der Mensa - gar nichts. Vor allem brauchte Tobey Geld - Geld und Ruhm. Vielleicht würde sich Carlo ja einen Strick kaufen, wenn er mitbekäme, dass der kleine, schmächtige Tobey McDuncan zum neuen Superstar in Vegas avanciert wäre. Ja, der Gedanke gefiel Tobey.
Hätte er gewusst, was ihn in nicht allzu ferner Zukunft erwarten sollte, wären ihm die Schikanen von Carlo und seiner Gang wie ein sanfter Windhauch erschienen - ein laues Lüftchen, mehr nicht.
Aber das konnte er nicht wissen.
Tobey McDuncan lächelte, als er gegen acht Uhr abends L.A. über die Interstate 15 verließ. Las Vegas war nur ungefähr 269 Meilen bzw. 433 Kilometer entfernt. Das würde selbst seine alte japanische Karre schaffen. Und dort in Las Vegas erwartete ihn ein neues Leben, eine Zukunft, die nichts mehr mit dem Hier und Jetzt in L.A. zu tun haben würde. Er freute sich auf Charlene, die er in einem Online-Chat kennengelernt hatte. Sie würde ihm in Vegas weiterhelfen. Und - vielleicht würde ja was aus ihnen. Er jedenfalls fand sie unglaublich süß.
Tobey lag mit seinen Gedanken nicht so ganz daneben. Bald schon würde sich sein Leben vollkommen verändert haben, doch leider nicht nur zum Schönen und Guten…