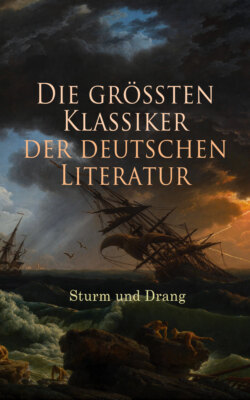Читать книгу Die größten Klassiker der deutschen Literatur: Sturm und Drang - Johann Gottfried Herder, Christian Friedrich Hebbel - Страница 170
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IX.
ОглавлениеInhaltsverzeichnis
Die Frage wird weltlicher.1 Können Dichter, die nicht über Sachen der Religion dichten, die Mythologie brauchen? Ich thäte am besten, blos zu übersetzen; aber auch das wird mir schwer. Wer kann einen Mann ertragen, der die Mythologie nicht anders kennet, als daß es »Griechen und Römern so beliebt,2 Neptun einen Gott des Meeres zu nennen,« als daß es »den Wiederherstellern der Wissenschaften so beliebt,3 auch die Mythologie der Alten (ohne weitere Gründe,) beizubehalten:« als daß sie »auf dem Irrthum und dem Aberglauben4 der Alten beruhe:« als daß sie »nichts als ein Namenregister,5 Schälle ohne Gedanken enthalte,« als daß sie6 »ein bloßer Flitterstaat mittelmäßiger Köpfe sey, um ihre Gedichte mit hundertmal gebrauchten Gleichnissen aufzustützen:« wer die Mythologie in Gedichten blos als so Etwas kennet, wie ist der eines Bessern zu belehren? Man müßte vom Anfange anfangen, daß von Homer bis zu Virgil noch etwas anders in dem Gebrauch ihrer Mythologie liege, als böse Irrthümer und unchristlicher Aberglauben – nämlich sehr Poetische Ideen. Und so hätte man erst eine Voraussetzung!
Darauf wäre zu zeigen, daß von den Wiederherstellern der Wissenschaften die Mythologie noch etwa anders woher habe können beibehalten werden, nicht als ein beliebiges Gutachten. Vielleicht nämlich der Sprache, der Kunst, der Poesie, und alten Einkleidungen der Platonischen Weisheit wegen. Ob sie sie übel nachgeahmet: davon ist die Rede nicht, sondern ob sie sie nachahmen dörfen? Und wer weiß es da nicht, daß wir nothwendig mit der bösen irrigen Mythologie zugleich alles hätten verlieren müssen: Sprache, Poesie, Wissenschaft, Kunst der Alten – eine schwere Verbannung! Wir wollen den irrigen, abergläubischen Ketzer dulden; denn mit ihm hätten wir, wie die Christen zu Julians des Abtrünnigen Zeiten, zu viel verlohren! Das wäre die zweite Voraussetzung.
Hieraus würde auch die Erstaunensvolle Frage beantwortet: warum dies böse Ding, das doch blos auf dem Irrthum und Aberglauben der Alten beruhet, habe beibehalten werden können? eine Blindheit, die Jahrhunderte durch gedauret! Es wäre also unmaßgeblich zu zeigen: »daß die Mythologie in ihrem Gebrauche wohl etwas mehr, als Schall ohne Sinn, Worte ohne Bedeutung, unnützer Flitterstaat, Gottlosigkeit und Aberglauben gewesen sey und seyn könne.« Wie tief muß eine solche Deduction anfangen! Und was hat unser Christliches Taufwasser mit dem ganz andern Werke zu thun, in einer sehr bekannten, sehr Ideen- und Bilderreichen Sprache Poetische Zwecke zu erreichen?
Freilich könnte es eine feine Aufgabe bleiben: »wie weit wir im Gebrauche mancherlei Mythologischer Ideen den Griechen und Römern nur bescheiden nachtreten müssen?« Mein hieran ist bei meinem Autor, und bei dem berühmten Vorredner Apollodors nicht zu gedenken; hier kommt auch nichts weniger, als Irrthum und Aberglaube, in Betracht: die bei ihm alles sind. Gnug! daß es ihm beliebt, in allen neuern Dichtern die Mythologie für schallenden Unsinn, für hundertmal gebrauchten Flitterstaat zu erkennen, und nun frage ich jeden guten Dichter unsres Vaterlandes: ist so Etwas nicht unter der Kritik?
Wie aber, wenn Hr. Kl.7 uns einen ganz neuen Ersatz der Mythologie gäbe? – Ehe wir sein neues Geschenk preisen, so lasset uns erst sehen, ob es der Annahme werth sey, und denn erst, ob es als Aequivalent gelten könne? »Was einige befürchten, daß, wenn sie die alte Mythologie verlören, ihre Verse kalt und matt werden dörften – die Furcht ist vergebens. Liefert uns doch unsere heutige Welt solch eine Menge neuer Gedanken und Bilder, daß es einem glücklichen Kopfe nie an Zierrathe seiner Gedichte fehlen kann« (eben als wenn ein glücklicher Kopf den Bettel wollte und brauchte!). »Bedenke, wie manches in der Naturlehre durch die Bemühung der Menschen jetzt entwickelt ist, was vormals entweder unbekannt, oder sehr dunkel seyn mußte. Bemerke ferner, daß der Kreis der Erde in neuern Zeiten gleichsam erweitert sey, durch Entdeckung der Länder, die vormals unbekannt waren, und erwäge, welch eine Menge Zierrathen dem Poeten daraus erwachse, weit besser, als die Namen einer Juno, Pluto, Cerberus, Rhadamantus und Charon.« Ich weiß, daß dieser Rath in die Köpfe mehrerer ingeniosorum gekommen: denn Rathgeben, sagt Plato, ist doch eine Göttliche Sache; und gegebene Rathschläge prüfen, dächte ich, noch eine Göttlichere.
Ich setze voraus, daß hier die Frage nichts weniger, als Wortzierrath, Dichterischen Schmuck betreffe, denn jeder Zierrath, der nicht aus der Sache selbst entspringet, der erst gesucht werden muß, ist Fehler; wir suchen also eine innere Bereicherung der Poesie in ihrem Wesen statt der Mythologie.
»Entdeckungen der Naturlehre!« Allerdings! wenn sie so bekannt, so fähig der Poetischen Sprache, so reich an Bildern, so anschaulich sind – als die Mythologie; allerdings! So verschwinde jene, wie Schatten gegen die Sonne, wie Fabel gegen die Wahrheit: und die Schöpfung eines Newtons, Neuentyts, Swammerdams, Buffons, Reaumurs, Tourneforts und Hallers trete an die Stelle des Fabelkrams eines Apollodors, oder Nata lis Comes. Aber zu welcher eigentlichen Function soll sie dahin treten? Einzelner Gleichnisse, Bilder halber? Mit Vergnügen erinnere ich mich zwar der seligen Augenblicke, die mir die tiefen Naturgleichnisse eines Hallers, die unerwarteten Arzneigleichnisse eines Witthofs, der fast ganz aus dieser Welt von Wissenschaften gedichtet, die fast immer ökonomischen Bilder eines Dyers gebracht haben; aber mit Misvergnügen auch der unseligen Augenblicke, die mir die gelehrt seyn sollenden Gleichnisse eines Curtius u.a. erwecket. Blos als Gleichnisse betrachtet, sind die Offenbarungen der neuem Naturkunde lange nicht so des Lichts der Anschauung fähig, oft so schwer poetisch und ohne Kunstsprache auszudrücken: so oft über die Sphäre des common sense unsrer Zeit, für welchen doch Gedichte geschrieben werden müssen, erhoben: so oft für diesen ohne Commentar dunkel, und wer will über ein Gleichniß denn einen Commentar lesen? endlich weit seltner an die eigentlichen Gegenstände der Poetischen Welt gränzend, um ein Drittes der Vergleichung zu haben, das beide nahe zusammenbringe – und das waren sie blos als Gleichnisse. Gleichnisse aber sind höchstens in Lehrgedichten das Wesen der Poesie: Gleichnisse aber sind gewiß nicht der wichtigste Gebrauch der Mythologie: Gleichnisse also machen hier keinen Gegensatz, nicht die Mythologie un nöthig, nicht die Naturlehre zur Mythologie.
Fabel, Dichtung, Handlungen, die bis zur Täuschung eindringen, sind das Wesen der Dichtkunst, und wie weit weniger kann hier die Naturlehre zutragen? Kann sie der Epopee und Heldenoper Maschinen schaffen, die mit der Individualität, mit der hohen und schönen Natur, mit der charakteristischen Bestandheit, mit der bekannten Anschaulichkeit, mit der Täuschungsgabe handeln können, als in Homer die Götter der Mythologie handeln – wohlan! so treten Gnomen und Sylphen, und Nymphen und Salamanders, die ganze Schöpfung des Theophrastus Paracelsus, und Cornelius Agrippa, die personifiirte ganze Naturkunde in die Stelle Mythologischer Wesen. Kann sie dem Drama, der Pindarischen und Horazischen Ode, der Fabel, der Erzälung, der Idylle so viele, so schöne und so reiche Dichtung schaffen, als die Mythologie der alten Dichter diesen Gattungen schuff, so trete sie auf. Hier lasse ich meine Leser mit aller Gemächlichkeit alle Dichter des Alterthums in allen Arten der Dichtkunst, und in jeder ihre glücklichen Fictionen aus dem Vorrathe der Mythologie – nachzählen: alle neuere Dichter, die aus dieser Quelle, es sey auf was Art es wolle, glücklich geschöpft, bis auf unsern lieben warmen Wieland zu – alsdenn überschlage er, ob ihm das alles Naturkunde ersetzen könne, und thue den Ausspruch. Meines Wissens giebt diese einzelne Begriffe, Känntnisse, Wissenschaft; die Poesie will Geschichte, Handlungsvolle Begebenheiten, täuschende Fabeln – welche beide Ende!
Ich sage nicht, daß nicht aus der Naturkunde unsre Dichtkunst noch sehr mit Wahrheiten und Bildern bereichert werden könne, daß aus diesen Wahrheiten und Bildern von einem Poetischen Kopfe nicht so glückliche Fictionen geschaffen werden müßten, als ein Fontenelle über die Wirbel des Des-Cartes witzige Einfälle dichten konnte – aber daß diese mögliche Ausbeute dem unzählbaren Reichthume Mythologischer Dichtungen und Geschichte und Fabeln je gleichkommen, daß sie denselben völlig überlei machen könnte, das leugne ich völlig! Aus der Mythologie eben lerne man, die Naturkunde dichterisch zu bilden, nicht aber aus der Naturkunde die Mythologie zu verbannen.
Zweitens: »neuere Entdeckungen neuer Länder und Welten!« und was haben uns diese für die Dichtkunst entdecken lassen, das der Mythologie gleich gölte? Bäume und Pflanzen? So viel ein Indianischer Plinius, ein Rumph, eine Merian u.a. die Welt des Kräuterkenners, und den Begrif der Schöpfung Gottes erweitern: so viel Vergnügen und Nutzen man in einem Malabarischen Garten finde; so doch das wenigste zum Gebrauche der wahren Dichtung. Die Namen der neuen Kräuter sind unpoetisch; ihre Gestalt und Unterschied nicht durchgängig bekannt, nur der Zeichner, nicht der Wortmaler, kann sie anschauend sinnlich machen. Zudem sind solche Brockessche Malereien ja nicht Hauptzwecke der Dichtkunst, und was z.E. der Verfasser des Zuckerrohrs Poetisches in sein Poem gebracht, ist dem mindsten Theile nach aus der Pflanze selbst gepreßt; es ist Ausschweifung.
So Gegenden? Außerordentlich wilde Gegenden, Wüsten, Gebirge, Wasserfälle sind rührend, aber nur so fern sie bekannte Ideen wecken, die uns schon beiwohnen. Ich würde Niagarens Wasserfall in Creuz nicht so fühlen, wenn ich nicht schon rauschende Wasserfälle kennete, und hier blos meine Begriffe steigen dörften. Schlechthin neue Beschreibungen gewähren also diese Entdeckungen kaum: denn ob der alte Grieche und Römer die Wasserfälle des Nils, den Euripus, den Olympus, die Scylla und Charybdis mir über historische Wahrheit erhoben, ist nicht die Frage, nur ob er sie mir täuschend gedichtet? und von ihm also lerne man auch die neuerlicher bekannten Gegenden – Grainger seinen Amerikanischen Platzregen, und andre ihre feurigen Luftmeteore dichten; (denn nach historischen Bildern suche ich in Reisebeschreibungen) und fänden da die meisten solcher Scenendichtungen in den Alten, nur nach Beschaffenheit ihres Landes nicht schon Vorbilder? Wie feierlich ward aus dem Aetna die Werkstatt der Cyklopen, aus der Gegend bei Pozzuolo der Acheron, aus den Thessalischen Gegenden die Berge der Musen, aus den Inseln des Möris die Elysäischen Felder u.s.w. In Landgemälden mögen wir also neu seyn, im Geiste des Poetischen Landmalens, in Dichtungen darüber müssen wir von den Alten lernen. Dazu ist ihre Mythologie: ich sehe sie also nicht entbehrlich, ich sehe nicht einmal, recht genommen, einen Gegensatz.
»Vielleicht also neue Thier- und Menschen-Gattungen?« Gut! aber in die Naturgeschichte gehören diese besser, als in die Poesie; und wenn auch für diese, als Gegenstände, Bildergleichnisse – was trift dieses die Mythologie zum Gegensatze? Eine Fabel, eine Poetische Dichtungslehre ist ja kein Bildersaal Griechischer Thiere, Menschen, Pflanzen, Gegenden – beide heben sich noch nicht auf; vielmehr kann die Mythologie Muster bleiben, in dieser neuern Thierwelt zu dichten.
Soll es Gegensatz werden, so muß die neuentdeckte Welt uns statt der Griechischen eine Gallerie solcher und besserer Fabeln, Geschichte, Dichtungen liefern. Die Hottentottische Götterlehre, Kunstbegriffe, Historien, Gedankeneinkleidungen müssen an die Stelle der Griechischen treten. Der Pachakamai der Peruaner wird Zevs, der Chemiin der Caraiben wird der große Pan, und der Areskovi der Huronen der schöne Apollo. Statt der schönen Genien der Griechen wollen wir die Hondatkonsonas der Iroquoisen, und statt der edlen, Poetischreichen und schönen Fabelverrichtungen der alten Homerischen Götter, ihrer Einwirkung in die Welt, und ihrer Thaten unter den Menschen wollen wir Fratzengeschichte der Africanischen Regern – welch ein Tausch! Und Tausch soll doch seyn? die neuentdeckte Welt soll uns doch das reichlich und überreichlich geben können, was uns die elende Griechische Mythologie giebt? Und was giebt diese für die Poesie anders, als Dichtungen, Geschichte, Fabeln, in die Poetische Composition gelegt wird, uns zu täuschen, zu vergnügen.
Hätten unserm Verf. richtige und genaue Begriffe vom Wesen der Poesie, und vom wesentlichen Gebrauche der Mythologie in der Dichtkunst der Alten beigewohnt: so würde er sich sein Edikt gegen diese, und seine Vorschläge zur Schadloshaltung jener, selbst erlassen haben. Jetzt rächt sich an ihm Kalliope, wie dort Bacchus am Lykurgus, da dieser seinen Wein ausrotten wollte; sie läßt ihn nämlich die Linie passiren, und schickt ihn nach Mohren und Malabaren, um, wie ein Orpheus und Homer aus Aegypten zurückzukommen, – der Vater einer neuen Poesie, die seit Griechen und Römer Zeiten nicht gewesen.
Non usitata, nec tenui ferar
Penna biformis per liquidum aethera
Vates, neque in terris morabor
Longius, invidiaque maior
Vrbes relinquam: non ego pauperum
Sanguis parentum, non ego – –
Stygia cohibebor unda.
Iam iam residunt cruribus asperae
Pelles et album mutor in alitem
Superne: nascunturque leves
Per digitos humerosque plumae.
Iam Daedaleo ocyor Icaro
Visam gementis littora Bospori
Syrtesque Gaetulas canorus
Ales, Hyperboreosque campos.
Me Colchus etc. c. Heil zur glücklichen Reise!
Drittens und endlich »Allegorie:8 Tugenden und Laster, diese und andre Gemüthsaffecten – wenn ihnen der Dichter Körper beileget, so wirb er theils auf allen Münzen und Edelsteinen, theils in Gedichten, welche finden, die er bequem gebrauchen kann;« und nun gehts in ein Register.
»Bequem gebrauchen kann?« Hr. Klotz beliebe zu sagen in welcher Gedichtart? In Epopeen? Nie können da Mes-Dames »Pudicitia, Fertilitas, Fides, Securitas, Copia, Justitia, Veritas, Voluptas, Ira, Discordia, Impudentia, Invidia u.s.w.« das ausrichten, was Homers Götter und Göttinnen wirken. Es sind Larven allgemeiner Begriffe, denen persönliche Bestandheit, individuelle Bezeichnung, historischer Charakter fehlt, bei denen man jeden Tritt aus dem Namen voraus sieht, die aus einem Worte, wie jene Prophetinnen, aus holem Bauche sprechen, Wortgespenster. Sie geben kein persönliches Interesse, keine individuelle Handlung, keine einzelne Charakterprobe: sie rühren nicht, sie täuschen nicht: sie zerspringen, wie Wasserblasen.
The earth hath bubbles, as the water has,
And these are of them. Whither are them vanished?
Also in Idyllen, Fabeln, Erzälungen, überall, wo es auf vorgestellte Fiction ankommt? Kaum! und eine lange Allegorische Dichtung, ein Allegorischer Traum macht mir in sonst vortreflichen Wochenblättern,9 wenn er nicht außerordentlich kurz ist, Kopfschmerzen. Wenn Allegorie Wahrheit einkleiden soll, damit sie mehr einnehme, und stärkern Eindruck mache, so muß sie dieselbe nicht verdecken, und den Augen wegstehlen. Das Frappante, das Außerordentliche im ersten Anblicke der Entwickelung gefällt, und läßt dauerhafte Spuren in der Seele; wird mir aber seitenlang die Mühe des Entwickelns zum ordentlichen Geschäfte gemacht; – soll ich nicht die Frucht hinter den Blättern unvermuthet erhaschen, sondern zum Tagwerke Blätter klauben, eine ganze Fiction hindurch die Allegorischen Masken entkleiden, und bei jedem Zuge neu entkleiden; warum ließ mich, da es hier blos auf Wahrheit und Mühe ankommt, der Dichter die Wahrheit nicht nackt sehen? ohne Mühe der Entkleidung? ohne langes Gesuch? Mitten im Allegorischen Traume unsrer Wochenblätter schlafe ich ein, und vielleicht viele Leser mit mir.
Nichts bleibt übrig, als kleine Gedichte, oder Einfälle in Gedichten: Bilder, Gleichnisse, Epigramme, Lieder, Oden – Bilder und Gleichnisse? wohl! und die alle Mythologie ist voll schöner Allegorien! Epigramme? Ein Epigramm ist ein Bon-Mot in der Dichtkunst, es gefalle durch seinen Stachel, oder seine außerordentliche Simplicität. Aber Lieder? Oden? Selten können lange durchaus Allegorische Lieder und Oden gefallen! Ich danke es Uzen, daß er mir seinen schönen Morpheus, als einen Traumgott, nicht als ein Allegorisches Gespenst der Träume, vorstellt. Ich danke es den Dichtern der Freude, und des Amors, daß sie diesem Gotte, dieser Göttin nicht, als Gespenstern eines abstrakten Begriffes, zu gut allegorisiren, sondern lieber einem Gotte der Liebe, einer Göttin der Freude zu Ehren singen. Jenes wird ein trockner Eichenkranz von symbolischen Prädicaten, dies eine Reihe von Empfindungen, die einem solchen gedichteten Wesen überhaupt geziemen – ein merklicher Unterschied!
Wenn Hagedorn der Freude singet, bleibet er freilich nicht mit jedem Zuge der Allegorie treu, und wollte es auch nicht bleiben. Seine Freude ist ihm eine Göttin, der das Vergnügen gefällt, nicht ein Allegorisches Gerippe derselben. Er kann sich also denken, daß sein Lied »dieselbe vergrößere, daß sie das Glück der Welt, die Kraft der Seele, das halbe Leben sei; daß sie die Vernunft erheitere, u.s.w.« Prädikate, die der Freude überhaupt zukommen, nicht aber dem personisiirten Begriffe derselben, der Freudengöttin, der Hagedorn frohe Empfindungen opfert, nicht dem Allegorischen Wortgemälde – –
Ramler hat sein Lied in ein solches Gemälde verändern wollen. Er löschte die Striche aus, die bei der Allegorischen Figur nicht Statt fanden; er that neue hinzu, die sie sichtbarer machten. Er gab der Freude Kinder, er machte sie selbst zum Kinde des Himmels, er verwandelte die Kenner, personneller in Dichter der Freude; er machte lieber eine lange Parenthese, ehe er diese mit einer andern Allegorischen Person, dem Glücke, hätte vermischen lassen; er gebot ihr die Gesellschaft unvernünftiger Bacchanten zu fliehen; – kurz! er blieb, in jedem Zuge, dem Bilde einer Allegorischen Person treu. Hat er das Lied verbessert? Als ein Allegorisches Poem, freilich; aber, als ein Gesang der Empfindungen, der Freudengöttin gesungen, ohne dieselbe ins Stamm- und Wapenbuch zu malen? – kaum! alle, wie mich dünkt, haben Ramlern getadelt, und keiner den Grund berührt, der ihn verführt habe, und ein Ramler wird nie ohne Grund irren. Will ich ein Allegorisches Lehrlied auf die Freude; so wähle ich Ramlern – will ich einen Freudengesang, der Freudengöttin gesungen, so Hagedorn!
Nur gar zu sehr ist Ramler ein Freund solcher Allegorien, und zerstört dadurch oft die Harmonie des Liedes. Gefühl ist der Ton der Lieder, und nicht eine Charakteristik Allegorischer Wesen, die, wenn sie einmal eine todte Symbole mitten in die Reihe Lyrischer Empfindungen hinein stößt, alles, wie Eis, erkältet. Hagedorn singt im Tone des sanftesten Abendvergnügens seinen Morpheus, die Wünsche, das Verlangen seines Herzens: Ramler nimmt eine Aegyptische Kohle, und reißt eine Hieroglyphe daraus. Die schwarze Hieroglyphe aber schreckt das Chor aller Abendfreuden aus einander: – –
Gott der Träume, Kind der Nacht,
Das mit Mohn in Händen
Gaukelnde Gestalten macht – –
Gnug! schön zu einer Devise auf ein Bild des Schlafes, nicht zum Lyrischen Gesange, nicht zu einem Hagedornschen Liede.
Sollte, in Gedichten der Liebe, Amor nichts, als die personificirte Liebe, das Abstractum dieses Begriffes in Allegorische Gestalt eingekleidet seyn – arme Dichter der Liebe! das Reich eurer Phantasie ist verwüstet. Nicht mehr der Mythologische Amor mit allen seinen Geschichtchen; eine Metaphysische Maske ist euer Gesang. Alsdenn z.E. sind die Jacobischen Tändeleien von Einem Amor, von diesem und jenem Amor, vom Amor, der Lerchen fängt, der jetzt verschwindet; jetzt uns eine Stunde Friede läßt; jetzt unvermuthet unter Schmiedeknechten beim Vorbeipassiren gefunden wird; jetzt, wie ein fliegendes Jucken in der Haut wiederkommt; fade. Alsdenn schrumpft das Reich erotischer Wesen in die wenigen steifen Herrlichkeiten ein, die Hr. Kl. von seinen Gemmen uns vorzält, und auch die sind nicht ohne Mythologische Züge – – Kurz! wenn Hr. Kl. seine Behauptungen nur halb überdacht, kaum hätte ers sich selbst verantwortet, den Mythologischen Achtsbann niederzuschreiben, der alle unsre Dichter aus seiner Poetischen Republik treibet. Ich hoffe, die Muse werde dem neuen Plato, für einen so bündigen Reichsschluß, sanfte Ruhe verliehen haben!
1 Epist. Homer. p. 124–135.
2 p. 124.
3 p. 125.
4 p. 125.
5 p.126.
6 p. 127.
7 p. 126.
8 p. 127. 128. etc.
9 Ich führe nur Eins an, den Rambler, eine Schrift voll Menschenkenntniß, und voll schläfriger Allegorien.