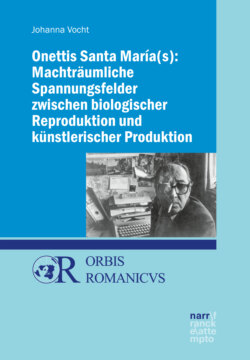Читать книгу Onettis Santa María(s): Machträumliche Spannungsfelder zwischen biologischer Reproduktion und künstlerischer Produktion - Johanna Vocht - Страница 10
Diskurs
ОглавлениеDie Vorüberlegungen, die zu Foucaults Diskursbegriff geführt haben, gehen zurück auf die zeitgleiche Publikation zweier sehr unterschiedlicher Monographien. Dies war einerseits die literaturwissenschaftliche Analyse des Gesamtwerks von Raymond Roussel (1963) und andererseits die Geburt der Klinik (1963). Was diese beiden, in Methodik und Wissenschaftsdisziplin so verschiedenen Publikationen eint, ist der Gedanke, eine Sache von ihrem Ende her zu betrachten, sprich: den Tod nicht als Ende, sondern als Schlüssel zum Verständnis zu begreifen. In der Geburt der Klinik (1963) ist das der Blick des Mediziners Xavier Bichat auf den Leichnam.97 Die Krankheit, und gleichsam auch das Leben, werden demnach erst im Stillstand des Todes sichtbar. Das Auge des Pathologen lasse sich dabei nicht von sprachlichen Vorgaben (d.h. von Dingen, die er bereits wissen muss, wenn er sie benennt)98, sondern vielmehr von einem Blick leiten, der die räumlichen Anordnungen der (gesunden wie kranken) Gewebe in einem Körper aufnimmt. Durch die Reihung und Vergleiche dieser Anordnungen und Muster gelange der Arzt zu einem Verstehen der Krankheit. Auch in der literaturwissenschaftlichen Studie gelinge das Begreifen der Texte erst durch ein posthum veröffentlichtes Supplement. Erst die Negation der Autorfigur und damit ein Stillstand, ein Abgeschlossen-Sein des Textes, öffneten dem/r Wissenschaftler*in den Zugang zum Werk. Sarasin expliziert das Verhältnis dieser beiden „Todes-Figuren“ in Foucaults Arbeiten folgendermaßen:
Das heißt nicht, dass dieser Tod bei Bichat und der Tod bei Roussel ein und dasselbe wären – aber es bedeutet, dass Foucault diese Figuren des Todes in seinen beiden am selben Tag erschienenen Büchern verdoppelt und analog setzt. Der Tod, das ist bei Roussel und bei Bichat ‚der einzige Schlüssel‘ […].99
Entscheidend für die Diskursanalyse ist also die Tatsache, dass eine Sache, die untersucht und verstanden werden soll, zum Zeitpunkt der Untersuchung dem zeitlichen Verlauf bereits entzogen wurde. „Die Diskursanalyse verlangt,“ so Sarasin, „[…] dass das Objekt der Analyse tot sei: Dass die Texte, die der Diskursanalytiker vor sich hat, nicht mehr vom Sinn der Tradition beseelt werden, sondern als kalte Formen vor ihm liegen und geöffnet werden können. Dann erst […] offenbaren sich die Bedingungen des Ereignisses […] der Aussage, zeigt sich das Individuelle, das, was […] historisch einzigartig ist.“100 Den „begrenzten Kommunikationsraum“101, von dem Foucault in diesem Zusammenhang spricht, bildet in vorliegender Arbeit Santa María. Allerdings bleibt darauf hinzuweisen, dass Foucault seine Diskursanalyse zur Erforschung wissenschaftshistorischer Phänomene begründete und damit ein empirisch vermessbares Feld bearbeitete. Die Literatur durch ihre per se vermittelte Gestalt, gelte daher als Sonderform.102 Sie bilde sozusagen selbst einen Diskurs ab – und die Metafiktion Santa María demnach einen weiteren, eigenen Diskurs. Denn (zumindest moderne) Literatur impliziere immer die Frage nach ihrem Ursprung, nach einer Autorschaft. So arbeitet Foucault in einem Vortrag aus dem Jahre 1969 heraus, dass die Figur des Autors ein Spezifikum der Moderne und damit historisch veränderlich sei.103 Diese Vermittlungsebene, die Literatur überhaupt erst hervorbringe, sei dabei selbst schon in ein Netz unterschiedlicher Diskurse eingebettet, die sie einerseits generiere und die sich andererseits selbst bedingten:
Die Grenzen eines Buches sind nie sauber und streng geschnitten: über den Titel, die ersten Zeilen und den Schlußpunkt hinaus, über seine innere Konfiguration und die es autonomisierende Form hinaus ist es in einem System der Verweise auf andere Bücher, andere Texte, andere Sätze verfangen: ein Knoten in einem Netz. […] Das Buch gibt sich vergeblich als ein Gegenstand, den man in der Hand hat; vergeblich schrumpft es in das kleine Parallelepiped, das es einschließt: seine Einheit ist variabel und relativ. Sobald man sie hinterfragt, verliert sie ihre Evidenz; sie zeigt sich nicht selbst an, sie wird erst ausgehend von einem komplexen Feld des Diskurses konstruiert.104
Foucault spielt in obigem Zitat auf die Komplexität und grundsätzliche Unabgeschlossenheit narratologischer Deutungsansätze an. Komplizierter noch werde die oben genannte Eingrenzung, so Foucault, wenn man sich auf das Werk eines Autors zu beziehen versuche. Denn die scheinbar einfache denotative Verbindung, die der Name des Autors zwischen Text und Person generiert, bedürfe zunächst einer interpretativen Praxis, wie er weiter ausführt. So gelte es genau zu definieren, welche Teile des „ganzen Gewimmel[s] sprachlicher Spuren […], die ein Individuum bei seinem Tod hinterläßt“105 nun tatsächlich als Werk zu bezeichnen seien. Foucault gibt keine abschließende Antwort auf diese dringliche Frage, was denn nun ein Werk sei. Die oben zitierte Passage verdeutlicht jedoch noch einmal, wie entscheidend die zeitliche und räumliche Eingrenzung des zu untersuchenden Diskursfeldes ist. Gleichzeitig illustriert sie die Problematik der Subjektzentralität, welche die moderne Literatur durch die Figur des Autors aufweise. Laut Sarasin sei „der Diskurs eine Praxis, in der Subjekte zugleich ihre Welt gestalten, wie sie dabei von den Regeln des Diskurses geleitet, beschränkt und dezentriert werden.“106 Foucaults Diskursanalyse sei eine deskriptive Methode, um bestimmte Aussagen an die Oberfläche zu bringen und aus ihrer Reihung eine spezifische Logik abzuleiten.107
Diskurse bilden demnach eine spezifische Wissensordnung ab. Dieses „immense[…] Gebiet“ konstituiere sich laut Foucault „durch die Gesamtheit aller effektiven Aussagen (énonces) (ob sie gesprochen oder geschrieben worden sind, spielt dabei keine Rolle) in ihrer Dispersion von Ereignissen und in der Eindringlichkeit, die jedem eignet […]“108. Diskurse bilden eine Ansammlung von Äußerungen, Verboten und Geboten und sind stets auf ein bestimmtes Wissensfeld bezogen, etwa die Medizin, die Ästhetik, die Gesellschaftspolitik etc. Foucaults Diskurs-Begriff ist also nicht auf die Sprache begrenzt, sondern weist darüber hinaus, d.h. er generiert sich ebenso aus dem Nicht-Gesagten, aus Handlungen und Verboten, die innerhalb einer bestimmten Gruppe oder innerhalb eines bestimmten Feldes praktiziert werden. Einzelne Diskurse können sich palimpsestartig überlagern, bestärken oder unterlaufen.109 Das heißt auch, dass ein bestimmter Diskurs als hegemonial betrachtet werden kann, er also eine bestimmte Dominanz über andere Diskurse ausübt. Diskurse bilden damit auch ein bestimmtes Machtgefüge ab, das sich wiederum auch räumlich verorten lässt. Foucault verwendet dafür den Begriff der Heterotopie.