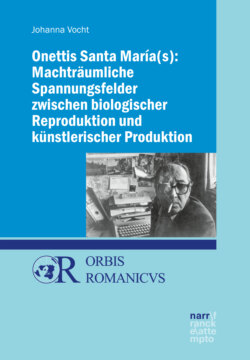Читать книгу Onettis Santa María(s): Machträumliche Spannungsfelder zwischen biologischer Reproduktion und künstlerischer Produktion - Johanna Vocht - Страница 18
„Formen und Funktionen diskursiver Stadtkonstitution“ nach Andreas Mahler
ОглавлениеIn seinem Aufsatz „Stadttexte – Textstädte“ (1999) verwendet Mahler den Begriff Stadttext als Kategorie des Ausdrucks, als „Kette der Signifikanten“, den Begriff „‘Textstadt‘ als dazugehörige Seite des Inhalts, […] als […] die Seite des Signifikats.“ Um einen Stadttext und die dazugehörige Textstadt handelt es sich dann, wenn eine „thematische Gebundenheit“ an den Untersuchungsgegenstand Stadt klar erkennbar ist. Die sanmarianischen Texte Onettis fallen klar in diese Kategorie, insofern Santa María darin nicht allein als Hintergrund oder Schauplatz dient, sondern „unkürzbarer Bestandteil des Textes“ ist.253 Mahlers Systematisierung zielt darauf, erstens „die Formen diskursiver Stadtkonstitution“, zweitens „die Gründe für die Produktion von Textstädten“ und drittens deren Funktion zu analysieren.254
Die diskursive Darstellung einer Textstadt erfolgte laut Mahler über unterschiedliche Konstitutionstechniken. Möglich sei dabei entweder eine direkte Referentialisierung, d.h. ein denominativer Verweis auf außerliterarisch verortbare Städte oder Stadtteile, oder eine indirekte Referentialisierung bzw. semantische Stadtkonstitution. 255 Letzteres sei der Fall, wenn eine Textstadt über bestimmte semantische Verweise, d.h. über die Bildung von Isotopien als städtisches Diskursuniversum erkennbar werde. Dabei sei zwischen Konstitutions- und Spezifikationsisotopien zu unterscheiden. Während sich Konstitutionsisotopien aus einzelnen Semantiken zusammensetzten, die den Begriff Stadt konstituieren, fächere die Verwendung spezifischer Semantiken den Begriff Stadt weiter auf bzw. verleihe ihm eine spezifische Qualität.256 So etwa die namenlose Stadt in Para esta noche (1943): Die dichte Beschreibung der Geschehnisse einer einzigen Nacht sind dort in einer Stadt verortet, deren isotope Beschreibung einen urbanen Kriegsschauplatz evoziert, wie er im 20. Jahrhundert in vielen westlichen Städten zu finden war.257
Bezüglich der Perspektive, aus der heraus die Stadt im Text artikuliert wird, unterscheidet Mahler zwischen interner (mit Bindung an eine Figur) und externer Fokalisierung (ohne Bindung an eine Figur) der Wahrnehmungsinstanz. Darüber hinaus zeige die Distanz zwischen dem beschriebenen Objekt und der Wahrnehmungsinstanz (etwa Vogel- oder Froschperspektive) die „Lokalisierung des wahrnehmenden Subjekts“258 an. Die „Mobilität der Wahrnehmungsinstanz“259 zeige sich hingegen in der Statik respektive Dynamik einer Perspektive. Ein dritter Aspekt der Modalisierung sei der „Grad [der] mentalen Synthesefähigkeit“260, d.h. handelt es sich um eine unkommentierte oder eine kommentierte Darstellung. Je nach Ausschlag der einzelnen Modalisierungstechniken unterscheidet Mahler zwischen einem „verfügungsmächtige[n] panoramatische[n] Blick auf die Stadt oder eine[r] zunehmend eingeschränkte[n], subjektgebundene[n] Stadtsicht“.261
In einem nächsten Schritt erläutert Mahler textinterne und textexterne Funktionen diskursiver Stadtgestaltung. Erstere diene dazu, eine Erzählung und die zugehörigen Figuren an einem bestimmten Ort zu situieren. Für die Besonderheit der Verortung in einem urbanen Szenario schlägt Mahler eine Skalierung der beschriebenen konstitutiven und modalisierenden Kriterien vor. Konkret differenziert er „den Grad der Universalität der Konstitutionsisotopie“, d.h. ruft ein Text semantisch eine ganze Stadt auf, handelt es sich um einen „globale[n] Typ“. Adressiert er eher Teilelemente davon, spricht Mahler von einem „partiale[n] Typ“. Der partiale Typ könne weiter hinsichtlich seiner Lage und seiner Reichweite systematisiert werden. So sei zu untersuchen, inwiefern der Text eine Stadt nur über ein bestimmtes Viertel, das Zentrum oder das Industriegebiet abbildet und wie groß der dargestellte Ausschnitt ist, d.h. handelt es sich bei dem Ausschnitt um den gesamten Stadtraum oder etwa nur um eine einzelne Wohnung innerhalb eines Stadtraums? Weiter ausdifferenziert werde die Einteilung in global oder partial darüber, ob eher direkte Referenzen, wie etwa der Stadtname oder die Namen einzelner Stadtteile, als bekannt voraussetzbarer Monumente oder Sehenswürdigkeiten abgerufen, oder ob auf diese Prototypik eher verzichtet werde.262 Hinsichtlich der Modalisierungsstrategien lasse ein panoramatischer, verfügungsmächtiger Blick auf einen globalen Typus schließen, eine eingeschränkte Wahrnehmungsperspektive eher auf einen partialen. Mahler leitet daraus ab, dass, „[j]e stärker konturiert die Konstitutionsisotopie, je präziser die Referenzen, desto geringer enthebbar [ist] die Stadt.“263 Analog dazu konstatiert er: „Je weniger prototypisch die Nennungen, je enger der Fokus, desto subjektiver, idiosynkratischer wird [die Stadt] sein.“264 Bezüglich ihrer semantischen Darstellung sei zwischen „homolog[…]“ und „widerständig[…]“ zu unterscheiden, d.h. stehen die verwendeten Spezifikationsisotopien im Einklang oder im Widerspruch zueinander? Je nachdem vermittelten sie ein geschlossenes oder ein ambivalentes Abbild.265
Die textexternen Funktionen diskursiver Stadtdarstellung gäben indes Aufschluss darüber, inwieweit bestimmte Themen, Motive und Diskurse die Darstellung einer Stadt im Text prägen oder gar überlagern. Die künstlerische Vermittlungsebene wird dabei als gegeben vorausgesetzt, d.h. eine Textstadt ist per se ein medial vermitteltes Konstrukt. Je nachdem in welchem Umfang eine Textstadt in der außerliterarischen Welt referentialisierbar ist, spricht Mahler von „Städte[n] des Realen“, Imaginären oder Allegorischen.266 Die Klassifizierung richte sich dabei nach der Ausprägung der jeweils verwendeten Konstitutionstechniken. „Städte des Realen“ wiesen sich durch einen hohen Referentialisierungsgrad aus, „Städte des Imaginären“ bestünden vornehmlich aus Konstitutionsisotopien und in „Städte[n] des Allegorischen“ überwögen die Spezifikationsisotopie. Letztgenannte begönnen „alles Städtische zu funktionalisieren […] zugunsten eines anderen Themas.“267
In der folgenden Analyse soll dementsprechend herausgearbeitet werden, welche textexterne Funktion Santa Marías in den einzelnen Text im Vordergrund steht bzw. wie sich die verschiedenen Darstellungen überlagern: Verhandelt Onetti Reproduktion und Elternschaft als dysfunktionale Systeme vor dem Hintergrund einer typisch lateinamerikanischen Provinzstadt oder werden bereits durch die unterschiedlichen diskursiven Darstellungen Santa Marías bestimmte Konflikte oder Themenfelder bezüglich Reproduktion und Elternschaft sichtbar? Auf diese Fragestellung hin sollen in diesem Kapitel die ausgewählten Texte in editionschronologischer Reihenfolge – die nicht zwingend eine erzählte Chronologie bedingt! – inhaltlich skizziert und in Bezug auf das Stadtmotiv untersucht werden.