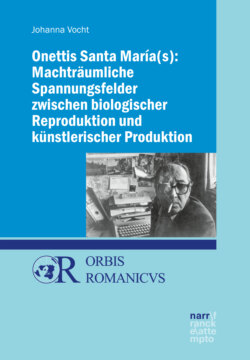Читать книгу Onettis Santa María(s): Machträumliche Spannungsfelder zwischen biologischer Reproduktion und künstlerischer Produktion - Johanna Vocht - Страница 15
2.4 Hegemoniale Männlichkeit
ОглавлениеAuch das Konzept der hegemonialen Männlichkeit entstand in Auseinandersetzung mit Foucaults Machtbegriff.170 In den wissenschaftlichen Diskurs eingeführt wurde es 1985 von den Soziologen Tim Carrigan, Robert Connell171 und John Lee in dem Aufsatz „Toward a new sociology of masculinity“ (1985). Breitere wissenschaftliche Rezeption erlangte es jedoch erst durch Connells nachfolgende und mittlerweile vielfach neu aufgelegte Klassiker der Gender-Studies, die Monographien Gender and Power (1987) sowie Masculinities (1995).172 Mit Rückgriff auf Antonio Gramscis Begriff der kulturellen Hegemonie definiert Connell hegemoniale Männlichkeit darin folgendermaßen:
The concept of ‚hegemony‘, deriving from Antonio Gramsci’s analysis of class relations, refers to the cultural dynamic by which a group claims and sustains a leading position in social life. At any given time, one form of masculinity rather than others is culturally exalted. Hegemonic masculinity can be defined as the configuration of gender practice which embodies the currently accepted answer to the problem of the legitimacy of patriarchy, which guarantees (or is taken to guarantee) the dominant position of men and the subordination of women.173
Hegemoniale Männlichkeit beschreibe demnach eine kulturell herausgehobene Position und fungiere als Legitimierung der aktuell herrschenden patriarchalen Ordnung einer Gesellschaft. Dies impliziere gleichsam die Unterordnung von Frauen. Das Konzept der hegemonialen Männlichkeit versteht sich damit auch als analytische Weiterentwicklung der lange den feministischen Diskurs bestimmenden Patriarchatstheorien. Diese sollten die strukturelle Dominanz der Männer wissenschaftlich greifbar machen. Während beispielsweise der radikale Feminismus Männer in der Täter-, und Frauen in der Opferrolle festschrieb, argumentierte der sozialistische Feminismus zusätzlich mit dem kapitalistischen System als Mechanismus für die Unterdrückung der Frau. Beide Patriarchatsbegriffe, sowohl der radikal-feministische als auch der sozialistisch-feministische, ignorieren Gewalt-, Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse innerhalb der Geschlechter und betrachten allein die Frau als Opfer männlicher physischer, psychischer und systemischer Gewalt.174
Das Konzept der hegemonialen Männlichkeit sei hingegen nur pluralistisch und relational fassbar.175 Zum einen beschreibe es ein Abbild von, je nach historischem und kulturellem Kontext veränderlichen gesellschaftlichen und sozialen Realitäten.176 Zum anderen basiere es auf der Annahme, dass nicht die eine, singuläre Männlichkeit existiere, sondern eine Vielzahl an Männlichkeiten. Daraus folge, dass (mitunter gewaltgeprägte) Abhängigkeitsverhältnisse nicht nur zwischen Männern und Frauen, sondern auch unter Männern bestünden. Das heißt, das Konzept der hegemonialen Männlichkeit umfasst immer auch zusätzliche Männlich- und Weiblichkeiten und berücksichtigt nicht nur heterosoziale, sondern auch homosoziale Kontexte und Hierarchisierungen:
‚Hegemonic masculinity‘ is always constructed in relation to various subordinated masculinities as well as in relation to women. The interplay between different forms of masculinity is an important part of how a patriarchal social order works.177
Daraus wiederum leitet Connell ab, dass alle Akteure eines gesellschaftlichen Systems an der (Re)Produktion dieser hegemonialen Männlichkeit teilhaben – sei es als die Person, die hegemoniale Männlichkeit verkörpert, als Komplize oder als Diskriminierte/r. Obschon nicht jede/r aktiv daran mitwirke, könne er/sie sich dem System nicht entziehen. Während der erste und der letzte Typus weitgehend selbsterklärend sind, insofern der eine dominiert und der/die andere untergeordnet ist, bedarf der Begriff der Komplizenschaft einer kurzen Erläuterung. Connell definiert sie folgendermaßen: „Masculinities constructed in ways that realize the patriarchal dividend, without the tensions or risks of being the frontline troops of patriarchy, are complicit in this sense.“178 Die patriarchale Dividende wiederum beschreibt „the advantage men in general gain from the overall subordination of women“.179 Nicht jeder Mann sei demnach aktiv und direkt an der physischen oder psychischen Unterdrückung und Abwertung von Frauen oder anderen Männern beteiligt – eine Annahme, die jedoch vor allem den radikalen Feminismus der 1960er und 1970er Jahre prägte und gegen die sich Connell wendet. Gleichwohl profitiere ein Mann als Angehöriger des hegemonialen Geschlechts unter Umständen von diesen Strukturen. Allerdings zögen nicht alle Männer in gleicher Weise Vorteil aus dieser strukturellen Hegemonie, denn auch unter Männern, und das ist einer der entscheidenden Punkte an Connells Konzept, existieren Momente von Ab- und Ausgrenzung.180 Die komplementären Prozesse, die eine Person oder Gruppe an das eine oder andere Ende der Hierarchie (also entweder in eine dominante oder untergeordnete bzw. diskriminierte Position) rücken, bezeichnet Connell als Ermächtigung und Marginalisierung. Diese beiden Begriffe beschreiben die sozialen Vorgänge unter Männern und stehen in Relation zu anderen strukturellen Kategorisierungen wie Klasse, Alter oder Ethnie.
Über das Konzept der hegemonialen Männlichkeit lässt sich also Geschlechterdifferenz in spezifische Geschlechterverhältnisse übersetzen.181 Oder anders formuliert: Männlich- und Weiblichkeiten bilden gesellschaftliche Effekte der im Prozess des doing gender reproduzierten Geschlechterdifferenz ab, indem sie eine bestimmte Hierarchisierung repräsentieren.182 Geschlecht definiert Connell als „a way in which social practice is ordered“183. Sie betont dabei die Prozesshaftigkeit, die auch für den sozialkonstruktivistischen Ansatz des doing gender essentiell ist. Während letztgenannter vor allem die wechselweise Verschränkung von Darstellung und Ansicht oder Erkennen fokussiert, hebt Connell zudem die körperliche, sprich reproduktive Interaktion zwischen den Geschlechtern als immanent für soziale Geschlechterkonstruktionen hervor:
In gender processes, the everyday conduct of life is organized in relation to a reproductive arena, defined by the bodily structures and processes of human reproduction. This arena includes sexual arousal and intercourse, childbirth and infant care, bodily sex difference and similarity.184
Das Feld der Reproduktion wird damit zum Verhandlungsraum zwischen unterschiedlichen Männlich- und Weiblichkeiten und Körperlichkeit zum bestimmenden Faktor bei der Analyse von Geschlechterverhältnissen.185 So fasst Connell den Körper als sozialen agens: „We need to assert the activity, literally the agency, of bodies in social processes.“186 Körperreflexive Praxen seien sozial bedeutsam, insofern sie den Körper in soziale Prozesse und historische Kontexte einbetteten, ohne ihn seiner Materialität zu berauben:187
[B]odies […] do not turn into symbols, signs or positions in discourse. Their materiality (including material capacities to engender, to give birth, to give milk, to menstruate, to open, to penetrate, to ejaculate) is not erased, it continues to matter. The social process of gender includes childbirth and child care, youth an ageing, the pleasure of sport and sex, labour, injury, death from AIDS.188
Körperreflexive Praxen schaffen demnach soziale Realitäten und gesellschaftliche Strukturen.189 In diesem Sinne wirken sie, wie Connell mit Rückgriff auf den tschechischen Philosophen Karel Kosik feststellt, „onto-formative“ (d.h. weltgestaltend).190
Gestützt wird hegemoniale Männlichkeit nicht von der Macht Einzelner, gegen die auch Foucault argumentiert, sondern von kollektiver, institutioneller Macht: „It is the successful claim to authority, more than direct violence, that is the mark of hegemony (though violence often underpins or supports authority).“191 Das wiederum bedeute, dass hegemoniale Männlichkeit nicht (zwingend) auf Gewalt beruhe, diese jedoch strukturell begünstige.192
Wie Connell weiter schreibt, besteht einer der wichtigsten Aspekte hegemonialer Männlichkeit in ihrer Fluidität und damit ihrer historischen Gebundenheit. Für die vorliegende Arbeit bedeutet das, Connells Begriff konzeptuell zu verwenden, d.h. nicht nach den von ihr für die australische Gesellschaft erforschten Ausprägungen hegemonialer Männlichkeit zu suchen, sondern vielmehr herauszuarbeiten, inwiefern in Onettis Texte ein spezifischer hegemonialer Männlichkeitsdiskurs eingeschrieben ist. Dass dennoch eine australische Theoretikerin, die sich grundlegend auf eine angloamerikanisch-französische Forschungstradition (Michel Foucault, Judith Butler et al.) beruft, zur Untersuchung lateinamerikanischer Männlichkeiten ins Feld geführt wird, ist der Tatsache geschuldet, dass sich auch lateinamerikanische Wissenschaftler*innen auf diese Theorien berufen und den möglichen Vorwurf einer neokolonialen, okkzidental-zentrierten Forschungsperspektive somit obsolet werden lassen.193
In Auseinandersetzung mit bereits existierenden Forschungsarbeiten zu lateinamerikanischen Männlich- und Weiblichkeiten versucht die vorliegende Arbeit also zu bestimmen, welche Verhaltensweisen, Mimik, Gestik, welches sexuelle Begehren, welche soziale Stellung, welche körperreflexiven Praxen im kulturellen Kontext der La-Plata-Region, in dem Onetti seine Erzählungen verortet, als hegemonial dargestellt werden und wie sich davon ausgehend die Geschlechterverhältnisse innerhalb des Analysekorpus lesen lassen. Die Hauptuntersuchungsachse verläuft dabei über das Feld der Reproduktion, männliche Disziplinierungsmaßnahmen über den weiblichen Körper sowie widerständige weibliche Sexualität. Die Frage, an welche Räumlichkeiten diese Mechanismen gebunden sind, schlägt den Bogen zurück zu Foucaults Machtbegriff.