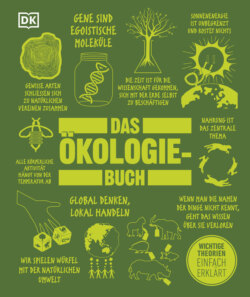Читать книгу Big Ideas. Das Ökologie-Buch - John Farndon - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEXISTENZ WIRD VON EINIGEN WENIGEN UMSTÄNDEN BESTIMMT
ÖKOLOGISCHE NISCHEN
IM KONTEXT
SCHLÜSSELFIGUR
Joseph Grinnell (1877–1939)
FRÜHER
1910 In einem Artikel über Käfer verwendet der US-Biologe Roswell Hill Johnson erstmals das Wort niche (Nische) in einem biologischen Kontext.
SPÄTER
1927 Der Brite Charles Elton hebt in seiner Definition der ökologischen Nische im Buch Animal Ecology die Bedeutung der Rolle eines Organismus in seinem Lebensraum hervor.
1957 In dem Fachartikel Concluding Remarks erweitert der Brite George Evelyn Hutchinson die Theorie der ökologischen Nischen auf die gesamte Umwelt eines Organismus.
1968 Der Australier David R. Klein analysiert die Einführung, die Vermehrung und das Aussterben von Rentieren auf St. Matthew Island (Alaska) als ein Beispiel für Nischenzerstörung.
Die Nische eines Lebewesens umfasst sowohl seinen Lebensraum als auch seine Rolle in dieser Umwelt. Dazu gehört, wie es Nahrung und Unterschlupf findet, aber auch, wie es Fressfeinde vermeidet, mit anderen Arten konkurriert und sich fortpflanzt. Alle Wechselwirkungen mit anderen Organismen und der unbelebten Umwelt zählen ebenfalls dazu. Eine eigene Nische ist von Vorteil, weil sich dadurch die Konkurrenz mit anderen Arten verringert. Das Wissen über die Nische eines Lebewesens hilft Ökologen, auf sinnvolle Weise einzugreifen, um Veränderungen wie der Vernichtung von Lebensräumen oder dem Klimawandel entgegenzuwirken.
Ein Pionier des Nischenkonzepts war der US-amerikanische Biologe Joseph Grinnell. Er studierte die Kalifornienspottdrossel und veröffentlichte seine Ergebnisse im Jahr 1917. Dieser Vogel frisst und brütet im Gestrüpp des Chaparrals, einer kalifornischen Buschlandvegetation, und entkommt Räubern, indem er durch das Unterholz läuft. Seine Tarnung, die kurzen Flügel und starken Beine sind perfekt für diesen Lebensraum. Grinnell sah den Chaparral als die »Nische« der Spottdrossel. Das Konzept berücksichtigte auch »ökologische Äquivalenz«, nach der sich kaum verwandte und weit entfernt lebende Tier- und Pflanzenarten ähnlich anpassen, etwa bei Nahrungsgewohnheiten, wenn sie ähnliche Nischen belegen. So ernähren sich die Australsäbler in Australien ähnlich wie die nicht mit ihnen verwandten Kalifornienspottdrosseln. Grinnell identifizierte auch »leere« Nischen, die Lebewesen potenziell besetzen könnten, doch sie tun es nicht.
Erweitertes Nischenkonzept
In den 1920er-Jahren dachte der britische Ökologe Charles Elton über eine einfache Habitatdefinition der Nische hinaus. Was ein Tier frisst und wodurch sein Leben bedroht wird, waren für ihn die Hauptfaktoren. 30 Jahre später erweiterte George Evelyn Hutchinson das Konzept. Für ihn umfasste der Begriff Nische alle Wechselwirkungen eines Lebewesens mit anderen und mit der unbelebten Umwelt, etwa der Geologie, der Boden- und Wasserchemie, den Nährstoffströmen und dem Klima. Nach Hutchinson erforschten andere die Vielfalt der von einem Lebewesen genutzten Ressourcen (Nischenbreite), die Wege, wie konkurrierende Arten koexistieren (ökologische Sonderung oder Nischensonderung), und die Nutzung der gleichen Ressourcen durch mehrere Arten (Nischenüberlappung).
»[Eine Nische] ist ein hochabstrakter mehrdimensionaler Hyperraum. «
George Evelyn Hutchinson
Der Lebensraum
Ökologische Nischen beruhen auf stabilen Habitaten, selbst kleine Änderungen können sie zerstören. So entwickeln sich Libellenlarven nur in Wasser, dass hinsichtlich Säuregehalt, chemischer Zusammensetzung und Temperatur geeignet ist, bei genügend Beute und nicht zu vielen Fressfeinden. Zudem ist die richtige Vegetation für die Weibchen zum Eierlegen und für die Metamorphose der Larven nötig. Libellen beeinflussen aber auch das Habitat: Ihre Eier ernähren Amphibien, die Larven sind sowohl Räuber als auch Beute und bringen Nährstoffe ins Wasser ein. Erwachsene Tiere jagen Insekten. Ansprüche und Einflüsse definieren also die jeweilige Nische. Die Umwelt muss, so Hutchinson, innerhalb eines bestimmten Bereichs bleiben, damit diese eine Art bestehen kann. Bei veränderten Nischenbedingungen kann sie aussterben.
Ein Ultraspezialist
Der Große Panda belegt eine sehr spezialisierte ökologische Nische, denn er ernährt sich hauptsächlich von Bambus. Dieser ist eine schlechte Nahrungsquelle mit wenig Proteinen und viel Zellulose. Pandas können zudem nur einen kleinen Anteil verdauen, sodass sie enorme Mengen – bis zu 12,5 kg pro Tag – brauchen und bis zu 14 Stunden am Tag fressen müssen. Es konnte noch nicht geklärt werden, warum sie so vom Bambus abhängen, doch es wird vermutet, dass er jederzeit reichlich vorhanden ist und Pandas einfach keine guten Jäger sind. Pandas fressen je nach Jahreszeit verschiedene Pflanzenteile. Im Spätfrühling bevorzugen sie junge Sprossen, zu anderen Zeiten die Blätter. Im Winter, wenn es wenig anderes gibt, fressen sie die Stämme. Pandas haben kräftige Kaumuskeln entwickelt und einen Pseudodaumen, um die Bambusstämme zu halten. Ihr Verdauungssystem ist für große Mengen Pflanzenmaterial wenig geeignet, weil es noch stark dem ihrer fleischfressenden Vorfahren ähnelt, doch ihre Darmbakterien unterstützen die Verdauung pflanzlicher Nahrung.