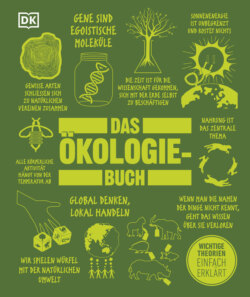Читать книгу Big Ideas. Das Ökologie-Buch - John Farndon - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеWELLHORNSCHNECKEN SIND WIE KLEINE WÖLFE IN ZEITLUPE
SCHLÜSSELARTEN
IM KONTEXT
SCHLÜSSELFIGUR
Robert Paine (1933–2016)
FRÜHER
1950er In Kenia bringt der Bauer und Umweltschützer David Sheldrick Elefanten in den Tsavo-East-Nationalpark und stellt fest, dass die Artenvielfalt erheblich zunimmt.
1961 Joseph Connells Freilandforschungen an den Felsküsten Schottlands zeigen, dass das Entfernen von Wellhornschnecken die Verteilung von Seepocken (ihrer Beute) beeinflusst.
SPÄTER
1994 In den USA veröffentlicht eine Gruppe von Ökologen um Brian Miller eine Arbeit, die die nützliche Rolle der Präriehunde als Schlüsselart erklärt.
2016 Nach Freilandstudien schließt Sarah Gravem, das Arten an manchen Orten Schlüsselarten sein können, an anderen nicht.
Als Schlüsselart wird eine Art bezeichnet, die eine Schlüsselrolle hinsichtlich der Funktion eines Ökosystems innehat, auch wenn sie selbst oft nur einen kleinen Teil der Biomasse ausmacht. Da sie die Umwelt überproportional beeinflusst, verändert sich ein Ökosystem dramatisch, wenn sie verschwindet. Die Bedeutung von Schlüsselarten hat der US-amerikanische Biologe Robert Paine 1969 in dem Fachartikel A Note on the Trophic Complexity and Community Stability beschrieben, in dem er den Begriff keystone species einführte – abgeleitet vom Schlussstein (keystone) eines architektonischen Bogens, der dessen Einsturz verhindert.
Schlüsselart als Konzept
In den 1960er-Jahren erforschte Paine einige Jahre lang die Gezeitenzone auf Tatoosh Island an der Pazifikküste des US-Staates Washington. Er entfernte dort den Ockerseestern und beobachtete, wie die Miesmuschel, seine Hauptbeute, dominant wurde. Sie verdrängte andere Arten, da sie nicht mehr durch den Seestern kontrolliert wurde. Das Entfernen einer einzelnen Art, einer Schlüsselart, wirkte sich deutlich auf viele andere aus. Paine entwickelte diese Ideen weiter zum Konzept der »trophischen Kaskaden«: den starken Folgen, die sich von oben nach unten durch ein Ökosystem fortpflanzen. Seit Paines Arbeiten mit Seesternen konnten weitere Schlüsselarten identifiziert werden, die ihre Rolle auf ganz unterschiedliche Art füllen.
»Willst du einen Automechaniker, der … alle Teile des Motors benennen, auflisten und zählen kann, oder einen, der wirklich versteht, wie jedes Teil mit den anderen wechselwirkt und einen funktionierenden Motor bildet?«
Robert Paine Nachruf, New York Times, 2016
Schwarzschwanz-Präriehunde in Wyoming (USA) halten bei ihrem Bau in einem Feld Ausschau. Forschungen zeigten, dass sie eine Schlüsselrolle bei der Förderung der Biodiversität haben.
Ökologische Baumeister
Die Präriehunde des Mittleren Westens der USA sind ein gutes Beispiel für eine Schlüsselart, deren Einfluss auf ihrer Bautätigkeit beruht. Riesige Kolonien dieser Erdhörnchen graben Tunnelnetzwerke unter dem Grasland der Prärie. Sie schlafen in den ausgedehnten Bauten, ziehen dort ihre Jungen auf und verwandeln dabei ihre Umgebung.
Durch ihr ständiges Graben lockern die Nagetiere den Boden auf, sodass Nährstoffe und Wasser tiefer eindringen, als es sonst der Fall wäre. Der feuchte, nährstoffreiche Boden fördert eine Vielzahl von Pflanzen, Vögel wie der Bergregenpfeifer fressen und brüten im kurzen Gras. Prädatoren wie Königsbussarde und Schwarzfußiltisse finden Beute, Iltisse und Tigersalamander nutzen die Erdhöhlen der Präriehunde als Unterschlupf. Es ist nachgewiesen, dass fast 150 Pflanzen- und Tierarten von den Präriehundkolonien profitieren. Zwar gibt es auch »Verlierer« (vor allem Wirbeltiere, die eine hohe Vegetation bevorzugen), doch insgesamt erhöhen die Präriehunde die Artenvielfalt. Stirbt eine Kolonie aus, wird das Kurzgras von Mesquitesträuchern verdrängt, die Bergregenpfeifer verschwinden und die Zahl der Prädatoren sinkt.
Korallenputzer
Der Gestreifte Papageifisch der Karibik ist eine weitere Schlüsselart, in diesem Fall wegen seiner Ernährungsweise. Er lebt in Korallenriffen, wo die Korallen um Licht, Nährstoffe und Platz konkurrieren. Der Fisch reinigt die Oberfläche der Korallen und frisst eine Algenschicht ab. Würde er das nicht tun, würden die Korallen überwuchert werden und ersticken, das Riff würde chemische Schäden davontragen. Würde der Papageifisch durch Überfischung oder Krankheiten aussterben, dann würde sich der Zustand der Riffe schnell verschlechtern.
Landschaftsgestalter
In den Savannen Afrikas werfen Elefanten kleine und mittelgroße Bäume zum Fressen um, was die Savanne als Grasland erhält und neue Flächen aus Waldgebieten entstehen lässt. Dieses Verhalten trägt dazu bei, den Lebensraum für Weidegänger wie Zebras, Antilopen und Gnus zu erhalten. Es hilft indirekt auch Prädatoren wie Löwen, Geparden und Hyänen, die diese Weidetiere jagen, und kleineren Säugetieren, die Bauten im Erdreich anlegen. Ohne die Elefanten würden diese Tiere bald verschwinden. Elefanten sind zudem für die Verbreitung von Pflanzen wichtig: Unverdaute Samen werden weit transportiert und mit dem Kot ausgeschieden. Bis zu einem Drittel aller westafrikanischen Baumarten brauchen Elefanten, um ihre Samen zu verteilen. Elefanten graben auch und sichern dadurch Wasserlöcher, die vielen anderen Arten nutzen.
Die im Wald lebenden Asiatischen Elefanten haben eine ähnliche Rolle. In Südostasien brechen sie durch Lücken und Lichtungen und eröffnen so das Blätterdach. Neue Pflanzen, die an den unbeschatteten Stellen nachwachsen, erhöhen die Pflanzenvielfalt und tragen dazu bei, dass dort auch mehr Tierarten gedeihen.
Reviere der Wolfsrudel in Yellowstone
Jedes Wolfsrudel im Yellowstone-Nationalpark hat sein eigenes Revier, viele überlappen sich. Die Anzahl der Wölfe schwankt von Jahr zu Jahr, 2016 wurden 108 Tiere gezählt.
Prädatorenschlüsselarten
Der Seeotter ist ein Meeressäugetier in den pazifischen Küstengewässern Nordamerikas. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde er intensiv wegen seines Fells gejagt. Im frühen 20. Jahrhundert waren diese Tiere in einigen Gebieten völlig ausgerottet, man schätzte ihre damalige Gesamtpopulation auf weniger als 2000 Individuen. Seit 1911 hat der gesetzliche Schutz zu einer langsamen Zunahme geführt.
Seeotter sind wichtig, weil sie eine große Menge Seeigel fressen. Diese auf dem Meeresboden lebenden Wirbellosen grasen an den Stängeln, mit denen der Seetang am Boden verankert ist, sodass die Pflanzen wegtreiben und sterben. Mit dem Tang verschwinden aber auch viele andere wirbellose Meerestiere, die ihn abgrasen. Tangwälder nehmen außerdem große Mengen Kohlendioxid auf und schützen Küsten vor Sturmfluten, weil sie Wasserströmungen bremsen. Der Schutz, den die Seeotter dem Tang gewähren, ist an offenen Küstenabschnitten also besonders wichtig.
»Jede Art der Küstenzone wird in der einen oder anderen Form durch die ökologischen Wirkungen von Seeottern beeinflusst.«
James Estes US-amerikanischer Meeresbiologie Interview, The Guardian, 2016
Anders als Seeotter sind einige Schlüsselarten zugleich Spitzenprädatoren, also Räuber an der Spitze der Nahrungsketten, etwa der Wolf. Vor 1995 hatte es seit mindestens 70 Jahren im Yellowstone-Nationalpark keine Wölfe gegeben. Wapitis (aus der Familie der Hirsche) waren häufig, aber es gab nur eine Biberkolonie. 1995 wurden 31 Wölfe im Nationalpark ausgesetzt. 2001 war ihre Zahl auf über 100 angestiegen, vor allem dank der reichlich vorhandenen Wapitis als Beute.
Die Wölfe brachten die Wapitis in Bewegung. Statt die Weiden, Espen und Pappeln an bevorzugten Orten zu überweiden, mussten sie wandern, sodass sich die Pflanzen erholen und anderen Tieren Nahrung bieten konnten, beispielsweise dem Biber. Nach zehn Jahren hatte sich die Zahl der Biberkolonien auf neun erhöht. Biberdämme tragen dazu bei, Feuchtgebiete zu beleben. Mehr erlegte Wapitis nutzten auch den Aasfressern, darunter Coyoten, Rotfüchse, Grizzlybären, Steinadler, Raben, Elstern und kleinere Tiere.
Jaguare sind die Spitzenprädatoren in süd- und mittelamerikanischen Wäldern und jagen mehr als 85 Beutearten. Zwar gibt es pro Fläche nur sehr wenige Jaguare, aber ihr Einfluss auf andere Räuber – etwa Kaimane, Schlangen, große Fische und Vögel – sowie auf Pflanzenfresser wie Capybaras (Wasserschweine) und Hirsche ist von oben nach unten auf das gesamte Ökosystem erheblich. Ohne diese Kontrolle würden die Pflanzenfresser die meisten Pflanzen stark verringern und das Habitat zerstören, von dem so viele Arten abhängen.
Schlüsselpflanzen
Nicht alle Schlüsselarten sind Tiere. Ein Beispiel ist der Feigenbaum, von dem es etwa 750 Arten gibt und der vor allem in Tropenwäldern vorkommt. In diesem Lebensraum haben die meisten Pflanzen mit fleischigen Früchten ein oder zwei Reifeperioden im Jahr. Feigen dagegen tragen ganzjährig Früchte und ernähren so viele Tiere, wenn andere Bäume fruchtlos sind. Über 10 % aller Vogelarten und 6 % der Säugetierarten (zusammen 1274 Arten) fressen Feigen, zudem ein paar Reptilien und sogar Fische. Feigen sind also eine essenzielle Nahrungsgrundlage für viele fruchtfressende Lebewesen. Flughunde, Vögel und andere Arten sind auf sie angewiesen.
»Durch den Schutz einer Schlüsselart wie des Präriehunds könnte man die Öffentlichkeit über den Wert der Erhaltung von Ökosystemen aufklären.«
Brian Miller US-amerikanischer Ökologe The Prairie Dog and Biodiversity, in: Conservation Biology, 9/1994
Robert Paine
Der in Cambridge (Massachusetts, USA) geborene Robert Paine studierte in Harvard. Nach seiner Zeit in der Armee, die er als Bataillonsgärtner verbrachte, konzentrierte er seine Forschungen auf marine Wirbellose. Seine Studien der Beziehung zwischen Seesternen und Muscheln an der US-Pazifikküste führten ihn zum Konzept der Schlüsselart, die überproportionalen Einfluss auf das Ökosystem hat.
Paine war die meiste Zeit seines Arbeitslebens an der Universität von Washington in Seattle tätig, wo er manipulative Freilandexperimente populär machte – die »Tritt-es-und-guck«-Ökologie. Er erhielt im Jahr 2013 von der Nationalen Wissenschaftsakademie den International Cosmos Award. 2016 starb er.
Hauptwerke
1966 Food Web Complexity and Species Diversity, in: American Naturalist
1969 A Note on Trophic Complexity and Community Stability, in: American Naturalist
1994 Marine Rocky Shores and Community Ecology: An Experimentalist’s Perspective
Die Rückkehr des Bibers nach Großbritannien
Biber wurden in Großbritannien vor 400 Jahren ausgerottet, heute ist der Nutzen dieser Schlüsselart besser bekannt. Sie sind natürliche Baumeister, die Dämme und Kanäle bauen. Ihre Anwesenheit erhöht die Artenvielfalt.
2009 wurden elf Biber im Knapdale Forest (Schottland) freigelassen, 2011 setzte der Devon Wildlife Trust ein Paar in einem umzäunten Gebiet aus. Bei beiden Projekten wurde genau beobachtet, was daraufhin in der Umwelt geschah. Im Knapdale Forest veränderten die Biberdämme den Wasserstand eines Sees. In Devon bauten die Biber mehrere Dämme im Oberlauf des Flusses Tamar, wodurch 13 neue Weiher entstanden, was die Umgebung feuchter machte.
Die neuen Feuchtgebiete in Devon führten dazu, dass nun mehr Bryophytenarten (Moose und Lebermoose) vorkommen, die Zahl der Arten aquatischer Wirbelloser ist von 14 auf 41 gestiegen. Die Zunahme an Fluginsekten hat die Vielfalt der Fledermäuse verbessert; zwei seltene Arten sind in das Gebiet eingewandert. Weitere Auswilderungsprogramme sind in Großbritannien geplant.