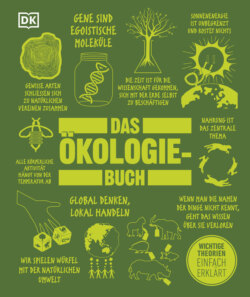Читать книгу Big Ideas. Das Ökologie-Buch - John Farndon - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPARASITEN UND KRANKHEITSERREGER REGULIEREN POPULATIONEN WIE DIE RÄUBER
ÖKOLOGISCHE EPIDEMIOLOGIE
IM KONTEXT
SCHLÜSSELFIGUREN
Roy Anderson (*1947),
Robert May (*1936)
FRÜHER
1662 Der englische Kurzwarenhändler John Graunt analysiert die Todesarten in London statistisch in Natural and Political Observations made upon the Bills of Mortality.
1927 Die Schotten Anderson Gray McKendrick und William Ogilvy Kermack entwickeln ein epidemisches Modell für infizierte, nicht infizierte und gesunde Individuen.
SPÄTER
1996 Der US-Epidemiologe James S. Koopman fordert den stärkeren Einsatz von Computern, um zu simulieren, wie sich Krankheiten ausbreiten.
2018 Ein weltweites Team verfolgt die Ausbreitung eines Pilzes, der Frösche dezimiert.
Die Epidemiologie erforscht, wie sich Krankheiten in einer Population ausbreiten. Ursprünglich stand dabei der Mensch im Vordergrund, inzwischen werden die Methoden aber auch für Populationen anderer Lebewesen effektiv angewendet.
Ökologen erkannten früh, dass die Größe einer Tier- oder Pflanzenpopulation und ihre Wachstumsrate vom Angebot an Nahrung und Lebensraum sowie der Menge an Fressfeinden abhängt. In den 1970er-Jahren zeigten der Brite Roy Anderson und der Australier Robert May, wie Parasiten sowie bakterielle und virale Infektionen die Größe einer Population begrenzen. Bei wilden Schafen ist z. B. die wichtigste Todesursache der Lungenwurm, während die meisten Vögel an Vireninfektionen sterben.
Karte der Todesfälle durch Cholera in London 1854
Todesfälle beim Ausbruch der Cholera von 1854 ließen sich auf eine Wasserpumpe zurückführen. Das Wasser dort war durch das Abwasser einer kranken Familie verschmutzt worden.
In der Ökologie haben Krankheiten weitere Auswirkungen. Bis zu 40 % der Bakterien im Ozean sterben täglich durch Viren. Dies führt zum »viralen Shunt«, durch den Nährstoffe an die Basis der Nahrungskette zurückfließen, statt die Nahrungskette hinaufzuwandern.
Am Anfang war der Mensch
Die Epidemiologie begann mit dem britischen Arzt John Snow, der 1854 eine Choleraepidemie im Londoner Stadtteil Soho miterlebte. Damals meinte man, dass die Krankheit durch Miasma – eine Art giftiger Dämpfe in der Luft – verursacht wurde, das von den Leichen und Sterbenden ausging. Snow war nicht der Erste, der dies anzweifelte, aber bei der Cholera hatte er besonders starke Zweifel.
Er trug jeden Cholerafall in eine Karte von Soho ein und stellte fest, dass die betroffenen Haushalte das Wasser an einer Pumpe in der Broad Street (heute: Broadwick Street) holten. Er ließ die Pumpe abstellen und die Epidemie ließ bald nach. Die Cholera wurde also durch das Wasser übertragen, und Menschen steckten sich durch verschmutztes Wasser oder Nahrung an. Ein Jahrzehnt später beschrieb Louis Pasteur mit der »Keimtheorie«, dass Krankheiten, aber auch Fäulnis und Zersetzung von Mikroorganismen verursacht werden.
Der Arzt John Snow kämpfte für seine Überzeugung, dass Cholera durch Wasser übertragen wird. Die medizinische Zeitschrift Lancet räumte erst 1866 ein, dass er recht hatte.
Krankheitsmodelle
In den 1970ern konzentrierten sich Anderson und May auf die Entwicklung eines mathematischen Modells für den Einfluss von Mikroorganismen auf Populationen. Ihr System von Gleichungen sollte auch in der realen Welt erklären, wie sich verschiedene Pathogene verbreiten – von Bakterien und Viren zu parasitischen Würmern und Insektenlarven.
In ihrem Modell wurden (virtuell im Computer repräsentierte) Mäuse in drei Gruppen unterteilt: empfängliche, aber nicht infizierte Mäuse, infizierte Mäuse sowie Mäuse, die die Infektion überlebt hatten und nun immun waren. Anders als frühere epidemiologische Modelle war die Gesamtzahl nicht konstant; Mäuse kamen durch Geburt oder Zuwanderung hinzu und starben auch an natürlichen Ursachen. Ohne Krankheiten blieb die Gesamtzahl gleich, weil die Rate der neu hinzukommenden Mäuse mit der Zahl der sterbenden im Gleichgewicht stand.
»Bei sinnvoller Anwendung sind mathematische Modelle nicht mehr und nicht weniger als Werkzeuge, um über Dinge in einer präzisen Weise nachzudenken.«
Roy Anderson / Robert M. May Infectious Diseases of Humans: Dynamics and Control, 1991
Ein Baum in North Yorkshire (Großbritannien) zeigt das Ulmensterben durch einen Pilz, der unabsichtlich aus Asien eingeführt wurde und vom Ulmensplintkäfer verbreitet wird.
Der Einfachheit halber nahm das Modell an, dass die Krankheit durch Kontakt zwischen infizierten und nicht infizierten Mäusen verbreitet wurde (Ansteckungsrate). Nicht alle infizierten Mäuse starben, denn das Modell enthielt auch eine Genesungsrate. Die gesundeten Mäuse waren immun, zumindest am Anfang. Immunität gegen Viren ist meist lebenslang, aber für einige bakterielle Infektionen kann man nach einer Zeit wieder empfänglich werden. Daher enthielt das Modell auch eine Rate dazu, dass Immunität wieder verloren geht.
Mit diesen Annahmen stellten Anderson und May ein Gleichungssystem auf, das die Rate der Populationsänderung der drei Gruppen (empfängliche, infizierte und immune Mäuse) vorhersagt und damit auch die Veränderung der gesamten Mäusepopulation.
»Krankheiten mit kurzen Infektionen und dauerhafter Immunität neigen dazu, epidemische Muster zu zeigen.«
Roy Anderson / Robert M. May Population biology of infectious diseases: Part I. Nature, 1979
Das Modell zeigte, dass sich eine Krankheit in einer Population hielt, wenn die Population im Gleichgewicht – Geburten, Zuwanderung und natürliche Sterberate sind ausgeglichen – größer ist als ein Schwellenwert, der die Ansteckungsrate, Genesungsrate sowie die natürliche und krankheitsbedingte Sterberate kombiniert. Mit der Krankheit ist die Population kleiner als ohne sie. Wenn sie einen Wert unter dem Schwellenwert erreicht, verschwindet die Krankheit. Und ist die Population erst einmal ohne Krankheit, kehrt sie zum Gleichgewichtszustand zurück.
In der realen Welt
Anderson und May mussten zeigen, dass ihr Modell Populationen in der realen Welt genau beschrieb. Dazu verwendeten sie Daten aus Laborexperimenten, in denen Mäuse mit der Pasteurellose, einer bakteriellen Krankheit, infiziert worden waren. Die Beobachtungsdaten bestätigten ihre Modellierung, von da ab konnten die Wissenschaftler die Auswirkungen auch von hypothetischen Werten ausgehend betrachten. So erkannten sie, dass die Krankheit den größten Einfluss auf die Population hatte, wenn die Geburten- oder Zuwanderungsrate am höchsten war. Demnach sind Arten mit einer hohen Vermehrungsrate (die viele nicht infizierte Jungtiere hevorbringt) am wahrscheinlichsten von endemischen Krankheiten betroffen. Zudem ist ihre Zahl niedriger bei Arten, die sich langsamer vermehren. Die Forscher konnten auch die Folgen unterschiedlich intensiver Krankheiten berechnen lassen.
Im Gegensatz zu endemischen Krankheiten, bei denen der Infektionsgrad in einer Population konstant bleibt, treten Epidemien dann auf, wenn die Zahl der infizierten und empfänglichen Individuen im Vergleich zur Sterberate klein ist. Dann steigen die Infektionszahlen steil an und fallen wieder ab. Epidemien treten auch auf, wenn eine Krankheit zwar nicht sehr tödlich ist, aber das Wachstum der Population verlangsamt; dies betrifft menschliche Krankheiten wie Masern und Windpocken.
Anwendungen der Theorie
Das Wissen über die Merkmale von Krankheiten und welche Folgen sich für Tier- und Pflanzenpopulationen daraus ergeben, wird für die Ökologie immer wichtiger. Landwirte etwa profitieren davon, dass Parasiten und die Dynamik von Krankheiten, die Nutzpflanzen und -tiere befallen, erkundet werden. Naturschützer ebenfalls, wenn sie sich damit befassen, wie exotische Krankheiten und invasive Parasiten empfindliche Ökosysteme beeinflussen.
Venn-Diagramm der ökologischen Epidemiologie
Ein Pathogen verursacht eine Krankheit, wenn ein empfänglicher Wirt in einer infektionsfördernden Umwelt gegeben ist, hier als Schnittmenge der Kreise dargestellt. So verbreitet sich Durchfall schnell in unhygienischen Verhältnissen.
Dürren und Pflanzenkrankheiten
Wie andere Krankheitserreger brauchen auch Pflanzenpathogene einen Pool von empfänglichen Wirtsindividuen, die sie infizieren können. In Dürreperioden verlangsamen sich das Wachstum und die Vermehrung, wodurch weniger Krankheiten auftreten.
Doch Trockenheit schwächt die Pflanzen auch und macht sie empfindlicher für Krankheitserreger, die trockene Verhältnisse aushalten. Dazu gehören verschiedene Pilze, die die Blätter von Getreide, Hülsenfrüchten und Obst befallen. Sie sind daran angepasst, in inaktivem Zustand als harte, mikroskopisch kleine Körper zu überleben, im trockenen Boden schaffen sie das über Jahre. Doch bei Feuchtigkeit müssen sie in wenigen Wochen einen Wirt finden, um nicht zu sterben. Sie töten den Wirt nicht immer. Forschungen an Kichererbsen zeigen, dass bei Trockenheit mehr Infektionen durch diese Pilze entstehen, aber die Sterberate der Pflanzen bei Dürre abnimmt.
Bei einer Sommerdürre wachsen junge Gerstenpflanzen kaum. Trockenheit und Hitze verringern ihre Widerstandskraft gegen Pilze, die ihre Wurzeln befallen.