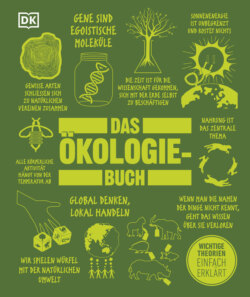Читать книгу Big Ideas. Das Ökologie-Buch - John Farndon - Страница 34
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеMIT DEM MIKROSKOP ENTKOMMT NICHTS UNSERER ERFORSCHUNG
DIE MIKROBIOLOGISCHE UMWELT
IM KONTEXT
SCHLÜSSELFIGUR
Robert Hooke (1635–1703)
FRÜHER
1267 Der Engländer Roger Bacon thematisiert Anwendungen der Optik zum Betrachten »der kleinsten Staubteilchen« in Band 5 des Opus Maius.
1661 Mikroskopische Zeichnungen des englischen Architekten Christopher Wren beeindrucken König Charles II., der Hooke mit weiteren Zeichnungen beauftragt.
SPÄTER
1683 Der niederländische Händler Antoni van Leeuwenhoek baut Mikroskope, sieht damit Bakterien und Protozoen und veröffentlicht dies bei der Royal Society in London.
1798 Edward Jenner, ein englischer Arzt, entwickelt den ersten Impfstoff (gegen Pocken) und schreibt An Inquiry into the Causes and Effects of the Variolae Vaccinae.
Beim Blättern in der Micrographia mussten Leser im 17. Jahrhundert sehr gestaunt haben. Das bahnbrechende Werk des englischen Forschers Robert Hooke von 1665 enthält viele detaillierte Abbildungen von Strukturen, die dem Menschenauge wegen ihrer Winzigkeit zuvor verborgen geblieben waren. Hookes Mikroskop vergrößerte 50-fach, doch der Detailreichtum hat auch mit seinem akribischen Vorgehen zu tun. Er fertigte zahlreiche Skizzen aus verschiedenen Perspektiven, die er zu einem Bild kombinierte. Es ist nicht genau bekannt, wer das erste Mikroskop baute, in den 1660er-Jahre war dieses Gerät jedenfalls in Gebrauch. Die frühen Instrumente waren unzuverlässig, da sich die Herstellung der Linsen schwierig gestaltete – Wissenschaftler mussten die Probleme kreativ lösen. Zuerst konnte Hooke seine Proben nicht klar erkennen, also erfand er eine bessere Lichtquelle, die er »Scotoskop« nannte.
»… in jedem kleinen Teilchen erkennen wir nun eine fast ebenso große Vielfalt an Lebewesen, wie wir zuvor im gesamten Universum geschätzt hatten.«
Robert Hooke Micrographia, 1665
Hookes Buch ist mehr als eine genaue Abbildung dessen, was er durch die Linse sah; er theoretisierte auch darüber, was die Bilder über die Funktion der Organismen aussagten. In einer hauchdünnen Korkschicht sah er beispielsweise Honigwabenstrukturen, die er als »Zellen« beschrieb – ein Begriff, den wir heute noch verwenden.
Mikroskopische Wunder
Micrographia inspirierte auch viele andere Forscher, die mikroskopische Welt zu erkunden. Nach den Beschreibungen und Zeichnungen in Hookes Buch konnte der niederländische Händler und Naturforscher Antoni van Leeuwenhoek seine eigenen Mikroskope konstruieren, die bis zu 200-fach vergrößerten.
Van Leeuwenhoek untersuchte Proben von Regenwasser und Wasser aus stehenden Teichen und staunte über die Vielfalt der Lebewesen darin, die er animalcula nannte. Er fand einzellige Protozoen und entdeckte Bakterien. Er erforschte auch die Anatomie von Tier und Mensch, etwa Blutzellen und Sperma.
Während van Leeuwenhoek Wasserproben untersuchte, legte sein Landsmann Jan Swammerdam Insekten unter seine eigenen Mikroskope, veröffentlichte Beschreibungen diverser Insekten mit feinsten Details und entdeckte viele Merkmale ihrer Anatomie. Swammerdams einflussreichstes Werk war Historia insectorum generalis ofte Algemeene verhandeling van de bloedeloose dierkens (1669), das auch detailliert den Lebenszyklus der Eintagsfliege dokumentierte.
In England legte Nehemiah Grew eine Vielzahl von Pflanzen unter das Mikroskop. Er erkannte als Erster, dass die Blüten die Geschlechtsorgane der Pflanze sind. In Anatomy of Plants (1682) benannte Grew die Staubblätter als männliches Organ und den Stempel als weibliches Organ. Er sah auch Pollenkörner und bemerkte, dass sie von Bienen transportiert werden.
»[Micrographia ist] … das klügste Buch, das ich je gelesen habe.«
Samuel Pepys Tagebücher, 21.1.1665
Verglichen mit den ersten Mikroskopen sind die Instrumente viel komplexer geworden. Das Elektronenmikroskop, erstmals 1931 im Einsatz, nutzt Elektronenstrahlen statt Licht, was eine wesentlich höhere Auflösung ermöglicht. Es kann bis zu millionenfach vergrößern – 600-mal so stark wie die besten Lichtmikroskope.
Facettenauge und Gehirn einer Biene, gezeichnet von Jan Swammerdam und posthum in Bybel der Natuure (1737) veröffentlicht; zeigt das Auge von außen (links) und seziert (rechts), darunter einen Gehirnschnitt.
Robert Hooke
Der auf der Isle of Wight (England) geborene Robert Hooke interessierte sich früh für Wissenschaft. Ein kleines Erbe ermöglichte es ihm, die angesehene Westminster School zu besuchen. Später erhielt er einen Platz an der Universität in Oxford. Dort war er als Assistent der Naturphilosophen John Wilkins und Robert Boyle tätig. 1662 wurde er der erste Kurator für Experimente der Royal Society in London, 1665 Professor für Physik am Gresham College.
Wie viele andere Wissenschaftler seiner Zeit hatte er ein breites Interessenspektrum. Zu seinen Leistungen gehören frühe Einsichten in die Wellentheorie des Lichts, die Konstruktion einiger der frühesten Fernrohre und die Formulierung des hookeschen Gesetzes. Er war auch ein respektierter Architekt und dadurch recht wohlhabend.
Hauptwerke
1665 Micrographia
1674 An Attempt to Prove the Motion of the Earth
1676 A Description of Helioscopes and Some Other Instruments