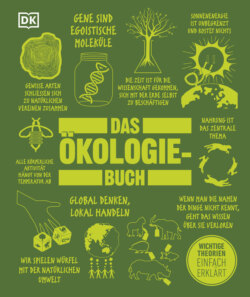Читать книгу Big Ideas. Das Ökologie-Buch - John Farndon - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеANGST AN SICH IST EINE MÄCHTIGE KRAFT
NICHT KONSUMTIVE EFFEKTE DER RÄUBER AUF IHRE BEUTE
IM KONTEXT
SCHLÜSSELFIGUR
Earl Werner (*1944)
FRÜHER
1966 Der US-amerikanische Ökologe Robert Paine führt eine Reihe bahnbrechender Freilandexperimente durch, um den entscheidenden Einfluss von Prädatoren auf die Lebensgemeinschaft aufzuzeigen.
1990 Die kanadischen Biologen Lima und Lawrence Dill analysieren die Entscheidungsfindung bei Lebewesen, die dem größten Risiko ausgesetzt sind, Beute eines anderen zu werden.
SPÄTER
2008 Der US-amerikanische Verhaltensbiologe und Ökologe John Orrock arbeitet mit Earl Werner und anderen zusammen, um mathematische Modelle zur Erklärung der nicht konsumtiven Effekte von Prädatoren zu entwickeln.
Viele Darstellungen von Ökosystemen beschreiben Räuber-Beute-Beziehungen, bei denen Räuber (Prädatoren) die Beute töten und fressen. Doch der US-Amerikaner Earl Werner und andere haben gezeigt, dass schon die Anwesenheit von Räubern das Verhalten der Beute ändert.
Außer Spitzenprädatoren müssen alle Tiere die Notwendigkeit zu schlafen, sich fortzupflanzen und zu fressen einerseits und das Risiko des Gefressenwerdens andererseits gegeneinander abwägen. Die tödliche Rolle von Räubern ist eindeutig, aber ihre nicht tödliche (nicht konsumtive) Rolle kann größere Auswirkungen auf ein Ökosystem haben. Die potenzielle Beute ändert ihr Verhalten, um möglichst nicht getötet zu werden.
Eine Amerikanische Königslibelle legt Eier in einem Teich. Die Larven sind räuberisch und es wurde belegt, dass sie das Verhalten von Kaulquappen, ihrer Beute, beeinflussen.
1990 studierte Werner den Einfluss von Larven der Amerikanischen Königslibelle auf die Kaulquappen von Kröten. Er bemerkte, dass bei Anwesenheit der räuberischen Larven die Kaulquappen weniger aktiv waren, sich in anderen Bereichen des Beckens aufhielten und bei der Metamorphose zur Kröte kleiner waren. Der Prädator hatte das Aussehen und Verhalten der Kröten einfach durch seine Anwesenheit verändert.
Ein Jahr später untersuchte Werner, was passiert, wenn es mehr als eine Beuteart gibt. Ohne Prädatoren wachsen die Kaulquappen des Ochsenfroschs und des Schreifroschs fast gleich schnell. Doch wenn es räuberische Königslibellenlarven gab, waren beide Arten weniger aktiv und schwammen in anderen Beckenbereichen. Die Ochsenfroschkaulquappen wuchsen schneller, während die Schreifroschkaulquappen weniger Futter suchten und langsamer wuchsen. Werner schloss auf einen Zielkonflikt zwischen der Notwendigkeit, möglichst schnell zu wachsen, und dem Risiko, von Prädatoren gefressen zu werden. Da die Libellenlarven das Verhalten der Beutearten unterschiedlich beeinflussten, hatte der Ochsenfrosch einen Konkurrenzvorteil gegenüber dem Schreifrosch.
Landtiere
Die frühen Studien nicht konsumtiver Effekte untersuchten Wassertiere im Labor, doch es wurden auch Landtiere erforscht. Deutsche Freilandstudien, 2018 veröffentlicht, befassten sich mit dem Luchs und dem Rehwild als seine Beute. Waren Luchse vor Ort, vermieden die Rehe Gebiete, in denen ein hohes Risiko bestand, und zwar am Tag und im Sommer, wenn Luchse nachts jagen. Die Rehe mieden einige Gebiete ganz – wohl aus Angst vor Angriffen.
Überall, wo es Prädatoren gibt, kommt es zu nicht konsumtiven Effekten. Sie betreffen auch einige sessile (unbewegliche) Arten, nicht nur bewegliche Beute. So kann es vorkommen, dass eine Art von Prädatoren vertrieben wird und im neuen Habitat konkurrenzstärker als die dort vorhandenen Arten ist. Kleine Fische, die vertrieben wurden, können etwa mit zuvor sesshaften Schwämmen um Nahrung konkurrieren und sie verdrängen.
»… Arten reagieren [auf Räuber], indem sie ihre Aktivität verringern und den Raum anders nutzen.«
Earl Werner Nonlethal Effects of a Predator on Competitive Interactions Between Two Anuran Larvae, in: Ecology, 1991