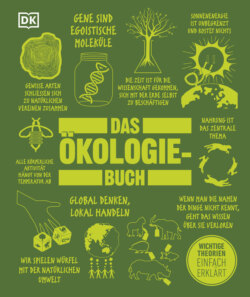Читать книгу Big Ideas. Das Ökologie-Buch - John Farndon - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеMEHR NEKTAR HEISST MEHR AMEISEN UND MEHR AMEISEN HEISST MEHR NEKTAR
MUTUALISMUS
IM KONTEXT
SCHLÜSSELFIGUR
Daniel Janzen (*1939)
FRÜHER
1862 Charles Darwin meint, dass eine afrikanische Orchidee mit tiefem Blütenboden von einer Motte mit langem Rüssel bestäubt wird.
1873 Der belgische Zoologe Pierre-Joseph van Beneden verwendet als Erster das Wort »Mutualismus« im biologischen Kontext.
1964 Die US-Amerikaner Paul Ehrlich und Peter Raven verwenden erstmals den Begriff »Koevolution« für das mutualistische Verhältnis zwischen Schmetterlingen und ihren Nahrungspflanzen.
SPÄTER
2014 Forscher erkennen einen Drei-Wege-Mutualismus bei Faultieren, Algen und Motten.
Es gibt verschiedene Formen von Interaktion zwischen Lebewesen. Zum Beispiel kann eine Art benachteiligt sein, wenn mehrere Arten um die gleichen Ressourcen konkurrieren. Symbiosen (im weiteren Sinn) sind dagegen ein »Zusammenleben« verschiedener Organismen. Eine weitere Beziehungsform, der Kommensalismus, ist für eine Art vorteilhaft, für die andere weder von Vorteil noch von Nachteil. Dagegen profitieren beim Mutualismus (Symbiose im engeren Sinn) beide Arten.
Die Feigenwespe und die Feige bilden einen komplexen Dienstleistung-Ressourcen-Mutualismus, bei dem die Wespe die Bestäubung durchführt und die Feigenpflanze einen sicheren Ort für die Eier bereitstellt.
Der Baum und die Ameisen
Mitte der 1960er-Jahre stieß Daniel Janzen, ein junger US-amerikanischer Ökologe, auf den verblüffenden Mutualismus zwischen Akazien und Ameisen in Ostmexiko. Er erforschte als Erster eine solche Interaktion im Detail. Die Partner sind die Flötenakazie und Ameisenarten, die in den kugelig erweiterten Dornen des Baums leben. Die Ameisenkönigin sucht eine unbesiedelte Jungpflanze, schneidet ein Loch in einen der Dornen und legt Eier hinein; manchmal verlässt sie den Dorn, um den Nektar des Baums zu trinken. Die Larven ernähren sich von den Blattspitzen der Akazie, die viel Zucker und Proteine enthalten. Durch Metamorphose entwickeln sie sich zu Arbeiterameisen. Mit der Zeit werden alle Dornen des Baums von einer Kolonie mit bis zu 30 000 Ameisen besiedelt.
Ameisen und ihre Larven verbergen sich in den vergrößerten hohlen Dornen der ostafrikanischen Flötenakazie. Im Gegenzug verteidigen die Ameisen den Baum gegen Pflanzenfresser.
Janzen zeigte, dass Akazien ohne Ameisen, die sie verteidigen, schnell von Insekten befallen werden, die ihre Blätter, Stämme, Blüten und Wurzeln fressen. Ohne Ameisen sind Akazien innerhalb von Monaten bis eines Jahres abgefressen und sterben. Da sie zudem langsamer wachsen, werden sie öfter von konkurrierenden Bäumen beschattet. Janzen schnitt Dornen ab und verbrannte Sprosse, um die Ameisen zu entfernen, doch die siedelten sich immer wieder an, sobald Dornen nachwuchsen.
Im Austausch für Nahrung und Unterkunft liefern die Ameisen zwei »Dienstleistungen«: Sie verteidigen den Baum gegen blattfressende Insekten und sie fressen die Jungpflanzen der Umgebung, also die potenziellen Konkurrenten. Janzen bezeichnete die Akazien und ihre Ameisen als »obligatorische Mutualisten«: Beide Arten würden jeweils ohne die andere sterben. Werden die Ameisen entfernt, kann sich die Flötenakazie nicht mehr verteidigen. Und ohne Akazien haben die Ameisen keine Heimat.
Vorteile für alle
Es gibt zwei Formen von Mutualismus: Dienstleistung gegen Dienstleistung und Dienstleistung gegen Ressourcen. Was der eine Partner dem anderen liefert – Ressourcen oder Dienstleistungen –, ist oft für das Überleben wichtig. Ein Austausch von Dienstleistungen gegen Ressourcen kommt in der Natur häufig vor. Weit verbreitet ist die Bestäubung von Blüten durch Schmetterlinge, Motten, Bienen, Fliegen, Wespen, Käfer, Fledermäuse oder Vögel. Die Blüte stellt Ressourcen (Nektar) bereit, das Tier die Dienstleistung (Bestäubung). Geschätzt wird, dass ungefähr drei Viertel der Blütenpflanzen (170 000 Arten) von 200 000 Tierarten bestäubt werden. Meistens wird ein Insekt von der Farbe oder dem Duft der Blüte angezogen und trinkt den Nektar oder frisst Pollen. Dabei bleibt etwas Pollen am Insekt hängen, wird zur nächsten Blüte transportiert und dort abgelegt. Die Pflanze und der Bestäuber haben sich gemeinsam evolutionär entwickelt, sodass das System effizient funktioniert.
Andere Pflanzen haben eine Dienstleistung-Ressourcen-Beziehung mit Vögeln oder Säugetieren entwickelt, um Samen, Früchte oder Sporen zu verteilen. So können sich Samen im Fell eines Säugetiers, das Blätter frisst, verhaken; wenn es weiterwandert, verteilt es diese. Der üble Gestank der Stinkmorchel zieht Fliegen an, die den Schleim des Pilzes auflecken, wobei Sporen an ihnen haften bleiben, um verteilt zu werden. Wenn ein Vogel Früchte frisst, nimmt er Samen auf; da sie unverdaubar sind, werden sie später in großer Entfernung mit dem Kot ausgeschieden. In diesen Fällen liefert die Pflanze eine Ressource (Nahrung) und das Tier eine Dienstleistung (Transport).
»Es gibt gegenseitige Hilfe bei vielen Arten.«
Pierre-Joseph van Beneden Belgischer Zoologe Über das soziale Leben niederer Tiere (Vortrag), 1873
Nicht an allen mutualistischen Wechselbeziehungen sind Pflanzen beteiligt. In Afrika praktizieren Madenhacker, eine Vogelgattung, und weidende Säugetiere wie Antilopen und Zebras eine andere Form des Dienstleistung-Ressourcen-Mutualismus. Die Madenhacker sammeln Zecken und Insekten aus dem Fell, die die Säugetiere reizen oder krank machen, und haben so eine gute Mahlzeit. Die Vögel geben zudem Rufe ab, wenn Gefahr droht, und warnen das Säugetier und zugleich die anderen Madenhacker.
Zwischen Ameisen und Blattläusen besteht eine andere Form dieses Mutualismus. Dabei werden die Blattläuse von den Ameisen geschützt. Die Blattläuse geben eine nahrhafte Substanz ab, den Honigtau, den die Ameisen »melken«, indem sie die Blattläuse mit ihren Antennen streicheln.
Dienstleistung-Dienstleistung-Mutualismus, bei dem sich die Partner gegenseitig schützen, tritt weit seltener auf, doch es gibt ihn: Eine ungewöhnliche Beziehung besteht zwischen etwa 30 Arten von Clownfischen und zehn Arten giftiger Seeanemonen im Pazifik. Die stechenden, mit Gift gefüllten Nesselzellen auf den Tentakeln der Seeanemone töten die meisten kleinen Fische, die ihr zu nahe kommen, aber nicht die Clownfische. Deren dicke Schicht aus schützendem Schleim macht die Haut gegen die Nesseln unempfindlich, sodass die Fische zwischen den Tentakeln leben können. Im Austausch für den Schutz durch die giftige Anemone vertreibt der Clownfisch räuberische Falterfische, entfernt Parasiten von der Anemone und liefert durch seinen Kot Nährstoffe.
Kooperative Evolution
Derartige Beziehungen zwischen Arten haben sich über Jahrmillionen durch die sogenannte Koevolution entwickelt: die gemeinsame Evolution zweier oder mehrerer Arten, die sich gegenseitig beeinflussen.
Der Begriff »Koevolution« wurde 1964 von den US-Amerikanern Paul Ehrlich und Peter Raven geprägt, doch schon ein Jahrhundert zuvor hatten Charles Darwin und Alfred Russell Wallace das Prinzip erkannt, als sie Orchideen erforschten. Wie viele andere Blütenpflanzen brauchen auch sie Insekten zur Bestäubung. Einige haben ausgeklügelte Strukturen, die Pollen und den nahrhaften Nektar enthalten, der die Insekten anzieht. Das beschäftigte Darwin, als er 1862 ein Exemplar des Sterns von Madagaskar erhielt. Diese Orchidee hat einen hohlen Sporn an der Blüte, der fast 30 cm lang ist und den Nektar enthält. Darwin und Wallace spekulierten, dass nur eine große Motte mit einem langen Rüssel den Nektar erreichen kann – dies wurde im Jahr 1997 bestätigt. Wäre der Sporn kürzer, könnte die Motte Nektar trinken, ohne Pollen aufzunehmen, sodass sie die Blüte nicht bestäuben würde. Wäre der Sporn länger, würde die Motte die Blüte gar nicht erst besuchen.
Clownfisch und Seeanemone könnten ohne den gegenseitigen Schutz überleben, aber die durch Koevolution entstandene mutualistische Beziehung erhöht ihre Überlebenschancen.
Yuccas und ihre Motten
In den heißen, trockenen Regionen Amerikas gibt es eine bemerkenswerte mutualistische Symbiose zwischen Palmlilien (Yucca) und Yucca-Motten. Kein anderes Insekt bestäubt diese Stauden und keine andere Pflanze beherbergt die Raupen dieser Motte. Die weibliche Motte sammelt Pollen aus den Blüten einer Yuccapflanze und bringt ihn in die Blüten einer anderen Pflanze ein. Dann schneidet die Motte ein Loch in den Fruchtknoten und legt ein Ei – oder mehrere – hinein. Wenn die Raupen schlüpfen, ernähren sie sich von den heranwachsenden Samen, fressen aber nicht alle, sodass sich die Pflanze weiterverbreiten kann. Wenn zu viele Eier in eine Blüte gelegt werden, wirft die Pflanze sie ab, sodass die Raupen verhungern. Ohne die Motten würden die Pflanzen nicht bestäubt werden und aussterben. Ohne die Yuccas hätten die Motten keinen Ort, um die Eier zu legen und die Raupen zu ernähren, sie würden ebenfalls nicht überleben.