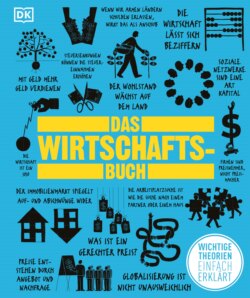Читать книгу Big Ideas. Das Wirtschafts-Buch - John Farndon - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Ökonomie des Laisser-faire
ОглавлениеDie Vorstellung einer solchen »spontanen Ordnung« hatte bereits der niederländische Autor Bernard Mandeville in seinem Gedicht Die Bienenfabel von 1714 dargestellt. Er erzählte von einem Bienenstock, dem es so lange gut erging, wie die Bienen eigennützig handelten. Als sie jedoch beschlossen, dem Wohl des Stocks zu dienen, ging er zugrunde. Smith betrachtete Eigeninteresse keineswegs negativ. Er ging davon aus, dass Menschen tauschten und handelten, um ihre Situation zu verbessern. Als soziale Kreaturen verhielten sie sich dabei moralisch aufrichtig und fair.
Smith hielt es für richtig, dass sich Regierungen nicht in den Handel einmischten, eine Ansicht, die von anderen schottischen Denkern, etwa dem Philosophen David Hume, geteilt wurde. Der französische Autor Pierre de Boisguilbert hatte zuvor geschrieben: »Lasse die Natur nur machen« – was so viel heißen sollte wie: »Lasse die Wirtschaft nur machen«. Der Ausdruck »Laisser-faire« bezeichnet in der Wirtschaftslehre eine möglichst geringe Einmischung des Staates. Smith sprach der Regierung allerdings die wichtige Rolle zu, für die militärische Verteidigung, Rechtsprechung und bestimmte »öffentliche Güter« zu sorgen.
Smith war im Wesentlichen ein Optimist. Der englische Philosoph Thomas Hobbes hatte zuvor behauptet, ohne eine starke Autorität sei das menschliche Leben »scheußlich, tierisch und kurz«. Der britische Ökonom Thomas Malthus betrachtete den Markt und sagte als direkte Folge des steigenden Wohlstands eine Hungersnot voraus. Später sollte Karl Marx prophezeien, Marktwirtschaft führe zur Revolution. Smith jedoch sah die Gesellschaft als funktional und die gesamte Wirtschaft als erfolgreiches System an. Zwar erwähnt er die »unsichtbare Hand« nur einmal in seinem fünfbändigen Werk, aber ihre Gegenwart ist häufig spürbar. Smith beschrieb, wie sein System der »vollkommenen Freiheit« zu positiven Resultaten führen könne. Erstens bietet es die Güter, die die Menschen brauchen. Ist die Nachfrage größer als das Angebot, rivalisieren die Verbraucher und der Preis steigt. Für die Hersteller ergibt sich die Möglichkeit, Gewinn zu machen, sodass sie darum konkurrieren, mehr von dem Gewünschten anzubieten. Dieses Argument hat die Zeit überdauert. In seinem Aufsatz Die Verwertung des Wissens in der Gesellschaft von 1945 legt der österreichische Ökonom Friedrich von Hayek dar, wie Preise auf die örtlich begrenzten Informationen und Wünsche der Individuen reagieren und so die nachgefragte Menge und das Angebot am Markt verändern. Ein zentraler Planer, so Hayek, könnte niemals so viele verstreute Informationen sammeln. Heute herrscht die Ansicht, dass der Kommunismus in Osteuropa zusammenbrach, weil die Planwirtschaft die Menschen nicht zufriedenstellen konnte. Smiths erster Punkt wird allerdings durchaus kritisiert, denn der Markt könnte z. B. nur Güter für reiche Menschen liefern und die Wünsche der Armen ignorieren. Außerdem reagiert er oft auch auf schädliche Wünsche – wenn er beispielsweise Drogenkonsum oder Fettleibigkeit fördert.