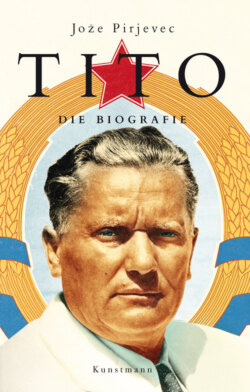Читать книгу Tito - Joze Pirjevec - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
MÄRZGESPRÄCHE
ОглавлениеUm freie Hand bei der Abrechnung mit den Tschetniks zu haben und weil er aufgrund einer in Mihailovićs Generalstab erbeuteten »Depesche« überzeugt war, dass London dessen Zusammenarbeit mit der Ustascha im Kampf gegen seine Streitkräfte gutgeheißen hatte, dass also die Briten im Wesentlichen gegen ihn seien, entschloss sich Tito im März erneut zur Kontaktaufnahme mit den Deutschen, mit denen er das letzte Mal Mitte November 1942 verhandelt hatte.260 Einen Vorwand dafür bot der Austausch eines gefangenengenommenen deutschen Majors, in Wirklichkeit ging es Tito aber darum, einen Waffenstillstand auszuhandeln, um die nötigen Kapazitäten für eine endgültige Vernichtung der Tschetniks zu haben. Er wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass die Operation Weiß bereits ausgelaufen war und dass die Deutschen gar nicht beabsichtigten, ihn jenseits der Neretva zu verfolgen. Bevor er sich zu diesem Schritt entschloss, berief er eine Besprechung mit seinen Mitarbeitern ein, auf der ihn Đilas fragte: »Und was werden die Russen dazu sagen?« Tito, der die Komintern schon über seine Pläne hinsichtlich des Gefangenenaustausches informiert hatte, gab scharf zurück: »Die denken doch auch in erster Linie an ihre Leute und an ihre Armee.«261
So kam es am 11. März 1943 in Gornji Vakuf, unweit von Jajce, zu Gesprächen zwischen Abgesandten beider Seiten. Milovan Đilas, Vladimir Velebit und Koča Popović versicherten ihren Gesprächspartnern, unter denen sich auch Hans Ott befand, dass sich die Volksbefreiungsstreitkräfte im Augenblick zwar gegen deutsche Angriffe verteidigten, selbst aber keine Angriffe auf die Wehrmacht planten. Vielmehr sei die Vernichtung der Tschetniks zurzeit ihr vorrangiges Ziel. Sie sagten, dass sie eine völlig unabhängige Volksbewegung seien und sich nur aus Propagandagründen auf die sowjetische Seite geschlagen hätten. Sollte es zur Landung der Briten an der dalmatinischen Küste kommen, behaupteten sie, würde die Volksbefreiungsarmee sie im Gegenteil zu den Tschetniks zurückschlagen. Sie verlangten von den Deutschen, die Partisanen als »kriegführende Partei« anzuerkennen und damit das Kriegsrecht zu respektieren, vor allem was den Umgang mit den Gefangenen betreffe.262
Die Deutschen zeigten sich gesprächsbereit; sie lobten Titos Kämpfer wegen ihres Mutes, und ein Abkommen zwischen den gegnerischen Lagern schien zum Greifen nahe. Als Zeichen guten Willens befahl Tito den slawonischen Partisanen sogar, die Sabotageakte an der Bahnstrecke Zagreb-Belgrad einzustellen, wie es die deutschen Unterhändler gefordert hatten.263 Unter Berufung auf diese Gespräche sandte Siegfried Kasche am 17. März ein Telegramm nach Berlin, in dem er vorschlug, »die Gelegenheit zu nutzen, denn der Ausfall dieser weltberühmten Kampfkraft aus den Reihen unserer Feinde wäre von großer Bedeutung. Die Tito-Partisanen sind mehrheitlich keine Kommunisten und haben im Allgemeinen in den Kämpfen, im Umgang mit den Gefangenen und in der Bevölkerung keine außerordentlichen Exzesse verübt.«264
In den folgenden Tagen wurden die Gespräche in Sarajevo und Zagreb fortgesetzt, wohin Velebit und Đilas gefahren waren. Kasche informierte sowohl Pavelićs Außenminister Mladen Lorković wie auch den italienischen Gesandten im NDH-Staat, Raffaele Casertano, die beide seine Position stärkten. Auch italienische Militärkreise waren an einem Abkommen mit Tito überaus interessiert. Aber schon am 29. März wies das Berliner Außenministerium seinen Zagreber Vertreter an, die Verhandlungen abzubrechen, und führte dabei zwei Gründe an: das Misstrauen gegenüber Tito und die Angst, die Italiener könnten eine deutsche Vereinbarung mit ihm als Vorwand benutzen, sich ihrerseits noch enger mit den Tschetniks und Mihailović zu verbinden. Das einzig Akzeptable wäre Titos totale Kapitulation.265 Kasche blieb trotzdem beharrlich und berief sich dabei auf General Glaise von Horstenau, der angeblich ebenfalls eine »politische Regelung« mit den Partisanen unterstützte. Aber in den Anweisungen, die Ribbentrop am 21. April 1943 nach Zagreb schickte, hieß es: »Unser Ziel ist es nicht die einen gegen die anderen, die Tschetniks gegen die Partisanen, aufzuhetzen, sondern beide zu vernichten. Weil es uns gelungen ist, den Duce zu überzeugen, dass man sowohl die Tschetniks als auch die Parti sanen liquidieren muss, können wir unsererseits jetzt nicht die Methode ändern, die sich, was die Verwendung der Tschetniks gegen die Partisanen angeht, nicht von der italienischen unterschied«.266 Noch drastischer war Hitler, der überzeugt war – auch weil ihn seine Geheimdienste schlecht informiert hatten –, dass die Tschetniks genauso oder noch gefährlicher seien als die Partisanen: »Mit Rebellen wird nicht verhandelt, Rebellen werden erschossen.«267
Damit war der politische Rahmen der Gespräche erschöpft, obwohl Kasche noch Ende August und im September 1943 in Gesprächen mit Hitler und Ribbentrop seinen Standpunkt verteidigte. Doch die Vermittlerrolle beim Gefangenenaustausch ging für Hans Ott weiter und er setzte seine Reisen zwischen Zagreb und Titos Oberstem Stab bis zum Jahresende fort, wenngleich er immer abhängiger von den Geheimdiensten der Deutschen und der Ustascha wurde. In Zusammenarbeit mit deren Sonderkommandos plante er sogar Titos Entführung. Gegen Ende des Krieges nahmen ihn Einheiten der Abteilung für Volksschutz (OZNA) gefangen und verhörten ihn ausgiebig. Danach verliert sich von ihm jede Spur.268
Weil das idealisierte Bild des Volksbefreiungskampfes und seiner Führer bewahrt werden musste, waren im Nachkriegsjugoslawien die » Märzgespräche« ein Tabuthema, bis Tito sie gegen Ende seines Lebens selbst erwähnte, und zwar am 12. November 1978 in Jablanica, anlässlich der Fünfunddreißigjahrfeier des Übergangs über die Neretva. Aber auch bei dieser Gelegenheit sagte er nicht die ganze Wahrheit, denn er beschuldigte Đilas, Popović und Velebit, sich nicht an seine Anweisungen gehalten zu haben.269 Đilas und Popović waren in Ungnade gefallen und konnten sich nicht verteidigen. Vladimir Velebit, der nach dem Krieg eine bedeutende Karriere innerhalb der Vereinten Nationen in Genf machte, war, wie die anderen beiden, über Titos Äußerungen entsetzt und verbittert, aber es schien ihm klüger zu sein zu schweigen.270
In einem Telegramm, mit dem er am 30. März 1943 Moskau über einen Gefangenenaustausch informierte, schreibt Tito, dass sich »der deutsche Gesandte in Zagreb […] mit mir zu treffen wünscht«. Stalin, der über diese Depesche informiert war, verstand sofort, dass es sich um mehr als nur um einen Gefangenenaustausch handelte. Auf seinen Befehl hin antwortete »Ded« mit einer wahren Moralpredigt: »Was geschieht hier? Das Volk befindet sich in einem erbitterten Kampf gegen die Okkupanten, und plötzlich solche Beziehungen zwischen Ihnen und den Deutschen. […] Erwarte eine Antwort.«271 Aber Tito war dieses Mal nicht bereit sich zu entschuldigen. Ohne Zögern antwortete er, dass ihn die Russen nicht behindern mögen, wenn sie ihm schon nicht helfen können. »Das war das erste Mal«, schrieb später Đilas, »dass ein Mitglied des Politbüros – und das war Tito selbst – einen derartig entschlossenen Dissens mit den Sowjets zum Ausdruck brachte.«272