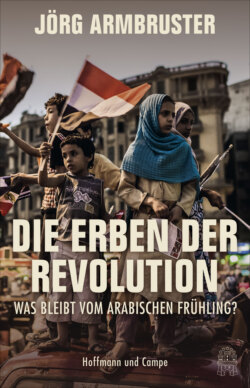Читать книгу Die Erben der Revolution - Jörg Armbruster - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wael Ghonim und die Macht von Facebook
ОглавлениеNoch eine Vorgeschichte. Ihr Hauptakteur: der dreißigjährige Ägypter Wael Ghonim, Informatiker und Marketingleiter der Firma Google in der Golfregion. Es ist der 8. Juni 2010.
»Meine Erinnerungen an diesen Tag sind lebhaft«, schreibt Wael Ghonim in seinem Buch Revolution 2.0. »Ich saß in meinem kleinen Arbeitszimmer in Dubai, unfähig, die Tränen zurückzuhalten. Meine Frau kam nachsehen, was los war. Als ich ihr das Bild von Khaled Said zeigte, war sie bestürzt und bat mich, nicht mehr hinzusehen.«
Das Foto zeigte das Gesicht eines achtundzwanzig Jahre alten Mannes oder besser, das, was von ihm übrig geblieben war, nachdem zwei Polizisten in Zivil eine halbe Stunde lang auf ihn eingeschlagen und am Ende totgeprügelt hatten. Sein Gesicht zerschmettert, sein Kinn mehrfach gebrochen, der Körper blutüberströmt. Immer wieder hatten die Polizisten seinen Kopf gegen ein Eisengitter gehämmert, bis der Mann sich nicht mehr rührte. »Als er tot war, habe sie seinen Körper fortgeschafft wie einen Tierkadaver«, berichtet damals ein Augenzeuge, der Kaffeehausbesitzer Hasan Mesbah.
»Für mich war das Bild des toten Khaled Said ein schreckliches Symbol für den Zustand Ägyptens«, schreibt Wael Ghonim in seinem Buch.
Die Polizei stritt alles ab. Es sei ein Unfall gewesen. Khaled habe in seiner Heimatstadt Alexandria mit Drogen gedealt und sei an einem Päckchen Marihuana erstickt. Das entstellte Gesicht sei auf die Autopsie zurückzuführen. Niemand glaubte dieser Darstellung.
Als Mohammed al-Baradei – Ägyptens Friedensnobelpreisträger von 2005 und damals Hoffnungsträger der Opposition im Land – sowie die Bewegung »6. April« im Sommer 2010 in Alexandria und in Kairo zu Demonstrationen aufriefen, an denen Hunderttausende teilnahmen, hielten viele Menschen Plakate mit dem Bild des toten Khaled hoch und skandierten: »Kullena Khaled Said« – »Wir alle sind Khaled Said«.
»Kullena Khaled Said«, so hießt die Facebook-Seite, die Wael Ghonim noch am 8. Juni als Reaktion auf das Foto mit dem entstellten Gesicht eingerichtet hatte. Unter dem Pseudonym »ElShaheed« (Der Märtyrer) schuf er mit der Seite eine Art Klagemauer für Menschen, die unter der Polizeiwillkür litten, und machte sie zu einer virtuellen Waffe gegen das Regime Mubarak. Schon am ersten Tag schlossen sich 36000 Interessierte der Seite des Online-»Märtyrers« an. Sie lasen die ständig aktualisierten Hintergründe der Tat, die Kommentare bekannter Oppositionspolitiker, sahen die neuesten Videos mit Beispielen von Polizeigewalt, von denen die meisten von Journalist und Blogger Wael Abbas stammten. Nicht zuletzt erfuhren sie hier, wann und wo Demonstrationen stattfinden sollten. Wer keinen Zugang zum Internet hatte, erfuhr das Neueste vom Nutzer nebenan. Einen gab es immer, der wusste, was gerade gepostet worden war. In Kaffeehäusern, auf der Straße, in Geschäften oder auf den Märkten.
Die offiziellen Zeitungen hatten keine Meldung zum Tod von Khaled Said gedruckt, auch das staatliche Fernsehen äußerte sich zunächst nicht. Erst als es gar nicht anders ging, ließ das Innenministerium zunächst die üblichen Beschwichtigungen verlauten, dann schließlich folgte das Eingeständnis, dass Geheimpolizisten für den Tod des jungen Mannes aus Alexandria verantwortlich seien. Doch da wusste das Land bereits lange Bescheid.
»Wir alle sind Khaled« wurde in Ägypten zur erfolgreichsten und folgenreichsten Facebook-Seite des Jahres 2010 und Wael Ghonim zu einem der Wortführer der kommenden Aufstände. 2011 sollte ihn das Time-Magazin zu einem der einflussreichsten hundert Persönlichkeiten der Welt küren.
Auch zu der historischen Demonstration vom 25. Januar 2011 hatte Ghonim – zusammen mit der Bewegung »6. April«, mit Kifaja und anderen – auf seiner Facebook-Seite aufgerufen. Warum gerade der 25. Januar? Weil an diesem Tag traditionell der »Tag der nationalen Polizei« begangen wurde, mit Paraden und viel Selbstbeweihräucherung. An diesem Tag im Jahr 2011 sollte alles anders kommen.
Die Aktivisten organisierten einen gigantischen Sternmarsch. An fünfundzwanzig Treffpunkten versammelten sich die Demonstranten und marschierten friedlich in Richtung Tahrir-Platz. Am Vormittag waren sie gestartet, bis zum Nachmittag waren noch längst nicht alle angekommen. Männer und Frauen, Reiche und Arme, Alte und Junge, Akademiker und Handwerker, sie alle forderten lautstark den Rücktritt Mubaraks und seines Regimes. Im damaligen Ägypten eine Ungeheuerlichkeit. Doch trotz der Provokation blieb alles friedlich an diesem Tag. Es herrschte fast Volksfeststimmung. Von der Polizei war an diesem Dienstag, der eigentlich ihr Tag sein sollte, weder auf dem Platz noch in den angrenzenden Straßen etwas zu sehen. Eine bittere Niederlage für die Sicherheitskräfte, die es gewohnt waren, dass die Bürger vor ihnen kuschten.
Drei Tage später allerdings setzten die Sicherheitskräfte auf Gewalt. Am »Tag des Zorns«, zu dem die Aktivisten aufgerufen hatten, versuchten sie die Zehntausenden Demonstranten mit Knüppeln, Wasserwerfern, Tränengas und mit Gummigeschossen auseinanderzutreiben. Doch es gelang ihnen nicht, selbst als die Polizei mit Schrotmunition auf die Menschen schoss und sie mit ihren schweren Fahrzeugen einfach niederwalzte. Auf Hausdächern hatte man Scharfschützen in Stellung gebracht. Es gab Verletzte und Tote. Ärzte richteten Notlazarette am Rande der Demonstrationswege ein, um die vielen Verletzten zu behandeln. Doch die Demonstranten waren nicht aufzuhalten. Diesmal wehrten sie sich. Sie schleuderten Steine auf die Polizisten, drangen in Bürogebäude der Staatspartei ein und zündeten sie an. Aus dem am Nilufer gelegenen Hauptquartier der NDP quoll wochenlang schwarzer Qualm aus den Fenstern. Das Hochhaus brannte so lange, bis das Feuer keine Nahrung mehr fand und von selbst ausging.
Am Abend des 28. Januar griff die Armee in die Kämpfe ein, ließ Panzer anrollen und sicherte die wichtigsten Straßen und Plätze. Ihre Präsenz sollte die Lage beruhigen. »Volk und Armee sind eins«, skandierten die Demonstranten begeistert und begrüßten die Soldaten mit Blumen, obwohl sie nicht wussten, auf welcher Seite das Militär wirklich stand.
Die jungen Ägypter, Männer wie Frauen, Muslime und Christen, richteten sich auf eine lange Besetzung des Verkehrsknotenpunktes neben dem Ägyptischen Museum ein. Sie bauten auf der Grünfläche Zelte auf, sie kochten einfache Gerichte, sie kletterten Strommasten hoch, um Transparente mit ihren Forderungen aufzuhängen sowie an Galgen baumelnde Mubarak-Puppen.
Eine liberale Demokratie nach europäischem Vorbild war es nicht, was sie forderten, das ist im Westen oft missverstanden worden. Sie verlangten Gerechtigkeit, Brot und Würde. Sie protestierten gegen Korruption, Despotie, gegen Vetternwirtschaft und Polizeiwillkür. Wie das politische System auszusehen hatte, das diese Forderungen umsetzen sollte, das war selten ein Thema auf dem Tahrir-Platz.
Im Hintergrund ragte das riesenhafte Gebäude der Mugamma auf, das konkav gebogene Bollwerk ägyptischer Bürokratie – vierzehn Stockwerke hoch, mit Büros für 18000 Staatsdiener, die Pässe, Steuerbescheide, Führerscheine und Ähnliches ausstellen, natürlich nur gegen ein ordentliches Bakschisch. Einschüchtern soll dieses Betonmonster, und das tut es. Die Mugamma (auf Deutsch etwa: »Komplex«) ist ein Sinnbild für den ägyptischen Staat, eine Zwingburg der Bürokratie, die aus jedem Bürger einen zahlenden Bittsteller macht. Gerade mal hundert Meter sind es bis zum Tahrir-Platz, wo jetzt die jungen Ägypter für einen Staat kämpften, in dem jeder Mensch in Würde leben kann.
Viele dieser jungen Ägypter, so mein Eindruck damals vor Ort, glaubten, mit der Platzbesetzung schon das Ziel einer gerechten Gesellschaft erreicht zu haben. Man teilte alles, half sich gegenseitig, unterstützte den anderen, respektierte – zumindest in den ersten Wochen – die jungen Frauen auf dem Platz und kämpfte gegen den gemeinsamen Feind: die Polizei. Mädchen kommandierten Jungen zur Straßenreinigung ab, und diese nahmen ohne Murren die Besen in die Hände und fegten die Bürgersteige rund um den Platz. Es schien damals, als stünde die ägyptische Gesellschaft kopf. Tatsächlich erlebten nicht wenige der jungen Menschen zum ersten Mal ein solches Gemeinschaftserlebnis unter Gleichaltrigen außerhalb ihrer Familien.
In kurzer Zeit hatten die Demonstranten den Platz mit Barrikaden in eine Festung verwandelt, geschützt und oft unter Lebensgefahr verteidigt unter anderem von den Ultras, den Hooligans der beiden Kairoer Fußballclubs, Al-Ahly und Zamalek, erprobten Kämpfern, die mit der verhassten Polizei abrechnen wollten. Die hatte sich zwar im Verlauf der nächsten Tage zurückgezogen, doch dafür griffen die »Baltagijas« an, vom Innenministerium bezahlte Schläger, die auch vor Mord nicht zurückschreckten. Über achthundert junge Ägypter sollten in den kommenden achtzehn Tagen sterben. Auch in anderen Teilen Ägyptens strömten die Menschen auf die Straßen und skandierten: »Brot, Freiheit, Gerechtigkeit!« Halb Ägypten schien auf den Beinen zu sein und den Rücktritt Mubaraks zu fordern.
Der in Katar ansässige Nachrichtenkanal Al-Jazeera war in diesen Tagen der wichtigste Verbündete der aufständischen Jugend. Ohne dessen Sendungen wären die Bilder der Demonstrationen nicht so schnell in derart viele Länder getragen worden. Schließlich lief in nahezu jedem Teehaus in jedem noch so kleinen Dorf in der arabischen Welt der Fernsehapparat. Ein ägyptischer Fellache in Assuan konnte damals live mitverfolgen, was in der fast tausend Kilometer entfernten Hauptstadt Kairo gerade passierte, ebenso die Menschen im Jemen, in Bahrain oder Libyen. Dabei berichtete Al-Jazeera alles andere als objektiv. Wenn Meinungen veröffentlicht wurden, dann vor allem die der Muslimbrüder. Ihren späteren Erfolg bei den Wahlen hatten die islamistischen Kräfte in Ägypten zweifellos auch der unkritischen und parteilichen Berichterstattung dieses staatlich gesteuerten Senders aus Katar zu verdanken. Doch jetzt, in den Tagen nach dem 25. Januar, schien es, als gebe es nur ein ägyptisches Volk.
Weil die Menschen auf dem Land genauso unzufrieden waren wie die Menschen in den Städten, spannten viele ihre Esel vor die einachsigen Wagen, beluden sie mit Melonen, Fladenbrot, Tomaten und Käse und machte sich auf den langen Weg zu diesem Tahrir-Platz, von dem sie vorher noch nie etwas gehört hatten. Und wenn sie dann ankamen, oft erst nach Tagen, dann begrüßten die Besetzer sie mit stürmischem Beifall, luden die mitgebrachten Nahrungsmittel ab, verteilten sie und bedankten sich überschwänglich bei den verlegenen, sprachlosen Fellachen.
Wael Ghonim und seine Freunde hatten gehofft, dass der »Tag des Zorns«, der 28. Januar, ein Freitag, für sie zu einem Feiertag werden würde. Doch für Ghonim wurde er zu einem Tag der Katastrophe. Am Donnerstagabend war er noch mit zwei Kollegen Essen gegangen, im Edelrestaurant Sequoia an der Spitze der Nil-Insel Zamalek. Ein bisschen kühl war es gewesen trotz der Heizstrahler. Nach dem Essen schlenderte er allein in Richtung seines Hotels durch die in schummriges Licht getauchten Straßen von Zamalek, als plötzlich hinter ihm drei Polizisten in Zivil auftauchten und ihn zu Boden warfen. »Einer von ihnen drückte mich auf den Boden, ein anderer hielt meine Beine fest«, schreibt er in seinem Buch Revolution 2.0, »der dritte hielt mir den Mund zu. Mit von der Kundgebung heiseren Stimme schrie ich um Hilfe. ›Halt’s Maul, du Kanaille!‹, schnauzte eine harsche Stimme … Einer der Männer griff zu einem Funkgerät: ›Erledigt. Wir sind so weit.‹«
Das Kommando verschleppte ihn zu einem Polizeitransporter. Tagelang lebten seine Frau und seine Freunde in Angst um ihn. Er blieb verschwunden. Erst am 7. Februar ließ ihn der Geheimdienst wieder frei, nachdem der internationale Druck zu groß geworden war. Wenige Tage später trat Mubarak zurück.
Wael Ghonim und seinen Mitstreitern war es gelungen, den Ägyptern mit der Facebook-Seite »Wir alle sind Khaled Said« zu zeigen, dass jeder seine Angst überwinden kann, dass Widerstand möglich ist. Der Mord an dem achtundzwanzig Jahre alten Khaled Said in Alexandria war ein Mord, den hinzunehmen die jungen Ägypter nicht mehr bereit waren. Ein Mord zu viel. Die landesweite Empörung darüber verdichtete sich zu geballtem Zorn, der sechs Monate später auf dem Tahrir-Platz explodierte und zum Rücktritt Mubaraks führte.
»Die ägyptische Revolution hat uns gezeigt«, schreibt Wael Ghonim, »dass die große Masse der Menschen, die normalerweise nicht mutig ist und sich nicht engagiert, außerordentlich tapfer und aktiv werden kann, wenn sie geeint auftritt.«
Als Held will er deshalb aber nicht gefeiert werden, eher als einer, der in Sachen Khaled Said erfolgreich seine Marketingerfahrungen eingesetzt hat, der Menschen motivieren konnte, gemeinsam die Angst zu überwinden und aufzustehen. Die ägyptische Revolution, wie Ghonim die Ereignisse von 2011 auch heute noch nennt, war ein Erfolg der Massen, nicht einzelner Personen, so Ghonim.
War sie das wirklich? Zumindest kurzzeitig, ja. Aber es sollte sich schon bald zeigen, worin die Schwäche der säkularen Opposition in Ägypten bestand. Es war ihr zwar gelungen, die Menschen im ganzen Land zu mobilisieren, doch es fehlte ihr ein »Gesicht«, eine charismatische Gestalt, unter der sich die zersplitterten Gruppen hätten zusammenfinden können. Politiker wie Václav Havel in der Tschechoslowakei etwa oder Lech Wałęsa in Polen. Ohne den Commandante Castro wäre die Revolution auf Kuba vielleicht gescheitert. Sie waren so etwas wie Leuchttürme, die in den Wirren der Aufstände für Orientierung sorgten. In Ägypten kämpfte jeder mehr oder weniger für sich. Die säkularen Gruppen versuchten zwar, sich zusammenzuschließen, aber gegen die Allmacht des Militärs, die Gewalt der Polizei und die gut organisierten Muslimbrüder standen diese schlecht ausgerüsteten Idealisten auf aussichtslosem Posten.
Kaum war Mubarak zurückgetreten, brachen alle möglichen Konflikte aus, die bis dahin im Verborgenen geschwelt hatten. Die Busfahrer streikten. Nichts ging mehr in der Stadt mit ihren bald 20 Millionen Einwohnern. Die Menschen stiegen auf teurere Taxis um, die aber nicht von der Stelle kamen wegen der vielen Demonstrationen. Geschäfte konnten nicht mehr pünktlich beliefert werden, die Laster waren in den Straßen stecken geblieben oder hatten sich erst gar nicht auf den Weg gemacht. Hamsterkäufe waren die Folge. Hausfrauen horteten haltbare Lebensmittel. Viele Regale in den Supermärkten wurden leer geräumt. Autofahrer parkten am Straßenrand in Dreierreihen. Die Polizisten wagten nicht dagegen vorzugehen, wenn sie überhaupt zur Arbeit erschienen. Viele hatten Angst vor Racheakten. Eine nicht unbegründete Sorge – während der Unruhen hatten wütende Demonstranten zahllose Polizeistationen angezündet und zerstört. Für die Polizei eine extreme Demütigung. Jahrzehntelang hatte sie mit brutaler Gewalt das Überleben des alten Systems gesichert, und jetzt hatte sie von heute auf morgen alle Macht verloren. Niemand wusste zu diesem Zeitpunkt, ob nicht auch die niederen Ränge für ihre Gewalttaten zur Rechenschaft gezogen würden. Ihr oberster Dienstherr, der ehemalige Innenminister Habib al-Adli, stand inzwischen jedenfalls vor Gericht. Man warf ihm unter anderem vor, mitschuldig zu sein am Tod Hunderter Demonstranten während des Aufstands. Freigesprochen von diesem Vorwurf wurde er erst, nachdem der neue Alleinherrscher, Abdel Fattah al-Sisi, 2013 die Macht übernommen hatte. Von der Anklage der Korruption sprach ihn ein Strafgericht endgültig im Januar 2019 frei.
Die meisten einfachen Polizisten blieben daher lieber zu Hause. Das Bakschisch der Bürger, das die schlecht bezahlten Ordnungshüter für kleine Vergünstigungen eingesteckt hatten, konnten sie in der neuen Zeit wohl kaum verlangen, genauso wenig konnten sie von den Besitzern kleiner Geschäfte die üblichen Preisnachlässe fordern. So war es Alltag gewesen in Ägypten vor dem 25. Januar 2011 – und ist es heute wieder.
Dafür nahmen nächtliche Überfälle, Wohnungseinbrüche und Diebstähle zu. Frauen trauten sich nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr auf die Straße. Die Müllabfuhr funktioniert schon zu normalen Zeiten mehr schlecht als recht. Jetzt aber trauten sich die Kopten, die in Kairo traditionell den Müll einsammeln und in die »Müllstadt« Manschijet Nasser transportieren, nicht mehr in die Stadt. In den Straßen wuchsen die Müllberge und stanken tagelang vor sich hin.
Bei den Bürgern wuchs die Angst vor Chaos und wirtschaftlichem Niedergang. Ende 2010 hatten in einer Umfrage des »Abu Dhabi Gallup Center« 18 Prozent der Ägypter angegeben, sich in ihrem Land nicht sicher zu fühlen. Fünf Monate später war der Anteil auf 51 Prozent angestiegen. Eine Entwicklung, die dem regierenden Militär vermutlich nicht ungelegen kam, versprach es doch Law and Order.
Doch auch die Ägypter wussten sich zu helfen. Bürgerwehren versuchten nachts die Polizei zu ersetzen, sie errichteten Straßenkontrollen und ließen nur durch, wer sich ausweisen konnte. Da es im Januar und Februar in Kairo nach Sonnenuntergang bitterkalt werden kann, brannten an den Sperren Feuer in Fässern, an denen sich die Wachen wärmten. Es war eine gespenstische Atmosphäre, wenn man spätabends durch die Straßen lief und sich langsam den von flackerndem Licht beleuchteten Sperren näherte, misstrauisch beobachtet von jungen Kerlen, die meistens eine Kalaschnikow umgehängt hatten oder eine Machete im Gürtel trugen. Es war erstaunlich, wie viele Waffen in ägyptischen Haushalten gehortet worden waren. Für Ausländer wie mich war es damals nicht immer ganz einfach, nach Hause zu kommen.
Auch die Ärmsten der Armen nutzten in diesen Tagen die Gunst der Stunde und probten den Aufstand. Eine Zeitlang herrschte kreative Anarchie unter den Bewohnern von Slumsiedlungen. Die Menschen nahmen die Gerechtigkeitsversprechen des Tahrir-Platzes wörtlich und stürmten leer stehende Apartmentgebäude, um endlich für sich und ihre Familie einen würdigen Wohnraum zu beschaffen. Einige Hundert dieser Hausbesetzer verlangten vom zuständigen Ministerium, die neuen Wohnungen zu bestätigen, was die Behörde zunächst nicht abzulehnen wagte. Doch auf die erste Euphorie folgte bald Enttäuschung. Es gab keine staatliche Institution, die eine solche Inbesitznahme legalisieren wollte. Auch die Militärregierung wollte und konnte das eigenmächtige Handeln der Menschen nicht akzeptieren und schickte Polizeitruppen mit Tränengas und Gewehren.
Die Bereitschaft, die Reformbewegung zu unterstützen, nahm in der Bevölkerung in den Tagen nach Mubaraks Abdankung schnell ab. Dies nicht zuletzt, weil immer weniger Touristen ins Land kamen. Nach dem touristischen Erfolgsjahr 2010 mit 14,7 Millionen Besuchern kamen im folgenden Jahr gerade mal 9,8 Millionen Touristen. Auch die folgenden Jahre sollte es kaum besser werden. Für die 12 Prozent Ägypter, deren Einkommen direkt oder indirekt von den Besuchern aus Europa, den USA und Asien abhängen, war dies ein schwerer Schlag. Die Hotels am Roten Meer blieben nahezu leer. An den Pyramiden von Gizeh warteten Kamel- und Pferdebesitzer vergebens auf Kunden. Und wenn einmal Besucher auftauchten, stürzte sich die Masse der verzweifelten Führer auf den Touristenbus, brüllte und hämmerte gegen die Türen. Konkurrenten wurden fortgejagt, teilweise verprügelt. Die Not stand den Menschen in die Gesichter geschrieben. Um größere Ausschreitungen zu verhindern, musste nicht selten die Tourismuspolizei eingreifen. Doch es reichte hinten und vorne nicht. Keine Touristen, kein Geld, hungernde Kinder, abgemagerte Reittiere. Am Ende der Saison sah man in der Nähe der Pyramiden verendete Pferde und Kamele. Die Halter hatten die siechen Tiere einfach zurückgelassen. Ihnen war das Geld für Futter ausgegangen.
Bis 2013 hatten rund 15 Prozent der Ägypter ihren Job verloren, weil kein Unternehmer mehr investierte. Die ausländischen Investitionen sanken von 6,4 Milliarden Dollar vor der Rebellion auf 500 Millionen. Ägyptische Zeitungen wie die Daily News berichteten im September 2013, dass laut einer Umfrage 62 Prozent der Ägypter angaben, ihre Lebensbedingungen hätten sich in den letzten Jahren verschlechtert. Von Revolution wollte in dieser Situation kaum noch jemand etwas hören.