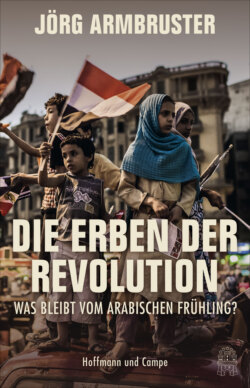Читать книгу Die Erben der Revolution - Jörg Armbruster - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Ende der Brüder
ОглавлениеEs war für die Muslimbrüder eine einmalige Chance gewesen in ihrer mehr als neunzigjährigen Geschichte. Endlich konnten sie ein Land und eine Gesellschaft in ihrem Sinne regieren und gestalten. Warum haben sie sie verspielt – innerhalb von nur zwei Jahren? Warum sind so schnell aus Anhängern Feinde geworden, aus Wählern Gegner? Wieso folgte auf den kurzen Höhenflug so rasch der lange Absturz? Wie wurde aus einem Präsidenten ein politischer Gefangener?
Viele Ägypter hatte vermutlich die Aggressivität abgeschreckt, mit der die Muslimbrüder ihren Wahlkampf führten. Immerhin hatten sie in den beiden Revolutionsjahren fünfmal zur Wahlurne gehen müssen. Das letzte Mal im Dezember 2012 bei der Abstimmung über die neue, von den Muslimbrüdern formulierte Verfassung.
Damals, vor dem Verfassungsreferendum, waren sie durch die Straßen gefahren, auf ihre Lastwagen plärrende Lautsprecher montiert.
»Ein Ja zur Verfassung bedeutet Stabilität!«, dröhnte der Slogan, der auch überall auf großen Transparenten zu lesen stand. Die Muslimbrüder waren aufmarschiert, bärtig und grimmig. Ein paar Hundert neugierige Zuschauer drängten sich vor den Lastwagen, sie wussten, die Wahlhelfer würden kleine und größere Geschenke verteilen, Kanister mit Speiseöl, Säcke mit Reis, Tomaten, Brot. Die Brüder hatten ein klares Ziel vor Augen: Ihre Verfassung musste auch auf den letzten Metern gegen die Liberalen verteidigt und dann an den beiden Wahlsamstagen über die Ziellinie gebracht werden. Kritische Stimmen fanden kein Gehör. Ein Redner verkündete: »Wer gegen die Verfassung ist, der ist gegen den Islam.« Die Muslimbrüder wussten, solche Totschlagargumente zogen bei vielen frommen Bürgern. Fast im Alleingang hatten die Muslimbrüder und Salafisten diesen Verfassungsentwurf formuliert – ganz im Geiste der Scharia. Die Minderheit der Liberalen hatte das Verfassungskomitee im September verlassen, aus Protest gegen die Kompromisslosigkeit der islamistischen Mehrheit. Mit dieser Verfassung unternähmen die Muslimbrüder den Versuch, einen religiös eingefärbten Einheitsstaat zu bilden, so der Vorwurf der liberalen Minderheit. Islamistische Einfalt solle die Vielfalt des Landes verdrängen.
Den Streit um die Verfassung setzten die Parlamentarier in den Straßen fort. Es kam zu zum Teil heftigen Kämpfen zwischen den verfeindeten Parteien. Das Land war wieder einmal gespalten.
Gespalten war auch die Regierung Mursi selbst – das erklärte mir einer der Berater des Präsidenten. Mursis Palast in Heliopolis, sagte er, sei ein Spiegelbild der Gesellschaft. Auf der einen Seite gebe es die Hardliner der Muslimbrüder. Auf der anderen Seite ständen die liberalen Berater. Bislang hätten die Hardliner gesiegt, erzählte er. Zum Beispiel an jenem 22. November 2012, als Mursi seine berüchtigten Verfassungsdekrete verkündete, mit deren Hilfe er die Justiz entmachten wollte. Selbst sein Stellvertreter, Vizepräsident Mahmut Makki, konnte ihn nicht davon abbringen, obwohl auch Mursi ahnte, welche Reaktionen das im Land auslösen würde. Bei den Unruhen in den folgenden Tagen starben neun Menschen. Doch alle Warnungen wurden in den Wind geschlagen. Mursi blieb beratungsresistent und starrköpfig.
Zur Niederlage der Brüder hat zweifellos genau diese Starrköpfigkeit beigetragen – ein Verhalten, das sie sich während der Jahrzehnte im Untergrund angeeignet hatten. Die Isolation in Wüstengefängnissen, die Grausamkeit der Folter, die Trennung von ihren Familien, all das haben sie nur überlebt, weil sie unbeirrt an ihrem Glauben festhielten. Nur Gott und die Brüder spendeten Licht in der Dunkelheit. Wer im Gefängnis saß, konnte sicher sein, dass die Brüder sich um die Familie, die man zurückgelassen hatte, kümmern. Nur bedingungsloser Zusammenhalt und das Gefühl, jeder kann sich auf jeden verlassen, machten ein Überleben möglich. Für Abweichungen, Kritik, für so etwas wie Reformdiskussionen war da kein Platz.
Aber was im Untergrund und im Kampf Stärke bedeutet, war im öffentlichen Raum und auf dem politischen Parkett eine fatale Schwäche. Mit ihrer in der jahrzehntelangen Illegalität eingeübten Unbeugsamkeit gruben sich die Muslimbrüder in der kurzen Zeit der Legalität und der Wahlerfolge ihr eigenes Grab. Statt Starrsinn wäre Kompromissbereitschaft gefragt gewesen, statt Abschottung Offenheit, statt mit erhobenem Zeigefinger zu predigen, hätten sie zuhören müssen. Doch die Muslimbrüder mauerten und setzten lieber auf Märtyrertum als auf Machtteilung, um ihren Scharia-Staat durchzusetzen. Und der war mit den jungen Menschen vom Tahrir-Platz nicht zu machen.
Das belegen auch Ergebnisse soziologischer Untersuchungen. So war die Zahl derer, die die Scharia zur Grundlage der Gesetzgebung machen wollten, kontinuierlich von 48 Prozent im Jahr 2001 auf 28 Prozent im Jahr 2011 gesunken, wie der amerikanische Soziologieprofessor Mansoor Moaddel Anfang 2012 ermittelt hatte. Die Zahlen decken sich mit den Forschungsergebnissen der Studie Zwischen Ungewissheit und Zuversicht – Jugend im Nahen Osten und in Nordafrika von Jörg Gertel und Ralf Hexel. Die Autoren stellten fest, dass für die überwältigende Mehrheit der jungen Ägypter ein demokratischer Staat die erste Wahl sei und nur eine Minderheit von 13 Prozent sich einen Religionsstaat auf der Grundlage der Scharia wünschte. Keine gute Voraussetzung für die Politik verbissener Islamisten.
Nach dem knappen Wahlsieg 2012 versuchte Mohamed Mursi sich mit dem Militär zu arrangieren. Die Generäle akzeptierten den zivilen Präsidenten zunächst, wollten seine Machtbefugnisse aber radikal einschränken. Um das zu verhindern, sagte Mursi ihnen zu, im Falle seines Wahlsieges nicht an den Privilegien des Militärs zu rühren. Parallel zur zweiten Runde der Präsidentenwahl sicherte sich der seit 2011 regierende Militärrat per Dekret die legislative Macht zu sowie die Kontrolle über den Haushalt. Der Präsident sollte lediglich noch das Kabinett ernennen dürfen sowie Gesetze annehmen oder ablehnen, nicht aber in die Belange des Militärs eingreifen.
Vermutlich haben schon damals etliche Generäle nach Mitteln und Wegen gesucht, wie sie Bruder Mursi loswerden könnten. Dieser versäumte es, andere Institutionen des Staatsapparates in seine Regierung einzubinden mit der Folge, dass es zwischen den Institutionen des alten Regimes und der neuen gewählten Regierung zu fortwährenden Machtproben kam. Dazu zählte die fast unkontrolliert arbeitende Staatssicherheit wie auch die Justiz selber, die in den folgenden Monaten immer wieder wichtige Gesetze der neuen Regierung kassierte. Am 14. Juni 2012 etwa löste das Oberste Verfassungsgericht das ein halbes Jahr zuvor gewählte und von den Islamisten dominierte Parlament auf mit der fadenscheinigen Begründung, Teile des Wahlgesetzes seien illegal. Eins der Mitglieder des Hohen Gerichts war die Richterin Tahani al-Gebali. Sie sollte ein Jahr später beim Sturz des Präsidenten eine wichtige Rolle spielen.
Am 30. Juni hob Präsident Mursi per Dekret das Urteil des Verfassungsgerichts auf und setzte das Parlament wieder ein. Es war eine seiner ersten Amtshandlungen.
Auch große Teile der Wirtschaft versuchten durch Boykott, Mursi und seinen Muslimbrüdern das Wasser abzugraben – sprichwörtlich: Aus den Wasserleitungen in den Badezimmern oder Küchen kam häufig statt Wasser nur Röcheln. Erst nach dem Putsch gab es wieder regelmäßig Wasser. Stromausfälle häuften sich im Winter 2012, nach dem Putsch vom 3. Juli 2013 hielten sie sich im üblichen Rahmen. Auch war es nach diesem Stichtag plötzlich mit der Benzinknappheit vorbei. Die Drahtzieher hinter dieser künstlichen Verknappung wussten: Die Ägypter wollen Brot und Bohnen auf dem Tisch und bezahlbares Benzin im Tank, sonst gehen sie wieder auf die Straße.
Doch die Regierung Mursi allein verantwortlich zu machen, wäre falsch. Der Niedergang der ägyptischen Wirtschaft hatte schon vor 2011 begonnen. Den Muslimbrüdern gelang es nicht, ihn zu stoppen, denn sie verstanden viel von Wohlfahrt, aber wenig von Wirtschaft. Aber selbst einem hochqualifizierten Wirtschaftspolitiker wäre es kaum möglich gewesen, innerhalb eines einzigen Jahres ein seit Jahrzehnten heruntergewirtschaftetes Land zu reformieren. Außerdem waren weder die Europäische Union noch Deutschland bereit, durch Kredite und Budgethilfen das Land zu konsolidieren, so wie sie heute den Putschpräsidenten Abdel Fattah al-Sisi mit Millionenbeträgen stützen. Auch der von Mursis Regierung beantragte 4,8-Milliarden-Dollar-Kredit des Internationalen Währungsfonds wurde nie überwiesen, weil sich die Muslimbrüder schwertaten mit den drastischen Sparauflagen des IWF. Sie hätten in erster Linie die Ärmsten getroffen. Auch soll das Militär die Zustimmung zu dem Kredit verweigert haben, um das Land »vor einem Hineinregieren aus dem Ausland zu schützen«. Ein paar Jahre später hatten die Generäle diese Sorge nicht mehr: Sie beantragten beim IWF einen Milliardenkredit und bekamen ihn.
Eine weitere entscheidende Schwäche der neuen Regierung war: Mubaraks alter, fast tot geglaubter Sicherheitsapparat feierte unter Mursi fröhliche Urständ. Im Oktober 2012 stellte Amnesty International fest: »Präsident Mohamed Mursi hat die historische Chance, mit dem blutigen Vermächtnis von Polizei und Armee zu brechen, verspielt. Er muss sicherstellen, dass die Sicherheitsorgane zukünftig nicht mehr außerhalb des Gesetzes stehen.«
Auch ägyptische Menschenrechtsgruppen warfen Mursis Innenminister vor, Polizeifolter sei wieder an der Tagesordnung. Mursi entließ ihn zwar, doch nur, um einen »scharfen Hund« durch einen noch schärferen zu ersetzen – einen Polizeigeneral, der sich bereits zu Mubaraks Zeiten durch seine Brutalität hervorgetan hatte. Mit dieser Ernennung hatte Mursi den letzten Rest von Glaubwürdigkeit auch bei vielen seiner Brüder verspielt. Der Marsch durch die Institutionen, auf dem sich die Muslimbrüder wähnten, endet im Frühjahr 2013 abrupt in einer Sackgasse.
Rücktrittsforderungen werden immer lauter, sie kommen diesmal nicht mehr nur von den säkularen Parteien und den alten Eliten. Junge Aktivisten schließen sich zusammen und proben wieder den Aufstand, diesmal gegen Mursi. Im ganzen Land liefern sie sich erbitterte Straßenschlachten mit Mursi-Anhängern. Ende Juni drohen die Unruhen zu eskalieren. Am 1. Juli greift Verteidigungsminister Abdel Fattah al-Sisi ein und setzt seinem Vorgesetzten, dem ägyptischen Präsidenten Mohamed Mursi, die Pistole auf die Brust.