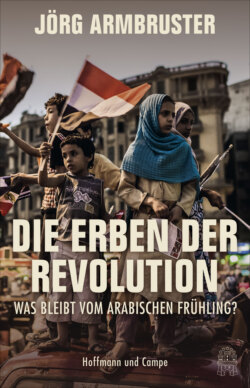Читать книгу Die Erben der Revolution - Jörg Armbruster - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die frommen Trittbrettfahrer vom Tahrir-Platz
ОглавлениеDie Muslimbrüder traten in den Tagen und Wochen der Großdemonstrationen erst spät in Erscheinung. Genau genommen erst, als sie Gefahr liefen, den Anschluss an die Rebellion und womöglich an das neue Ägypten zu verpassen. Das verwunderte. Schließlich hatten sie seit 1928, seit ihrer Gründung, auf eine Zeit wie diese gewartet. Sie hatten Illegalität, Gefängnis und Folter ertragen und gehofft, eines Tages die Macht in Ägypten übernehmen zu können. Es gibt in der ägyptischen Opposition kaum eine andere Gruppe, die stärker unter Repressalien zu leiden hatte als die Muslimbrüder. Doch sie hatten sich immer behauptet. Warum also dieses Zögern?
Ein Exbruder, Abd al-Galil al-Scharnubi, der als Internetbeauftragter für den späteren Präsidenten Mohamed Mursi in der Parteizentrale gearbeitet hatte, klärte mich damals auf.
»Mursi hatte zunächst angeordnet, wir beteiligen uns nicht, wir wissen nicht, wohin das führt. Einige Muslimbrüder beschimpften die Demonstranten anfangs sogar als Verräter. Später haben sie dann eng mit dem Militär zusammengearbeitet. Ihre eigenen Interessen und Ziele sind ihnen wichtiger als die der Nation.«
Al-Scharnubi betreute im Januar 2011 die Internetpräsenz der frommen Brüder und hätte gerne auf ihrer Website zur Unterstützung aufgerufen. Doch sein Vorgesetzter Mohamed Mursi, der seit Anfang 2000 zum engen Führungskreis der muslimischen Bruderschaft gehörte, verbot es. Der Koran fordere Gehorsam gegenüber der Obrigkeit, hieß es. Eine solche Rebellion käme für sie nicht infrage. Als er diese Argumente hörte, warf al-Scharnubi die Brocken hin und trat aus der Bruderschaft aus. Leicht war ihm dieser Schritt nicht gefallen, schließlich hatte er der illegalen Organisation dreiundzwanzig Jahre angehört, hatte Höhen und Tiefen mitgemacht, die Angst vor Verhaftung erlebt, im Koranunterricht die Gemeinschaft Gleichaltriger genossen, aber auch allmählich eine tiefe Abneigung gegen den autoritären Führungsstil der Bruderschaft entwickelt: »Es gibt in der Muslimbruderschaft nur Gehorsam. Was die Spitze anordnet, muss getan werden. Fragen oder Diskussionen sind undenkbar.«
Als die Brüder dann doch noch auf dem Tahrir-Platz eintrafen, drängten sie sich bald in den Vordergrund. Ihre vollverschleierten Frauen kochten in den Seitenstraßen Essen, ful (Bohnen) in Fladenbrot, hartgekochte Eier mit Gurken und Tomaten. Freitags stieg einer ihrer Prediger auf ein Podest und hielt eine feurige Ansprache mit Parolen wie: »Der Islam ist die Lösung, der Koran ist unsere neue Verfassung!«
Die Säkularen ahnten schon damals, noch vor dem Sturz Mubaraks, wohin die Reise gehen würde, wenn die Muslimbrüder an die Macht kommen sollten. Schon jetzt war das lockere Bündnis der Säkularen der straff durchorganisierten Bruderschaft unterlegen, was die Koordination von Aktionen und die Formulierung von Forderungen betraf.
Am 18. Februar kehrte nach dreißig Jahren Exil der in Katar lebende islamistische Prediger Jusuf al-Qaradawi nach Kairo zurück und bestieg für die Freitagspredigt das Podest des Tahrir-Platzes. Eigentlich sollte einer der säkularen Organisatoren vor ihm reden. Anhänger Qaradawis drängten diesen jedoch ab, sodass nur der bärtige Bruder zu Wort kam. Der Mann, den die Ordner am Reden hinderten, war kein anderer als Wael Ghonim gewesen, einer der wichtigsten Köpfe der Rebellion.
Wes Geistes Kind Qaradawi ist, war aus seiner Freitagspredigt eine Woche nach Mubaraks Rücktritt mehr als deutlich zu hören:
»Immer und ewig hat Allah die Juden für ihre Korruption bestraft. Die letzte Strafaktion gegen sie wurde von Hitler durchgeführt. Abgesehen von allem, was er ihnen angetan hat – da wird auch übertrieben –, hat er ihnen doch gezeigt, wo sie hingehören. Dies war eine von Gott gewollte Bestrafung. Das nächste Mal wird sie in den Händen der Gläubigen sein.«
Solche von religiösem Fanatismus zerfressenen Geschichtsbilder sind weit verbreitet unter den Funktionären der Muslimbruderschaft. Als Qaradawi, der sonst seine Predigten über den Nachrichtensender Al-Jazeera verbreitet, an diesem Tag auch noch zur Rückeroberung Jerusalems aufforderte, kannte der Jubel seiner Anhänger auf dem Tahrir-Platz keine Grenzen.
Abd al-Galil al-Scharnubi, der Exbruder, äußerte mir gegenüber damals: »Die Muslimbrüder interessiert nur eins, sie wollen an die Macht. Selbst dann, wenn sie ihre früheren Partner verraten müssen. Das haben sie nach der Revolution gemacht. Sie stellen ihre Interessen über die der Nation.«
Zweifellos ein hartes Urteil, vielleicht etwas zu hart. Gefährlich für die Zukunft des Landes war, so die Sorge vieler Säkularer, dass Islamisten kein liberales und freiheitliches Klima zulassen wollten. Ob als Kulturwarte, die Kunst auf Korantauglichkeit überprüften und sich auch nicht scheuten, eine liberal denkende Direktorin der Kairoer Oper zu entlassen, ob als Sittenwächter, die auch die letzte Frau unter das Kopftuch zwingen wollten, ob als »Religionspolizisten«, die die Kopten drangsalierten – wo sie nur konnten, versuchten sie, alles Freisinnige als dekadent, verwestlicht oder gar als zionistisch zu verteufeln.
Viele Menschen, vor allem arme, sahen das anders. Die Muslimbrüder waren verfolgt, eingesperrt und gefoltert worden. Dennoch war es ihnen gelungen, sich im ganzen Land Einfluss zu verschaffen. Sie waren es, die in den Stadtvierteln der Ärmsten, in denen es so gut wie nichts gab – kein Wasser, keine Elektrizität, keine Schulen, keine medizinische Versorgung –, Präsenz zeigten und den Menschen halfen. In solchen Vierteln waren sie zu Hause und hier hatten sie 2011 und 2012 ihre meisten Wähler. In Moscheen richteten sie Wohlfahrtsprogramme für Arme aus, sie verteilten kostenloses Essen, ermöglichten Koranunterricht für Kinder. Sie verteilten Spielzeug, unterstützten arme Familien, kauften bei Schulbeginn Hefte und Stifte für die Kinder. In eigenen Gesundheitszentren machten sie bezahlbare Behandlung möglich. Wer als Kranker in solchen Stationen Hilfe suchte, bekam sie, ohne dass er dem Arzt erst einmal einen Umschlag mit Geld zustecken musste. Muslimbrüder galten als unbestechlich, und das stärkte ihren Ruf als fromme Menschenfreunde. Studentinnen boten sie Fahrdienste zu den Universitäten an, um sie vor Übergriffen in den überfüllten Bussen zu schützen, einzige Bedingung: Sie mussten ein Kopftuch tragen.
Die Muslimbrüder waren fast immer zur Stelle, wenn irgendwo im Land Not herrschte. Nach einem Erdbeben in Kairo waren sie es, die als Erste den Opfern Hilfe brachten, Zelte aufbauten für die, deren Häuser unbewohnbar waren, Verletzte versorgten und in Krankenhäuser transportierten, Trost spendeten und rasche Beerdigungen organisierten für die rund vierhundert Menschen, die damals ums Leben gekommen waren. Und natürlich verteilten sie auch den Koran, denn Hilfe ohne religiösen Hintergedanken gab es bei ihnen nicht. Das war im Oktober 1992. Der Staat erinnerte sich damals erst sehr viel später an seine Pflichten. Ähnlich war es im Februar 2007, als im Land die Vogelgrippe grassierte. Die Muslimbrüder schickten Experten aufs Land, um die Bauern zu beraten, wie sie ihre Hühner und Enten, aber auch sich selber schützen konnten. Von der Regierung kam nur der Befehl, Geflügel vorbeugend zu töten. Sie versprach den Kleinlandwirten Entschädigung, die aber nie ankam.
Der Staat duldete die Aktivitäten der Brüder daher, solange sie sich auf den Bereich der Wohlfahrt beschränkten, schlug aber immer dann mit Härte zu, wenn sie sich zu weit aus der Deckung wagten und aus der Wohlfahrt Wahlkampf zu werden drohte. Brüder als Politiker, das war unter allen Umständen zu verhindern. Dann waren schnell Einsatzkräfte unterwegs und verschleppten Funktionäre. Willfährige Gerichte verurteilten diese zu oft absurd hohen Gefängnisstrafen. Ein Mitglied der Bruderschaft erzählte mir einmal, er habe neben seiner Haustür immer eine Tasche stehen gehabt mit dem Nötigsten für einen Gefängnisaufenthalt – Zahnbürste, Seife, den Koran natürlich und ein bisschen Kleidung. Man bekäme nichts in diesen Gefängnissen und »die Polizisten lassen dir keine Zeit, zu packen – die zerren dich sofort mit«.
Trotz dieser ständigen Bedrohung für sich und seine Familie blieb er immer ein treuer Muslimbruder. »Wir verkörpern den wahren Islam. Von der Linie der Bruderschaft abzuweichen, wäre Verrat nicht nur an ihr, sondern am Islam selber, also Sünde. Lieber sterbe ich.« Während er redete, beugte er sich zu mir vor, seine Stimme wurde immer lauter. Sein grauer Bart zitterte, so erregt war er. Jedes Wort unterstrich er mit einer heftigen Bewegung seines Zeigefingers direkt vor meinem Gesicht, als er schließlich mit funkelnden Augen sagte: »Ihr im Westen könnt das nicht verstehen!«
Mit ähnlicher Leidenschaft mag auch Hasan al-Banna gesprochen haben, als er 1928 die Muslimbruderschaft gründete, als eine Bewegung gegen westlichen Werte-Import, als Trutzburg gegen die englischen Kolonialherren und ihre Vasallen, die Regierung und den ägyptischen König mit seinem Hofstaat, als Hüterin des wörtlich zu verstehenden Islam. Die Grundsätze der Organisation sind einfach und müssen als Gesetz bedingungslos befolgt werden: »Gott ist unser Ziel. Der Prophet ist unser Führer. Der Koran ist unsere Verfassung. Der Dschihad ist unser Weg. Der Tod für Gott ist unser nobelster Wunsch.«
Sätze wie diese klingen in europäischen Ohren verständlicherweise bedrohlich. Aber wie ernst sind sie gemeint? Spricht aus ihnen schon die Bereitschaft zur Gewalt, zum Terrorismus?
Einer der wichtigsten Vordenker der Muslimbrüder war der aus der Provinz Assiut stammende Lehrer und Literaturkritiker Sayyid Qutb, den Präsident Nasser 1966 im Gefängnis hinrichten ließ, weil er angeblich einen Aufstand geplant hatte. Ausschließen kann man das nicht, denn Qutbs Lehre vom Dschihad verlangt den bewaffneten Widerstand gegen alles Unislamische. Dazu rechnete er so gut wie alles, was aus dem Westen in die islamische Welt eindrang, aber auch muslimische Regierungen, die seiner Meinung nach die Religionsgesetze nicht beachteten und daher als Verräter zu gelten hatten. Islam oder Barbarei, nur diese beiden Möglichkeiten ließ das manichäische Weltbild dieses geistigen Vaters aller Dschihadisten zu.
In seiner Jugend galt Qutb als koranfest und gottergeben, nicht aber als fanatisch. Eine Sehnsucht nach reiner Tugendhaftigkeit und absoluter Gerechtigkeit zieht sich als roter Faden durch das Leben dieses Asketen. Ein Besuch in den USA machte ihn zum Radikalen. »Vor allem schockierten ihn die sexuellen Freiheiten, die er dort antraf. Er war ein sehr asketischer und moralischer Mann. Als er 1951 zurückkam, schloss er sich den Muslimbrüdern an und rief zum Dschihad auf.«
Das berichtete mir der inzwischen verstorbene Gamal al-Banna, Bruder des Gründers der Muslimbrüder und Freund von Qutb, Ende der neunziger Jahre in seinem bis unter die Decke mit Büchern vollgestellten Büro.
»Die Regierung Nasser hatte damals zur Radikalisierung der jungen Muslimbrüder entscheidend beigetragen. Sie wurden genauso wie Sayyid Qutb in den Gefängnissen auf das brutalste gefoltert. Für sie konnte ein solches menschenverachtendes Regime nur gottlos sein. Das war eine einschneidende Erfahrung für Qutb«, so Gamal al-Banna.
Anfang der sechziger Jahre schrieb Qutb im Gefängnis sein Buch Wegmarken. Zum bewaffneten Widerstand gegen unislamische Regierungen ruft er darin auf. Es sei Pflicht jedes gläubigen Muslims, gegen Herrscher und antiislamische Ideologien wie dem Sozialismus mit allen Mitteln zu kämpfen, schreibt er. Wegmarken ist für viele Dschihadisten noch immer das, was für marxistische Revolutionäre lange Zeit Lenins Schrift Was tun? war – ein Leitfaden für die Revolution. Auch für Aiman al-Zawahiri war Qutb so etwas wie der Vordenker des Dschihad. Al-Zawahiri gründete zusammen mit Osama bin Laden Anfang der neunziger Jahre die Terrorgruppe Al-Qaida.
Die Führung der Muslimbruderschaft schwor zwar Mitte der siebziger Jahre jeder Form von Gewalt ab, doch von Sayyid Qutb und seinem Buch Wegmarken distanzierte sie sich nur zögerlich.
Die Bruderschaft blieb auch nach diesem Kurswechsel eine Organisation mit klar definierter Hierarchie, aber undurchsichtigen Entscheidungswegen. An der Spitze steht der vom neunzigköpfigen Schura-Rat ernannte, aber nicht absetzbare oberste Führer, der Murschid, dessen Befehle und Anweisungen kein Mitglied infrage stellen darf oder kontrollieren kann. Auch der Schura-Rat darf die Arbeit des Murschid nicht kontrollieren. Die Muslimbruderschaft ist demnach streng nach dem Führerprinzip organisiert. Mitglied kann nur werden, wer blinden Gehorsam und Unterwerfung schwört.
Kamal al-Helbawi, ein altgedienter Muslimbruder, der 2011 der Bruderschaft enttäuscht den Rücken gekehrt hat, bringt dieses Prinzip auf eine einfache Formel: »Wenn du nicht gehorchen kannst, dann kannst du nicht Mitglied sein.« Die Bruderschaft vergleicht der heute über Achtzigjährige mit einer stalinistischen Partei, die Abweichungen von der Parteilinie hart bestraft. Ausgetreten war er nach dreißig Jahren Mitgliedschaft. In den neunziger Jahren hatte er in Großbritannien den »Muslimischen Rat« gegründet, eine britische Dachorganisation von über 250 muslimischen Vereinen und Moscheen. Außerdem geht auf sein Engagement die Gründung der »Weltversammlung der muslimischen Jugend« in Saudi-Arabien zurück, der westliche Geheimdienste Nähe zum Terrorismus nachsagen.
Abd al-Galil al-Scharnubi, der Dissident, den ich auf dem Tahrir-Platz kennengelernt hatte, war seit seinem vierzehnten Lebensjahr Mitglied gewesen: »Kinder wie ich wurden von ihnen einer regelrechten Gehirnwäsche unterzogen. Sie haben mich bestraft, wenn sie glaubten, ich hätte einen Fehler gemacht, sie haben mich belohnt, wenn ich alles richtig gemacht habe. Wir sollten möglichst wenig Kontakt zu Nichtmitgliedern haben. Uns boten sie daher alles. Sie haben uns ein Gemeinschaftsgefühl und Anerkennung gegeben. Wir fühlten uns als kleine Erwachsene. So etwas hatten wir in unserem Dorf nie erlebt. Für uns Heranwachsende war das damals wunderbar.«
Im Januar 2011 bekam er das andere Gesicht dieser Kader-Organisation zu sehen. Der Kommandostil seines Vorgesetzten Mohamed Mursi stieß ihn zunehmend ab, besonders seit er, Scharnubi, auf dem Tahrir-Platz bei den säkularen Rebellen eine ungewöhnlich freie und brüderliche Atmosphäre erlebt hatte. »Aber wer sich den Muslimbrüdern zu entziehen versucht«, so der 2012 achtunddreißig Jahre alte Scharnubi, »der riskiert, fertiggemacht zu werden. Als bekannt wurde, dass ich austreten will, haben sie eine Kampagne gegen mich gestartet. Sie haben in meinem Heimatdorf verbreitet, ich sei vom Glauben abgefallen, tränke Alkohol. Meiner Frau haben sie gesagt, ich ginge zu Prostituierten.« Als er mir dies 2012 in einem Kaffeehaus in Kairo erzählte, ließ er die Tür keinen Moment aus dem Blick. »Ich habe Angst. Sie haben mir gedroht. Vor ein paar Tagen haben mich zwei Bewaffnete angehalten. Als zufällig andere Männer dazukamen, sind sie geflohen.«
Viele Mitglieder wurden zerrieben im Machtkampf zwischen der Betonfraktion um den stellvertretenden Führer der Bruderschaft, Mohamed Khairat al-Schater, und den Vertretern einer liberalen Fraktion. Al-Schater duldete keine Abweichung von der von der Führung vorgegebenen Lesart des Islam. Der liberale Flügel ließ Diskussionen und Neuinterpretationen des Koran zu, wenn auch in engen Grenzen. Für sie war die Bruderschaft kein Selbstzweck wie für al-Schater und dessen Gefolgsleute, zu denen auch der spätere Präsident Mohamed Mursi gehörte. Die reformbereiten Mitglieder wie der spätere unabhängige Präsidentschaftskandidat Abdel Moneim Abul Fotuh wurden von al-Schater nach und nach aus dem Führungsgremium gedrängt, bis Abul Fotuh die Bruderschaft 2011 ganz verließ und eine eigene Partei gründete, die »Partei Starkes Ägypten«, ebenfalls islamistisch geprägt, aber zugänglich für verschiedene Strömungen. Gerade er wäre mit seiner Offenheit in der Lage gewesen, die Muslimbrüderschaft für junge Menschen attraktiv zu machen. So nutzte er Facebook, Twitter und Co., um mit ihnen zu diskutieren. Außerdem verlangte er eine strikte Trennung zwischen Politik und Religion – für die »Betonbrüder« zweifellos ein Sündenfall. Während des Präsidentschaftswahlkampfs 2012 versprach er – im Fall eines Sieges –, als Präsident mindestens die Hälfte aller Kabinettsposten mit Politikern unter fünfundvierzig Jahren zu besetzen. Doch dieser Lockruf verfing nicht bei den Ägyptern. Bei der Wahl schied er mit 17 Prozent der Stimmen nach dem ersten Wahlgang aus. Heute wartet er wie die meisten Islamisten im Gefängnis auf seinen Prozess wegen angeblicher Unterstützung einer Terrororganisation. Verhaftet worden war er im Februar 2018 unmittelbar nach seiner Rückkehr aus London, wo er in der BBC Präsident al-Sisi scharf kritisiert hatte.
Bei den ersten Parlamentswahlen errangen die Muslimbrüder zwar zusammen mit den Salafisten mehr als 65 Prozent der Stimmen, aber glücklich waren sie mit diesem Sieg nicht. Im Grunde lehnten die Salafisten die parlamentarische Demokratie als unislamisch ab. Für diese frommen Männer in den weißen Hemden, die nur bis zur halben Wade reichen durften, waren die Muslimbrüder in ihren westlichen Anzügen bereits Teil des falschen Systems, verteidigten sie doch beispielsweise die im Wahlgesetz vorgesehene Vorschrift, Frauen als Kandidaten aufzustellen! Die Salafisten fügten sich zwar diesem Gesetz zähneknirschend, wollten aber mit ihrer »Partei des Lichts« in Ägypten einen Gottesstaat nach dem Vorbild Saudi-Arabiens errichten und wurden dafür von Riad finanziert. Die Muslimbrüder hingegen bekamen ihr Geld von dem kleinen Rivalen des großen Nachbarn, von Katar.
Die Parlamentswahlen 2011/12 waren für die Islamisten zweifellos ein Erfolg, aber er sagte nichts über den Rückhalt aus, den die »Freiheits- und Gerechtigkeitspartei« im Land hatte.
Die Präsidentenwahlen verliefen jedenfalls unbefriedigender. In der ersten Runde 2012 hatte Kandidat Mohamed Mursi weniger als ein Viertel aller abgegebenen Stimmen bekommen, eine Enttäuschung für die Führungsriege, den Murschid und seinen Schura-Rat. Im entscheidenden zweiten Wahlgang siegte er mit knapp 51 Prozent gegen einen Kandidaten aus dem alten Mubarak-Lager. Dessen Nähe zum abgesetzten Präsidenten war ausschlaggebend für den Wahlerfolg Mursis, nicht Mursis Mitgliedschaft bei den Muslimbrüdern, deren zentrale Forderung, die Scharia zum obersten Gesetz des Landes zu erklären, von immer mehr Ägyptern abgelehnt wurde.
»Imame haben wir genug in unserem Viertel. Wir brauchen Politiker, die unsere Probleme lösen«, sagte mir damals ein Ägypter in dem Armenviertel Imbaba, einem riesigen Stadtteil von Kairo, wo nicht nur verelendete Tagelöhner und vom Land zugezogene Fellachen in oft erbärmlichen Unterkünften hausten, sondern auch kärglich bezahlte Staatsangestellte wie Lehrer. Zu kleine Wohnungen für zu große Familien, keine festen Jobs, ständig steigende Lebensmittelpreise. Die Menschen hier wollten nicht mehr Gebete und Gebote, sondern mehr Geld und soziale Gerechtigkeit.