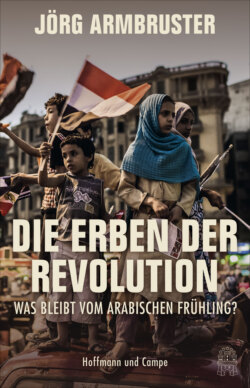Читать книгу Die Erben der Revolution - Jörg Armbruster - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wael Abbas geht online
ОглавлениеEiner, der später auf dem Tahrir-Platz eine wichtige Rolle spielen sollte, war schon damals dabei – der Blogger und Journalist Wael Abbas. 2005 war für ihn das Schlüsseljahr. Seine erste Demo mit Kifaja, seine ersten »Nieder mit Mubarak«-Rufe, seine erste Konfrontation mit der Polizei. Das war am 20. Mai 2005. »Bei dieser von Kifaja initiierten Demonstration habe ich zum ersten Mal in meinem Leben die Polizeibrutalität am eigenen Leib erlebt«, erzählt er mir im April 2011 auf der Nil-Insel Zamalek, in der dortigen Buchhandlung Diwan. »Die Funktionäre der Staatspartei NDP und die Staatssicherheit hetzten Schlägertrupps und Gangster auf uns. Die droschen mit Knüppeln auf uns ein. Sie zerrten die Frauen an den Haaren und rissen ihnen die Kleider vom Leib. Sie stahlen alles, was wir dabeihatten, Telefone, Kleider, Geld. Ich habe damals so viel wie möglich fotografiert, aber niemand wollte meine Bilder veröffentlichen. Alle hatten Angst.«
Nach dieser Erfahrung beschloss Wael Abbas, sich auf die Dokumentation von Polizeiwillkür zu spezialisieren, ging mit seiner kleinen Videokamera zu Demonstrationen, drehte die Prügelpolizisten und veröffentlichte die Videos in seinem Blog »Misr Digital« (Ägypten Digital). »Wir haben uns damals überlegt, was wir machen können. Die Medien waren ja alle in der Hand des Staates. Und gegen die Polizei hatten wir ohnehin keine Chance. Also war das Bloggen im Internet unsere einzige Chance.«
Dass die Regierung ihn hasste und immer wieder verhaftete, versteht sich schon fast von selbst. »Gefoltert worden bin ich Gott sei Dank nie. Aber ich habe die Schreie gehört.« Sein Arbeitgeber, eine renommierte Tageszeitung in Kairo, entließ ihn. »Von da an war ich offiziell geächtet. Freunde, mit denen ich am Telefon gesprochen hatte, bekamen anschließend Schwierigkeiten mit der Staatssicherheit.« Er zuckt die Schultern bei unserem Gespräch zwei Monate nach dem Sturz des Dauerdespoten, als wolle er sagen: alles normal, nichts Besonderes in Mubaraks Ägypten.
Doch dann bekam er Schwierigkeiten von einer ganz anderen Seite. 2007 schloss YouTube seinen Account, seine Videos wurden gelöscht. »Ich war schockiert«, erzählt er fassungslos. »Damit hatten wir nicht gerechnet.« Vermutlich hatte das Innenministerium bei YouTube interveniert. Gegenüber CNN erklärte das Videoportal, etliche der Videos verstießen gegen die Richtlinien der Firma, weil sie gewalttätige oder blutige Inhalte zeigten. Tatsächlich sah man in einem Film, wie ein Polizist einem verhafteten Taxifahrer bei einem Verhör den Polizeiknüppel in den After stieß. Dessen Schmerzensschreie schienen den Polizisten nur noch anzuspornen. »Ich dachte immer, die sozialen Medien seien unsere Verbündeten, sie würden all das zeigen, was die Mächtigen im Verborgenen taten. Aber davon kann man heute nicht mehr ausgehen. Es ist, als hätten YouTube oder Facebook die Folterbilder von Abu Ghraib gelöscht, weil die zu grausam sind.« Auch mit seiner E-Mail-Adresse bei Yahoo bekam er damals bald Schwierigkeiten.
Trotz solcher Rückschläge hatte Wael Abbas weitergemacht. »Ich bin kein Pyjamahidin«, sagte er in unserem Gespräch, kein Mudschahidin im Pyjama, kein Kämpfer im Schlafanzug also, kein radikaler Stubenhocker. »Ich muss mich einmischen, unter die Leute gehen.« Selbst nach dem Putsch des heutigen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi am 30. Juni 2013 blieb Wael Abbas bei seiner selbst gestellten Aufgabe. Er dokumentiert die unter dem Putsch-Präsidenten wieder zunehmende Polizeiwillkür und veröffentlicht sie auf Facebook, Twitter oder YouTube – so lange, bis 2017 Twitter sein Benutzerkonto abschaltete. Vermutlich fürchtete die Firma Schwierigkeiten für ihr Ägyptengeschäft.
Dass er nach dem Putsch 2013 mit seiner Kamera mehr aufzunehmen hatte als zu Mubaraks Zeiten, kann jede Menschenrechtsorganisation bestätigen. In ägyptischen Gefängnissen wird wieder gefoltert, auf Polizeistationen zu Tode geprügelt. Experten sprechen von mindestens 60000 politischen Gefangenen. Das geringste Vergehen, die kleinste Auffälligkeit in der Öffentlichkeit kann zur Verhaftung führen. Wieder verschwinden Menschen hinter den Mauern von Gefängnissen, manche für Jahre, andere, wenn sie mehr Glück haben, nur für Wochen – ohne Anklage, ohne Rechtsbeistand. »Es ist schlimmer als unter Mubarak«, sagen mir Freunde.
Am 23. Mai 2018 sollte dies auch Wael Abbas zu spüren bekommen. Ziemlich genau dreizehn Jahre war es her, dass er mit seiner Arbeit begonnen hatte. Doch das, was er an diesem Mittwoch erlebte, sollte alles übertreffen, was ihm bislang widerfahren war. Im Morgengrauen dringt das schwer bewaffnete Rollkommando einer Spezialeinheit in seine Wohnung ein und verhaftet ihn. Man legt ihm Handschellen an, verbindet seine Augen und verschleppt ihn. Erst sehr viel später erfahren seine Freunde, dass er im berüchtigte Tora-Gefängnis festgehalten wird. Die Vorwürfe, die gegen ihn erhoben werden: »Mitgliedschaft in einer Terrorgruppe«, »Verbreitung falscher Nachrichten« und »Missbrauch der sozialen Medien«. Die Standardanklage für solche Fälle.
Sieben Monate lang saß Ägyptens berühmtester Blogger im Gefängnis und wartete auf seinen Prozess. Dann, endlich, am 12. Dezember 2018, entschied das Kriminalgericht Gizeh, ihn aus dem Gefängnis zu entlassen mit der Auflage, sich zweimal in der Woche bei der Polizei zu melden. Alle fünfundvierzig Tage prüft ein Gericht nun, ob die bedingte Freilassung weiterhin gilt. Kein Wunder, dass Abbas das Risiko nicht eingehen möchte, mit einem ausländischen Journalisten zu sprechen. Verbreitung falscher Nachrichten an die ausländische Presse, Verschwörung gegen den Staat wären noch die geringsten Vergehen, die ein Staatsanwalt aus einer solchen Begegnung konstruieren könnte.
Kifaja war für Ägypter wie Wael Abbas und für viele andere so etwas wie die Schule des Widerstands. Was ist aus ihr geworden? Gibt es sie noch? 2011 hatte sich die lose Bewegung mit anderen Protestgruppen zusammengeschlossen. Heute ist es um Aktive wie George Ischak still geworden, ebenso um den mutigen Richter Tariq al-Bischri, der 2011 noch eine Verfassungskommission geleitet hatte. Braucht das Land nicht gerade heute wieder eine solche Bewegung?
George Ischak, danach gefragt, zögert mit der Antwort. Dann: »Heute ist die Angst zu groß. Keiner hat den Mut, sich zu bewegen. Man wird schnell als angeblicher Terrorist angeklagt. Wir haben uns zwar wieder zusammengeschlossen, aber wir werden ständig überwacht. Auch wir können uns so gut wie nicht bewegen. Ich hoffe, dass die Regierung die Tür ein wenig öffnet, sonst sehe ich schwarz.«
Die Bewegung ist heute handlungsunfähiger als zur Zeit von Mubarak, doch ihr großes Verdienst bleibt: Kifaja hat als erste Bewegung den Bürgern in Ägypten gezeigt, dass Kritik und Widerstand möglich sind, auch gegen despotische Mächte und trotz aller berechtigten Angst vor Repression und Folter.
Einer ihrer Wortführer, der Erfolgsschriftsteller Ala al-Aswani, schreibt auf jeden Fall weiter streitbare kritische Zeitromane, auch wenn er den Putsch des Generals und Verteidigungsministers Abdel Fattah al-Sisi gegen den gewählten Präsidenten und Muslimbruder Mohamed Mursi lange verteidigt hatte. Er sei notwendig gewesen, sagte er in einem Interview mit dem Nachrichtenportal Qantara. Mursi und seine Muslimbrüder hätten zuletzt wie Terroristen gehandelt, die die demokratischen Errungenschaften des Landes zerstören wollten. Zu einem blutigen Bürgerkrieg hätten sie aufgerufen, der Armee sei gar nichts anderes übrig geblieben als einzugreifen. Diese Haltung: eine unter ägyptischen Intellektuellen weit verbreitete Muslimbruder-Phobie. Allerdings gehört er schon lange nicht mehr zu den Sympathisanten des neuen Präsidenten al-Sisi. Der Hauptfehler von Kifaja und all der anderen Tahrir-Platz-Aktivisten sei es gewesen, »dass wir nach dem Rücktritt Mubaraks den Tahrir-Platz verlassen haben, ohne eine Kommission mit Vertretern der Revolution zu bilden. Man hätte zunächst solche Komitees in allen ägyptischen Regionen wählen sollen, dann erst hätten wir den Platz räumen dürfen«. Man habe sich, so Aswani, die Revolution vom Militär aus der Hand nehmen lassen und dadurch den Aufstieg al-Sisis ermöglicht.
In seinem neuen, bisher nur auf Arabisch erschienenen Roman Gomhorija kanu (Die Republik als ob) rechnet er mit der neuen Zeit in Ägypten ab. In Diktaturen sei alles nur »als ob«, alles nur Fake, die Wahlen, die Demokratieversprechen, die Politiker, das Leben bis tief in das Private hinein. Erscheinen musste das Buch in einem Beiruter Verlag, in Ägypten hatte sich kein Verleger gefunden. Ob der Roman in absehbarer Zeit in ägyptischen Buchhandlungen ausliegen wird, ist unwahrscheinlich. In seinem eigenen Land darf Ala al-Aswani seit 2014 nicht mehr publizieren. Ein Gericht in Kairo hat ihn wegen Beleidigung des Präsidenten, des Militärs und der Jurisdiktion angeklagt. Grund genug, das Land zu verlassen. Der bekannteste zeitgenössische ägyptische Schriftsteller lebt heute in den USA.