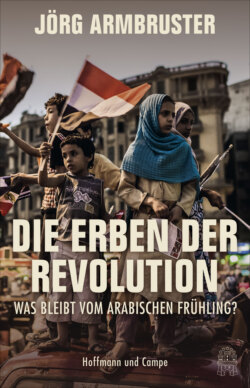Читать книгу Die Erben der Revolution - Jörg Armbruster - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ahmed Maher und die Bewegung »6. April«
ОглавлениеZu den Bewegungen, die die Vorgeschichte der »Arabellion« entscheidend mitgeprägt haben, gehört auch jene Facebook-Gruppe, die sich »6. April« nannte und die heute nur noch im Untergrund operieren kann.
Als ich 2011 den Ingenieur Ahmed Maher, einen der Gründer des »6. April«, zum ersten Mal traf, saß ein junger Mann vor mir mit einem freundlichen runden Gesicht, der eigentlich keine Lust hatte, einem ausländischen Fernsehsender ein Interview zu geben. »Warum soll ich? Von euch kommt doch nichts. Wir sind auf uns gestellt.« Es dauerte eine Weile, bis ich ihn zu dem Interview überreden konnte. Dann aber erzählte er von seiner Bewegung, seinen Plänen und seinen Vorstellungen von einem neuen Ägypten.
Auch seine Geschichte beginnt mit den Wahlen von 2005. Ahmed schloss sich 2004 zunächst der Kifaja-Bewegung an. Er arbeitete in der Parteizentrale der »Al-Ghad«-Partei, einer jener Parteien, die Mubarak aus Gründen der politischen Kosmetik zu den Wahlen zugelassen hatte und deren Spitzenkandidat nach den Wahlen zu vier Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Für Ahmed Maher und seine Freunde war nach diesem Willkürakt klar, dass mit diesem Staat keine Zusammenarbeit möglich ist. Von innen war das System nicht zu reformieren. Sie beschlossen, andere Wege zu suchen, um Reformen in ihrem Land zu erzwingen.
»Wir wollten als eine völlig unabhängige Bewegung starten. Wir wollten mit keiner der bekannten Parteien etwas zu tun haben«, erklärte Ahmed mir 2011 in Kairo. »Von der althergebrachten Politik hatten wir endgültig genug. Wir suchten nach neuen Taktiken, mit denen man einen Wandel herbeiführen kann. Aber gewaltfrei sollte es sein. Das war uns wichtig.«
Als am 6. April 2008 in der im Nildelta gelegenen Stadt Al-Mahalla al-Kubra mal wieder die Textilarbeiter streikten, weil die runtergewirtschaftete Staatsfirma »Mahalla Weaving and Spinnig Mill« mehrere Monatslöhne schuldig geblieben war, sahen Ahmed Maher und seine Mitstreiterin Israa Abdel Fattah ihre Chance. Sie gründeten die Facebook-Gruppe »6. April«. Mit dieser damals neuen Möglichkeit, die das Internet bot, wollten sie die streikenden Arbeiter unterstützen. Und sie hatten Erfolg. In kurzer Zeit konnten sie 76000 Facebook-Freunde gewinnen und miteinander vernetzen: »Unsere Hauptaufgabe besteht darin, die Menschen über ihre Rechte aufzuklären, sodass sie sich von ihren Fesseln befreien können.«
In Mahalla al-Kubra war die halbe Stadt auf den Beinen. Nicht nur die Textilarbeiter selber, auch ihre Frauen und Kinder unterstützten sie. Die schwarz uniformierte Polizei zog blank, schoss scharf und ging mit Knüppeln und Tränengas auch gegen Frauen und Kinder vor. Es gab zwei Tote, zahllose Verletzte und viele Verhaftungen. Von dieser Polizeibrutalität erfuhren die Leser der traditionellen Printmedien nichts. Auch das Staatsfernsehen verschwieg die tagelangen Auseinandersetzungen in der Textilstadt im Nildelta. Umso wichtiger war die Facebook-Seite der Maher-Gruppe. Auch in den nächsten Jahren streikten die Arbeiter dieser größten Staatsfabrik immer wieder für ein menschenwürdiges Leben, immer unterstützt von Ahmed Mahers Facebook-Bewegung.
Die Lage war jedoch desolat. 2005 hatte Mubarak versprochen, durch Privatisierung der Staatsbetriebe für einen Aufschwung zu sorgen, was bis zur Weltwirtschaftskrise 2008 auch mit erstaunlichen Zahlen gelang. Ägypten erlebte eine Wachstumsrate des Bruttosozialprodukts von bis 7,2 Prozent. Aus Kairos Stadtbild verschwanden die uralten Rostlauben, an deren Stelle jetzt Kleinwagen aus Asien die Straßen verstopften. Die teuren Restaurants am Nil waren ständig gut besucht. Dank der Privatisierung schien das Land aufzublühen. Doch bei näherem Hinsehen entlarvte sich der auch im Westen viel gepriesene Fortschritt als ein Rückschritt für die Mehrheit der Ägypter. So lebten 2008 über 21 Prozent der Menschen unterhalb der Armutsgrenze, acht Jahre zuvor waren es noch 16 Prozent gewesen. In absoluten Zahlen ausgedrückt heißt das, dass 2,5 Millionen Ägypter damals von weniger als 1,25 Dollar am Tag leben mussten, nach UN-Definition also in »extremer Armut«. Der Grund für die Verelendung: Die neuen Privatbetriebe übernahmen nur einen Teil der Arbeiter und Angestellten der Staatsbetriebe. Die anderen saßen auf der Straße, ohne Chance, neue Arbeit zu bekommen. Der Aufschwung kam nur der dünnen Oberschicht zugute.
Unter den 15- bis 29-Jährigen, einem guten Drittel der ägyptischen Bevölkerung, blieb die Arbeitslosigkeit trotz Aufschwung extrem hoch. 29 Prozent der jungen Männer fanden keine Arbeit. Bei männlichen Universitätsabsolventen lag die Zahl bei 36,6 Prozent, bei weiblichen über 50 Prozent. Hochschulabgänger mussten als Taxifahrer arbeiten, Doktoren Gemüse verkaufen, Ingenieure sich als Straßenhändler durchschlagen. Ähnliche Zahlen sind aus Tunesien, dem Sudan und anderen arabischen Ländern bekannt. Die Länder waren über Jahrzehnte von alten, mächtigen Eliten heruntergewirtschaftet worden, und wenn es in diesen Jahren doch einmal aufwärts ging, profitierte davon nur eine kleine Clique. In Ägypten etwa kontrollieren rund 490 Familien gut 25 Prozent des Volksvermögens. Jede dieser Familien verfügt durchschnittlich über ein Vermögen von 30 Millionen Dollar. In Tunesien sind es gerade einmal 70 Familien, die den Kuchen unter sich aufteilen. Kein Wunder also, dass die Bewegung »6. April« schnell Anhänger fand und später eine zentrale Rolle auf dem Tahrir-Platz spielen sollte.
Zwischen den ägyptischen und tunesischen Aktivisten hatte es schon in den Jahren vor 2011 einen regen Erfahrungsaustausch gegeben, um sich auf den Tag X vorzubereiten. Wie kann man sich der Überwachung durch den Sicherheitsapparat entziehen? Wie mit Folter umgehen? Wie kann man sich vor Tränengas schützen? Wie die sozialen Medien einsetzen? Das waren einige der Fragen, die man auf Facebook diskutierte. Verbindungen gab es auch in den Sudan, wo es bis zum Umsturz allerdings noch fast zehn Jahre dauern sollte. Schon am Vorabend der Erhebungen im Dezember 2010 und Januar 2011 war so etwas wie eine panarabische Jugendbewegung entstanden.
Ahmed Maher sagte mir 2011 weitsichtig: »Die Rolle des Militärs ist überhaupt nicht klar. Wir wissen nicht, was sie wollen. Sie regieren mit Dekreten ohne jede Kontrolle. Wir werden sie genau beobachten. Und wir verlangen, dass das Militär nach den Wahlen in die Kasernen zurückkehrt. Aber ich misstraue ihnen.«
Sein Misstrauen war mehr als berechtigt. Als Erstes verordnete der neue Militärrat 2011, das Demonstrationsrecht einzuschränken. Statt die neu erkämpften Freiheiten zu verteidigen, knüppelten Militärpolizisten jetzt auf Demonstranten ein. Festgenommene Frauen wurden mit Schlägen und Elektroschockern gefoltert. Gefängniswärterinnen forderten die Frauen auf, sich für die Leibesvisitation nackt auszuziehen, während feixende Soldaten zuschauten und Fotos machten. Man zwang Frauen sogar zu einem sogenannten »Jungfräulichkeitstest« und beschimpfte sie als Prostituierte.
Auch gab es wieder Tote und Verletzte. Blogger, die die Militärgewalt kritisierten, wurden verhaftet und von Militärgerichten zu hohen Haftstrafen verurteilt in Gerichtsverfahren, bei denen es keine Berufungs- und kaum Verteidigungsmöglichkeiten gab. Bis August 2011 ließ der Oberste Rat der Streitkräfte, die De-facto-Regierung des Landes, etwa 12000 Jugendliche in Schnellverfahren verurteilen. Dreizehn wurden laut Amnesty International zum Tode verurteilt.
Dennoch war Ahmed Maher damals davon überzeugt: »Wir haben das Recht, jeden Offizier zur Rechenschaft zu ziehen, der für Willkür oder gar Folter verantwortlich ist. Es ist sogar unsere Pflicht.«
Auch Theatermacher und Schauspieler versuchten damals mit ihren Mitteln Widerstand zu organisieren. Eine von ihnen war Laila Suleiman – Theaterregisseurin und Autorin. 2011 hatte sie ein dokumentarisches Theaterstück geschrieben, das sich vor allem aus Zeugenaussagen Verhafteter zusammensetzt. Auf der Bühne sieht man A. im Interview mit einer Journalistin:
A.: Sie haben mich zu Boden geworfen, dass ich glaubte, ich könnte nicht mehr aufstehen.
Journalistin: Die Menschen haben aber doch immer gesagt: Armee und Volk sind eins!
A.: Daran glaubt heute kaum noch einer. Ein Offizier ist auf mich gesprungen, immer wieder, auf jeden Teil meines Körpers. Sie haben mich zu Boden geworfen und an den Haaren wieder hochgezogen. Ein Soldat hat mich mit einem Stock verprügelt. Andere traktierten mich mit Elektroschocks.
Der Schauspieler Ali Sobhi hatte sich damals selber gespielt, erzählte er mir nach der Vorstellung. Zwei Wochen war er in der Gewalt der Militärs: »Das Schlimmste in der Haft war für mich, dass sie auch Kinder festgenommen hatten. Auch die Kinder wurden geschlagen und gefoltert mit Elektroschocks. Die ältesten Jugendlichen waren gerade mal sechzehn Jahre alt.«
Kaum einer der Gefolterten wagte es, sich an die Öffentlichkeit zu wenden, aus Angst, wieder verhaftet und erneut misshandelt zu werden. Der Sänger und Liedermacher Ramy Essam war einer der wenigen, die den Mut aufbrachten. Am 9. März, also einen knappen Monat nach Mubaraks Rücktritt, war er auf dem Tahrir-Platz verhaftet worden. Am helllichten Tag. Auf einer auf dem Platz errichteten Bühne hatte er ein selbst verfasstes Spottlied auf den Militärrat gesungen. Die Demonstranten waren begeistert und jubelten. Doch plötzlich stürmten Soldaten den Platz, bewaffnet mit Schlagstöcken. Dann – Knüppel frei. Eine Hatz auf friedliche Tahrir-Platz-Demonstranten begann. Hunderte wurden verletzt, Hunderte verhaftet. Unter ihnen auch Ramy Essam. Vier Monate später zeigt er in einer Fotoausstellung der Tahrir-Galerie des Goethe-Instituts, wie die Soldaten ihn zugerichtet haben. Das Gesicht geschwollen und voller Blutergüsse, der Rücken von Striemen überzogen. Als ich ihn damals traf, waren die Verletzungen einigermaßen verheilt. Seine Einstellung zum ägyptischen Militär hatte sich verändert:
»Ich habe gegen die Militärpolizei keinen Widerstand geleistet, weil ich dachte, die werden mich schon anständig behandeln. Was mir dann passiert ist, wurde von den Medien verschwiegen. Das Militär hat mich davor gewarnt, darüber zu sprechen. Ich habe diese Bilder trotzdem auf YouTube gestellt. Ich weiß nicht, wie es mit Ägypten weitergeht.«
Wie Ramy Essam ging es vielen Tahrir-Platz-Rebellen damals. Sie erlebten die tägliche Gewalt des Militärs und der Polizei, aber kaum einer konnte in diesem ersten Sommer des Arabischen Frühlings ahnen, dass es noch viel schlimmer kommen sollte. Das bei den Ägyptern traditionell hoch angesehene Offizierskorps geriet in die Kritik, doch genau die verbat sich das Militär. »Es gibt Unterschiede zwischen Kritik mit guten Absichten«, verkündete ein Armeesprecher schon am 11. April 2011, »und einer Kritik, die die Ideen der Armee infrage stellt. Mit der haben wir Schwierigkeiten.« Mit anderen Worten: Welche Form der Kritik die Offiziere dulden, entscheiden sie selber. Schon damals, wenige Monate nach dem Sturz Mubaraks, kündigte sich auf diese Weise das Scheitern der Rebellion an.
Nach den Wahlen 2012 zog sich das Militär zwar zurück, doch genau betrachtet nur zum Schein. Selbst dem zum Präsidenten gewählten Muslimbruder Mohamed Mursi gelang es nicht, die widerspenstigen Offiziere an die Kandare zu nehmen. Keiner der vielen Verfassungsentwürfe dieses Jahres wagte es, die Macht des Militärs zu brechen. Weiterhin würden hohe Militärs Sonderrechte wie etwa rechtliche Immunität genießen. Weiterhin würden sie ihre Wirtschaftsimperien führen können. Und weiterhin würde der Militärhaushalt keiner parlamentarischen Kontrolle unterworfen werden. Ebenso verboten waren Ermittlungen gegen Offiziere, die Prügeleinsätze auf dem Tahrir-Platz kommandiert hatten.
Dass der Traum einer liberalen Demokratie, für die Jungrevolutionäre wie die des »6. April« 2011 gekämpft hatten, schon 2012 scheiterte, dafür waren jedoch nicht nur die Militärs verantwortlich, sondern ebenso die regierenden Muslimbrüder und ihre Verbündeten, die Salafisten, die im Parlament immerhin 25 Prozent der Stimmen bekommen hatten.
»Brot, Freiheit und soziale Gerechtigkeit« war der Slogan der säkularen Aktivisten gewesen. »Freiheit, soziale Gerechtigkeit und Gleichheit« hatte zwar auch die Partei, die diesen Slogan im Namen trug – die »Freiheits- und Gerechtigkeitspartei« der Muslimbrüder –, verkündet, doch nach dem Verfassungsentwurf, den sie im Oktober 2012 vorstellten, sollte das gesamte Rechtssystem den religiösen Scharia-Vorschriften unterworfen werden. Den Religionsgelehrten der Al-Azhar-Universität war sogar ein Kontrollrecht im Gesetzgebungsverfahren eingeräumt worden. Laut diesem Verfassungsentwurf sollten die Frauen vor dem Gesetz weiterhin gleichgestellt sein, doch innerhalb der Familie waren sie zu Gehorsam ihren Ehemännern gegenüber verpflichtet. Sie sollten arbeiten können, aber nur wenn sie dabei ihre familiären Pflichten nicht vernachlässigten. Das also verstanden die Muslimbrüder unter »Freiheit« und »Gerechtigkeit«. In einem Referendum im Dezember des Jahres bekam diese Verfassung eine Mehrheit. Allerdings nahm nur ein Drittel der Wahlberechtigten teil.
Die säkularen Aktivisten vom Tahrir-Platz waren empört. Dafür waren sie nicht auf die Straße gegangen. Kein Wunder also, dass sie sich von dem Präsidenten abwandten, den sie während des Wahlkampfs im Frühsommer 2012 noch unterstützt hatten.
»Wir haben damals Mursi unterstützt, weil der einzige Gegenkandidat ein Mubarak-Getreuer war. Gleichzeitig haben wir Mursi davor gewarnt, dass er so enden werde wie Mubarak, sollte er dessen Methoden übernehmen. Die Ermahnungen von uns Aktivisten hat er jedoch ignoriert und stattdessen versucht, die Macht zu monopolisieren«, so Ahmed Maher 2013 gegenüber dem Nachrichtenportal Qantara. Als Mursi immer autoritärer regierte und sich auch nicht scheute, Demonstrationen gegen ihn von der Polizei gewaltsam zerschlagen zu lassen, schlossen sich junge Ägypter wieder zusammen zu einer Bewegung, die sich »Tamarod« nannte – »Rebellion«. Sie gingen auf die Straßen und forderten seinen Rücktritt. Wieder war es das Militär, das geduldig zusah und offensichtlich auf seinen Einsatz wartete.
Nach wochenlangen Demonstrationen war es soweit. Am 3. Juli 2013 putschte das Militär gegen den amtierenden Präsidenten, verhaftete ihn und viele seiner Anhänger. Sechs Jahre später starb Mohamed Mursi im Gefängnis. Was anfangs aussah wie ein Feldzug gegen die Muslimbrüder, wurde bald zu einer Jagd auf alle Gegner dieser Machtergreifung. Es ging gegen Islamisten ebenso wie gegen Liberale. Jeder, der verdächtigt wurde, gegen den neuen Machthaber, den General Abdel Fattah al-Sisi, opponieren zu wollen, riskierte, verhaftet zu werden.
Im November 2013 traf es Ahmed Maher und seine Freunde. Weil sie gegen ein neues Gesetz auf die Straße gingen, das die Reste der noch existierenden Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit abschaffen wollte, wurden sie verhaftet und auf der Grundlage ebendieses neuen Gesetzes zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Ahmed hatte sich geweigert, das neue Regime als legitime Regierung anzuerkennen, und hatte Neuwahlen gefordert, außerdem benutzte er öffentlich das Unwort »Putsch«, um die Ereignisse vom 3. Juli zu beschreiben. Damit hatte er sich offen gegen das Regime gestellt. Ahmed verbrachte drei Jahre im Tora-Gefängnis, zusammen mit den Aktivisten und Mitgründern der Bewegung »6. April«, Mohamed Adel und Ahmed Duma. 2017 kamen sie frei, standen allerdings die nächsten drei Jahre unter Polizeiaufsicht. Normalerweise, so Mahers Anwalt Mohamed Gahin, wurden solche Auflagen nur bei Schwerkriminellen angeordnet.
Nicht viel besser erging es dem Musiker Ramy Essam. Nachdem 2013 seine Lieder von der neuen Regierung verboten worden waren, ging er ins Exil nach Skandinavien. Zurück nach Ägypten darf er nicht.
Aus dem Traum vom Tahrir-Platz ist ein Albtraum geworden, dessen Ende noch nicht absehbar ist.