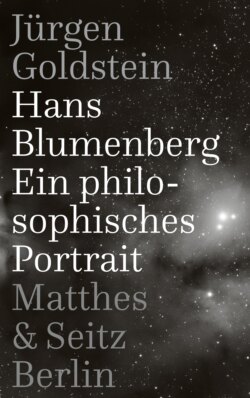Читать книгу Hans Blumenberg - Jürgen Goldstein - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Tradition und Ursprünglichkeit
ОглавлениеIn der Nacht vom 28. auf den 29. März 1942 wurde Lübeck durch Einheiten der britischen Luftwaffe über mehrere Stunden bombardiert. Es war das erste Flächenbombardement einer deutschen Stadt im Zweiten Weltkrieg. Die Folgen waren verheerend. Hunderte Tote und Verletzte waren zu beklagen, Tausende Lübecker wurden obdachlos. Ganze Straßenzüge der Altstadt brannten aus, auch die Marienkirche wurde schwer getroffen, vom Buddenbrookhaus in der Mengstraße 4 standen nur noch die Fassade und Seitenmauern. Thomas Mann zeigte sich aus dem fernen Amerika betroffen: »Das geht mich an, es ist meine Vaterstadt.« Aber er sah eine Logik des Ausgleichs am Werk, nach der »alles bezahlt werden muß«. So schlimm die Zerstörungen auch sein mochten, waren sie nicht gerecht? »Hat Deutschland geglaubt, es werde für die Untaten, die sein Vorsprung in der Barbarei ihm gestattete, niemals zu zahlen haben?« Er rettete sich auf seine Weise in eine Zukunft, die der Zerstörung der Barbarei folgen mochte, indem er konstatierte, »solche Trümmer schrecken nicht denjenigen, der nicht nur aus der Sympathie für die Vergangenheit, sondern auch aus der für die Zukunft lebt. Der Untergang eines Zeitalters braucht nicht der Untergang dessen zu sein, der in ihm wurzelt und der ihm entwuchs, indem er es schildert.«28 Im Zuge der britischen Luftangriffe, die das Ziel hatten, das Nazi-Regime in die Knie zu zwingen, versank auch das Elternhaus von Hans Blumenberg in Schutt und Asche. Im späten Rückblick hat er bekannt, dass er – seiner Geburtsstadt zeit seines Lebens tief verbunden – »den Untergang Lübecks in der Palmsonntagnacht 1942 in der Innenstadt ›erlebt‹ habe« und dass ihm »das Fanal der Wendung des Krieges damals wichtiger war als das vermeintlich endgültige Verstummen der Lübecker Orgeln«.29 Es ging um Rettung, nicht um Bewahrung. Der spätere Philosoph wusste aus eigener Anschauung, was ›Destruktion‹ gewachsener Tradition bedeuten kann und warum sie mitunter notwendig ist.
Eine jüngere Generation, die Blumenberg nie im akademischen Umfeld erlebt hat, kennt die Scheu nicht, näher auf seine frühen biographischen Umstände einzugehen. Blumenberg selbst ist diskret mit seinen Erfahrungen während des Dritten Reichs umgegangen – als man noch bei ihm studieren konnte, wusste man darüber nur Ungefähres, und das reichte einem. Er hat einmal von der »Unziemlichkeit der Neugierde der Epigonen« gesprochen, »die uns mit einer Wendung des Blicks konfrontiert, die vielleicht nur privatim erlaubt ist«.30 Ein philosophisches Portrait, das kein biographisches zu sein unternimmt, hat gegenüber den privaten Lebensumständen Zurückhaltung zu üben.
Dennoch gehe ich mit einer knappen Skizze auf die Lebensanfänge Blumenbergs ein, aus drei Gründen. Zum einen sind die Erfahrungen, denen er ausgesetzt war, nicht nur privat und somit intim. Blumenberg teilte die Erlebnisse von Krieg und Verfolgung mit vielen anderen seiner Generation, wenn auch jeder sie von einer anderen Warte aus erfahren hat: Hannah Arendt etwa, Dolf Sternberger, Jürgen Habermas oder Johann Baptist Metz. Der prägende Eindruck dessen, was man aller Dramatik entkleidet die ›geschichtliche Situation‹ nennen darf, hatte nicht nur individuelle, sondern eben eine generationenübergreifende Kraft.
Zum anderen hat Blumenberg selbst immer wieder in seinen Publikationen einzelne Bemerkungen im Zusammenhang mit der »größten bisherigen Sinnkatastrophe der Geschichte«31 fallen lassen. So etwa, als er im Fragebogen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Landung der Alliierten in der Normandie 1944 als die militärische Leistung benannte, die er bewundere; oder als er in einem Zeitungsartikel über Heideggers Verstrickung in den Nationalsozialismus auf sein eigenes Versteck in Lübeck zu sprechen gekommen ist, das ihm das Überleben sicherte.32 Über derartig eingestreute biographische Auskünfte hinaus finden sich auch ausdrücklichere Auseinandersetzungen mit den geschichtlichen Hintergründen seines Lebens: Ein zentrales Kapitel aus Lebenszeit und Weltzeit ist Hitler gewidmet, und Arbeit am Mythos enthält eine implizite Auseinandersetzung mit Carl Schmitt. Noch allgemeiner gewendet, merkt man der Philosophie Blumenbergs an, welche Erfahrungen ihr in den Knochen steckt. »Der Fliehende spürt im Rücken, was ihm nachsetzt«,33 heißt es einmal.
Schließlich sind die frühen biographischen Koordinaten Blumenbergs für das rechte Verständnis einer Ausdrucksschicht seiner beiden Qualifikationsschriften, der Doktorarbeit und der Habilitationsschrift also, unerlässlich. In ihnen hat Blumenberg den Stellenwert der Tradition und die radikale Erfahrung der geschichtlichen Erschütterung als ›Ursprünglichkeit‹ reflektiert und bis in die herangezogene Terminologie hinein sich seine zeitgeschichtlich bedingten Prägungen einzeichnen lassen.
Was also macht den biographischen Hintergrund aus, vor dem sich das geistige Profil dieses Autors abhebt? Der im Anhang der Doktorarbeit obligatorisch beigegebene Lebenslauf – eine der seltenen offiziellen biographischen Selbstauskünfte Blumenbergs – besticht durch das, was er unerwähnt lässt oder nur andeutet: »Geboren am 13. Juli 1920 zu Lübeck als Sohn des Kaufmanns J. C. Blumenberg, deutscher Staatsangehörigkeit, habe ich nach der Grundschule das Gymnasium des Lübecker Katharineums besucht und dort 1939 das Reifezeugnis erhalten. Sodann studierte ich scholastische und neuthomistische Philosophie, und zwar 1 Semester an der Philosophisch-theologischen Akademie in Paderborn und 2 Semester an der Philosophisch-theologischen Hochschule St. Georgen bei Frankfurt am Main, hier vor allem bei Caspar Nink. Nachdem ich 1941 mein Studium abbrechen musste, setzte ich meine Arbeiten, insbesondere auf dem Gebiete der mittelalterlichen Philosophie, bis 1943 privat fort. Dann nahm ich eine Tätigkeit in der Industrie auf. Nach Kriegsende brachte ich mein philosophisches Studium an der Universität Hamburg, vor allem bei Ludwig Landgrebe, zum Abschluss. Als Nebenfächer wählte ich Griechisch und Deutsche Literatur.«34 Diese knappen Ausführungen bedürfen einer Anreicherung und verdienen die eine oder andere Akzentuierung.35
Der Vater Josef Carl Blumenberg – von seiner Mutter ist nicht die Rede – war Kunsthändler, genauer: er handelte mit Radierungen und kirchlichen Devotionalien, Marienstatuen und Kunstdrucken von Marien- und Engelbildern. »In zahllosen Schlafzimmern hängen ehebettbreite Farbdrucke mit Engeln«,36 heißt es einmal in einem Text, an die rege Kaufmannstätigkeit des Vaters erinnernd. Die Familie Blumenberg stammte aus dem Bistum Hildesheim und verzeichnet etliche katholische Priester in ihrem Stammbaum. Blumenbergs Mutter Else, geborene Schreier, entstammte einer jüdischen Familie. Sie konvertierte vor der Hochzeit zum katholischen Glauben, was aber nichts daran änderte, dass ihr Sohn der Rassenideologie der Nazis zufolge als ein sogenannter ›Halbjude‹ galt. Nach dem frühen Tod seines jüngeren Bruders blieb er das einzige Kind. Drei Schwestern seiner Mutter wurden im Dritten Reich ermordet, darunter jene Tante, in deren Bücherbeständen der Nordpolbericht Nansens zu finden gewesen war. Blumenberg besuchte, wie vor ihm Thomas Mann, das Lübecker Katharineum. Als der dortige Direktor Georg Rosenthal, der den Nobelpreisträger 1931 nach Lübeck eingeladen hatte, 1933 von den Nazis abgesetzt wurde, bewirkte das im Quartaner Blumenberg »die unbestimmbare Wahrnehmung eines bedrohlichen Gewaltaktes, der an den Nerv der Schule gehen mußte«.37 Thomas Mann hatte mit dem Untertitel des Romans Buddenbrooks, der im häuslichen Bücherschrank stand, das Stichwort gegeben: Verfall einer Familie. »Da war etwas von einer möglichen Nähe der für exotisch gehaltenen Wendung des vermeintlich Beständigen zur Katastrophe. ›Verfall‹ konnte sich auch hier und jetzt abspielen«, nahm der Schüler erschrocken zur Kenntnis: »Dieser ›Verfall‹ kam von oben, und es gehört zu den lebenslang zu verarbeitenden Erfahrungen dessen, der gerade noch vergleichen konnte, daß es auch die wirklich gab, die sich nicht mitziehen ließen, die etwas zu bewahren hatten.«38 Darunter waren Klassenkameraden, aber auch Lehrer wie Wilhelm Krüger, Blumenbergs Deutsch- und Klassenlehrer bis zum Abitur. Der Nachfolger Rosenthals hingegen, Robert Wolfanger, war überzeugtes Mitglied der NSDAP, und mit ihm hielten antisemitische Schikanierungen Einzug, unter denen Blumenberg zu leiden hatte. Als Klassenprimus – er war der Jahrgangsbeste von ganz Schleswig-Holstein – stand ihm die Abiturrede zu, die er zwar verfassen, aber nicht vortragen durfte. Das Abiturzeugnis bekam er auf degradierende Weise, zum Direktor zitiert, ausgehändigt. Blumenberg war nach eigener Auskunft einer »Welle der Empörung«39 antisemitischer Art ausgesetzt, neben den Amtsträgern wohl vor allem durch die Parallelklasse. »Sie traf ihn als Schüler spät und prägte ihn für sein ganzes Leben«, erinnert sich der Schulfreund Martin Thoemmes, Blumenberg sei »buchstäblich bis zu seinem Tod stigmatisiert von den Demütigungen seiner Heimatstadt Lübeck«40 gewesen. Ein anderer Klassenkamerad berichtet, Blumenberg habe auf seinem täglichen Schulweg an einem Schaukasten des Stürmer vorbeigehen müssen, in dem zu lesen gewesen sei, Menschen wie er hätten kein Recht zu leben und müssten wie ›Ungeziefer‹ beseitigt werden.41
Nach dem Abitur begann Blumenberg im Wintersemester 1939/40 in Paderborn katholische Theologie zu studieren. Zum Sommersemester 1940 wechselte er an die Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen bei Frankfurt. Von seinen dortigen Lehrern hat er in seinem oben zitierten Lebenslauf nur Caspar Nink hervorgehoben. 1941 musste Blumenberg sein Studium infolge der verschärften rassenpolitischen Bestimmungen des Kulturministeriums abbrechen. Als ›wehrunwürdig‹ erklärt und somit nicht in die Wehrmacht eingezogen, setzte Blumenberg, wie es im Lebenslauf verharmlosend heißt, seine Arbeiten, insbesondere auf dem Gebiet der mittelalterlichen Philosophie, bis 1943 privat fort. Es folgte eine Beschäftigung im Werk des Lübecker Industriellen Heinrich Dräger, der ihm Arbeit und einen gewissen Schutz vor Verfolgung bot. Im Februar 1945 wurde Blumenberg verhaftet und zur Zwangsarbeit in das Lager der Organisation Todt – benannt nach dem Bauingenieur Fritz Todt, der im Dritten Reich unter anderem für die Erbauung des Westwalls und für die Schaffung von Reichsautobahnen zuständig war – auf dem Militärflughafen Zerbst nahe Dessau verbracht. Die Bedingungen im Lager glichen denen in einem Konzentrationslager. Blumenberg gelang die Flucht, als das Lager aufgrund der vordringenden Amerikaner aufgegeben werden musste, er schlug sich bis Lübeck durch. Bis zum Kriegsende konnte sich Blumenberg bei einer Lübecker Familie verstecken, der Ungewissheit ausgesetzt, wie lange er unterzutauchen gezwungen sein würde. Als der Terror endlich vorbei war, bedankte sich Blumenberg in einem Brief an Heinrich Dräger für dessen Schutz und Menschlichkeit und bemerkte, die »wohl schwersten Jahre meines Lebens«42 lägen hinter ihm. Ausgestattet mit 6000 Reichsmark, die Heinrich Dräger seinem Schützling zur Verfügung stellte, konnte Blumenberg 1945 in Hamburg das Studium der Philosophie, der Germanistik und der Klassischen Philologie aufnehmen. Das Geld war gut investiert.
Die biographischen Hintergründe sind aufschlussreich für Blumenbergs 1947 in Kiel eingereichte, von Ludwig Landgrebe betreute und zu Lebzeiten unveröffentlichte Doktorarbeit Beiträge zum Problem der Ursprünglichkeit der mittelalterlich-scholastischen Ontologie. Denn ihre Grundausrichtung nimmt bereits jene Spannung in sich auf, die sich durch die biographischen Verwerfungen ergaben, auch wenn man das weder dem Titel noch der Thematik auf Anhieb abzulesen vermag.
Bei der Dissertation handelt es sich um ein 107-seitiges, einzeiliges, schreibmaschinengeschriebenes Manuskript. Es fällt ins Auge, wie sehr Blumenberg bereits in dieser frühen Arbeit mit umfangreichen Bildungsbeständen der Tradition vertraut ist. Er argumentiert mit einer souveränen, wenngleich eklektizistischen Kenntnis der Geistesgeschichte von der Antike über das Mittelalter bis in die Gegenwart; schon während seiner Schulzeit verfügte Blumenberg über eine über 1200 Titel umfassende, vornehmlich mit theologischen Titeln bestückte Arbeitsbibliothek – sie wurde Opfer des Luftangriffes vom März 1942. Zugleich ist seine Untersuchung, die sich der mittelalterlichen Seinslehre widmet, von einer kognitiven Unruhe erfüllt, die der Unmittelbarkeit der existenziellen Situation zumindest einen indirekten Ausdruck zu verleihen sucht. Die Erfahrungen, die er im Dritten Reich hatte machen müssen, waren auch ein Angriff auf die Stabilität der Tradition, und für die Erschütterung suchte der junge Blumenberg nach einer Sprache. Er fand sie in der Philosophie Martin Heideggers.
Das mag aus heutiger Sicht überraschen. Doch als 1927 Heideggers Sein und Zeit erschien, war es – neben allen philosophischen Anstößen – zuallererst ein Sprachereignis. George Steiner hat darauf verwiesen, die tiefgreifende Krise nach dem Ersten Weltkrieg habe zwischen 1918 und 1927 eine ganze Reihe von Büchern hervorgebracht, »die anders waren als alles andere, was in der Geschichte des abendländischen Denkens und Fühlens zuvor produziert worden war«, und die ihrem Umfang und ihrem extremen Charakter nach »mehr als Bücher sind«:43 Ernst Blochs Geist der Utopie, Oswald Spenglers Untergang des Abendlandes, Karl Barths Kommentar zum Römerbrief, Franz Rosenzweigs Stern der Erlösung und eben Heideggers Sein und Zeit – Steiner lässt es offen, ob Hitlers Mein Kampf zu diesem Kanon expressionistischer Literatur hinzuzuzählen ist. Es sind für Steiner »gewaltsame Bücher«, und er zitiert als Beleg aus Barths Römerbrief-Kommentar: »Gott spricht Sein ewiges Nein zu der Welt.«44 Diese Bücher glichen literarischen Erdbeben, die im damaligen Leser Erschütterungen verursachten. Ihre Sprache stand bereit, der neuesten Katastrophe einen gebotenen Ausdruck zu verleihen.
Der junge Blumenberg fand in der ihm von Heidegger gebotenen Terminologie der ›Faktizität‹, der ›Nichtigkeit‹ oder der ›Geworfenheit‹ Ausdrucksformen, die er mit seinen Erfahrungen und denen seiner Generation zu füllen vermochte. Das moderne Bewusstsein, schreibt Blumenberg 1947, sei »nicht bei der Erfahrung seiner Selbstmächtigkeit stehen geblieben; im Gegenteil, es wurde zurückgeworfen in zuvor unbekannte Tiefen von Entmächtigung und Verzweiflung. Nichtigkeit, Geworfenheit und Faktizität wurden die beherrschenden Momente der existenziellen Selbsterfahrung. Dem um einen neuen Grund seiner Existenz verzweifelt ringenden Menschen blieb eine Erfahrung, ähnlich jener augustinischen von ›Wahrheit‹ in uns selbst, versagt. In seiner Geworfenheit wurde er immer nur auf sich selbst zurückgeworfen. In der verzweifelt angestrengten und atemlosen Bejahung der eigenen Faktizität suchte der Mensch Grund zu fassen, neue Selbstmächtigkeit zu erringen. Es blieb ihm nichts, als sich der Mündung entgegenzustürzen, in der endlich die Faktizität des Daseins versinkt: es blieb ihm die ›Entschlossenheit zum Tode‹. Es ist so die in der Selbsterfahrung des modernen Menschen erschlossene Verfassung der ›auf sich selbst geworfenen Existenz‹, die in Heideggers Existenzialanalyse ihre Auslegung fand – und in der sich zweifellos ein Zeitalter wiedererkennt.«45
Blumenbergs erregte Verwendung der Heidegger’schen Terminologie – in einer ansonsten eher spröden, scholastischen Diktion der Dissertation –, die er für eine Beschreibung seiner Erfahrungen im Dritten Reich heranzieht, freilich ins existenzialistisch Grundsätzliche gewendet, stellt keine ungebührliche Überstrapazierung des originären Wortgebrauchs dar. Blumenberg hat später mit Nachdruck darauf verwiesen, in Heideggers Sprache habe bereits die weltgeschichtliche Zäsur des Ersten Weltkriegs ihr Echo gefunden: »Dieses geschichtliche Ereignis hat die Grunderfahrung von der Unzuverlässigkeit lebensweltlicher Konstanten verschärft wie nichts zuvor, was auch sonst sich durch den Bruch mit dem 19. Jahrhundert verändert haben mochte. Darf man in dieser Frage Selbstaussagen überhaupt trauen, so wäre die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg die letzte gewesen, für die die Annahme fester und Generationen überdauernder Bewußtseinsbestände noch zutreffend gewesen war.«46 Insofern sei Heideggers Entdeckung des Zusammenhangs unter den Begriffen Sinn, Zeit und Geschichte unmittelbarer »Ausdruck der ersten Nachkriegswelt«.47
Das Sprachgewand, das Blumenberg seinen eigenen Erfahrungen umhängt – so ausgeliehen es erscheinen mag, um nicht gleich von ›Jargon‹ zu reden –, mag Ausdruck einer Verlegenheit sein, eigene Worte für das Unfassbare zu finden. Es ist aber nicht mit einer fugenfreien Übereinstimmung mit Heideggers Philosophie zu verwechseln. Darin besteht eine weitere Überraschung, die die Dissertation bereithält: Blumenberg argumentiert von Beginn an mit Heidegger gegen Heidegger. Mag auch sein späteres Verhältnis zum Denker des Seinsgeschickes ein äußerst distanziertes gewesen sein, das bis zur polemischen Abgrenzung reichte, in seiner Studie zur mittelalterlichen Ontologie ist es Heidegger, dem Blumenberg wegweisende Impulse verdankt, die in Paderborn und Sankt Georgen erarbeiteten Kenntnisse des mittelalterlichen Seinsdenkens aus der gegenwärtigen Situation heraus zum Sprechen zu bringen.
Hat man das spätere Werk des Philosophen im Blick, ist an der Dissertation bemerkenswert, wie stark Blumenberg in ihr von der philosophisch reflektierten Theologie des Mittelalters ausgeht, wie er sie bei Augustinus, Thomas von Aquin, Bonaventura und Duns Scotus vorfindet; er begreift sich in dieser Frühphase seines akademischen Werdeganges noch wie selbstverständlich als Ontologe. Zugleich dient ihm die kritische Auseinandersetzung mit der Fundamentalontologie Heideggers dazu, die mittelalterliche Ontologie auf Gegenwärtigkeit zu eichen, seine Darstellung mittelalterlichen Denkens ist »typologisch und nicht historisch«48 gemeint – Blumenberg unternimmt es, dem mittelalterlichen Denken Typen des Selbst- und Weltverständnisses zu entnehmen, mithilfe derer sich gegenwärtige Wirklichkeitserfahrungen fassen lassen sollen. Er sucht keinen Rückgriff auf mittelalterliche Traditionalität, um den Katastrophen der Gegenwart restaurativ zu entkommen, vielmehr prüft er, ob Innovationen des mittelalterlichen Denkens den gegenwärtigen Daseinserfahrungen standzuhalten vermögen. Ausdrücklich fragt er – mit Heidegger – nach der »Forderung und Leistung eines Neuansatzes der Ontologie als der Fundamentallehre der Wirklichkeitserfahrung«, denn »wie vielleicht niemals zuvor« seien »alle ›Einschlüsse‹ der Vergangenheit, alle formalen und gehaltlichen Bindungen an das Überholte infrage gestellt«.49 Der Versuch, mittelalterliches Denken innovativ für die Gegenwart aufzuschließen, ist für jene Zeit radikaler Umbrüche nicht so ungewöhnlich, wie es heute erscheinen mag: Karl Rahner revolutionierte die katholische Theologie durch eine Neuinterpretation der Theologie des Thomas von Aquin, indem er mit ihm eine neue Theologie der Welt beginnen ließ, auf die es der Gegenwart ankommen musste; sein Schüler Johann Baptist Metz ist ihm darin gefolgt, indem er eine Theologie nach Auschwitz entwarf. Es ließen sich also auch aus den Klassikern des Mittelalters Funken schlagen, die die gegenwärtige Situation zu erhellen vermochten.
Worum also geht es in Blumenbergs Dissertation? Auch wenn eine philosophische Schrift nicht allein auf Späteres gelesen werden sollte, möchte ich an einen zentralen Punkt heranführen, der sich leitmotivisch im weiteren Werk Blumenbergs fortsetzt: die theologische Lehre von der Schöpfung aus dem Nichts durch den freien und rational nicht verstehbaren Willen Gottes, der die Kontingenz der Welt begründet. Mit der Kontingenz kommt die Faktizität der geschichtlichen Erfahrung in den Blick, die es in ihrer Ursprünglichkeit zu erfassen gelte. Dies ist der kognitive Glutkern, auf den Blumenberg – gegen Heideggers Seinsgeschichte gewendet – verweist und der bis in die späteren Schriften wie der Legitimität der Neuzeit nachstrahlt.
Heidegger hatte Sein und Zeit damit eröffnet, es gelte – nach zweieinhalb Jahrtausenden Philosophiegeschichte – die Frage nach dem Sinn von Sein neu zu stellen: »Haben wir heute eine Antwort auf die Frage nach dem, was wir mit dem Wort ›seiend‹ eigentlich meinen? Keineswegs.«50 Nicht einmal eine Verlegenheit darüber stelle sich ein, den Ausdruck ›Sein‹ nicht zu verstehen. Heidegger hebt also an, die Frage nach dem Sein zu erneuern und die Zeit als möglichen Horizont eines jeden Seinsverständnisses anzunehmen. Die Tradition des Seinsdenkens seit Platon bis in die Gegenwart erweist sich ihm als eine Verdeckungsgeschichte, als ein Verfehlen der eigentlichen Frage, als Verfallsgeschichte, weshalb sich die Aufgabe einer »Destruktion der Geschichte der Ontologie«51 stelle. Wieder einmal nimmt eine Philosophie sich vor, eine verhängnisvolle Tradition abzuräumen, um mit dem Denken neu ansetzen zu können. »Soll für die Seinsfrage selbst die Durchsichtigkeit ihrer eigenen Geschichte gewonnen werden«, führt Heidegger aus, »dann bedarf es der Auflockerung der verhärteten Tradition und der Ablösung der durch sie gezeigten Verdeckungen. Diese Aufgabe verstehen wir als die am Leitfaden der Seinsfrage sich vollziehende Destruktion des überlieferten Bestandes der antiken Ontologie auf die ursprünglichen Erfahrungen, in denen die ersten und fortan leitenden Bestimmungen des Seins gewonnen wurden.«52
Blumenbergs Anliegen besteht nun darin, gegen das von Heidegger gezeichnete Bild vom abendländischen Seinsdenken als einer epochenübergreifenden Verfehlung die Beiträge des mittelalterlichen Denkens als Formen ursprünglichen Denkens zu verteidigen. Die Scholastik sei »nicht nur Vermittlung und Durchgang für das antike Erbe«, sie besitze eine »ausgeprägte ursprüngliche Eigenleistung«,53 die es wertzuschätzen gelte. In einer früheren Arbeitsfassung trug Blumenbergs Dissertation den das Ziel seiner Arbeit eindeutiger herausstellenden Titel Die Leistung der scholastischen Metaphysik, im Hinblick auf den ontologischen Ansatz bei Martin Heidegger; für die Publikation, die nicht zustande kam, hatte Blumenberg seinem Doktorvater, Ludwig Landgrebe, den Titel Tradition und Ursprünglichkeit. Studie zum geschichtlichen Sinn des mittelalterlichen Denkens vorgeschlagen.54 Was sich angesichts des Titels der eingereichten Dissertation Beiträge zum Problem der Ursprünglichkeit der mittelalterlich-scholastischen Ontologie wie ein Spezialproblem der mittelalterlichen Ontologiegeschichte ausnehmen mag, reicht thematisch weit über den mit dem Titel bezeichneten Gedankenradius hinaus und ist für Blumenbergs weiteres Werk von großer Aufschlusskraft. Erste Leitmotive klingen an: Gegen Heidegger verteidigt Blumenberg die Geschichtlichkeit der Geschichte; der mittelalterliche Gott Blumenbergs tritt als ein voluntaristischer, in seinen Schöpfungsabsichten freier Akteur auf die Bühne des Denkens; damit taucht der zentrale Begriff am Horizont des Blumenberg’schen Denkens auf, um den sein Werk kreist: die Kontingenz der Welt. Schon an diesen drei Denkmotiven lässt sich Blumenbergs früh einsetzender Umgang mit überkommenen Traditionsbeständen ablesen: Durch interpretatorische Zuspitzungen gelingt ihm eine Dramatisierung der Bewusstseinsgeschichte, deren erzeugte Prägnanz und problemgeschichtliche Kontinuität an Faszination gewinnt, wo es ihr mitunter an Differenzierung fehlt. Das lässt sich kurz anhand der Einführung dieser Motive in der Doktorarbeit zeigen.
Heidegger denkt nicht geschichtlich genug, so der Vorwurf, da er ein Schema des Niedergangs auf die abendländische Geschichte projiziert, das ihn für ursprüngliche Neueinsätze des Denkens unempfänglich macht. Wenn es aber gelingt, ursprüngliches Denken in der von Heidegger verfemten Tradition aufzuweisen, ist exemplarisch ihre Wertigkeit zurückgewonnen und die Geschichtlichkeit als Herausforderung ursprünglichen Denkens gegen den pauschalen Vorwurf der Verfallenheit verteidigt.
In einem ersten Schritt stimmt Blumenberg Heidegger zu, indem er die Gefahr einer Überlast der Tradition ausmacht, die eine gedankliche Bewältigung einer jeden Gegenwart erschwere. »In der Tat scheint keine Äußerung des menschlichen Geistes so belastet mit Tradition zu sein wie die Philosophie. Ihre Grundfragen und ihre Grundbegriffe gehen durch ihre mit der des Abendlandes zusammenfallende Geschichte in einzigartiger Kontinuität hindurch.«55 Ursprünglichkeit dagegen ist für Blumenberg »bezogen auf das Heute der lebendigen geschichtlichen Erfahrung und die diesem zugehörige ontologische Interpretation«.56 Zwar habe seine Gegenwart »ein so scharfes und betontes Erlebnis geschichtlicher Faktizität« gehabt, wie kaum eine Gegenwart zuvor, und sie habe die Erfahrung der »kurzatmigen Mutabilität ihrer Wirklichkeit mit so viel beharrlicheren und zur Dauer gewillten Kategorien des geistigen Verstehens zu bewältigen«, da sie die »Spannung von Erfahrung und Verstehen in einzigartiger Weise – man darf schon sagen: – erleidet«;57 dennoch ist das Phänomen der Ursprünglichkeit im Denken – und nun wendet sich Blumenberg gegen Heidegger – kein Gütesiegel allein der Moderne oder eines fernen Ursprungs. Ein jedes Denken in jeder Epoche zeichne sich dann durch Ursprünglichkeit aus, wenn der zugrundeliegende geschichtliche Wandel und somit die jeweiligen Gegenwartserfahrungen ohne verdeckende Engführung traditioneller Kategorien gedacht werden. Um diese Ursprünglichkeit in jeder geschichtlichen Situation zu erreichen, bedarf es einer Kritik, einer Destruktion der verhärteten Tradition als »verfestigtem Überkommen«.58 Ursprünglichkeit bezeichnet den »inneren wesenhaften Anspruch des Philosophierens« selbst, es ist »nicht ein kurzes, unnachhaltiges Aufblitzen am Beginn, sondern ein im philosophischen Verhalten immer wieder Andrängendes und Aufgegebenes«.59
Für Heidegger galt es, durch eine Destruktion der gesamten abendländischen Tradition zu einem ursprünglichen Seinsdenken vorzustoßen. Dazu nahm er Anlauf, die Tradition zu überspringen, um zur Originalität der Vorsokratiker zurückzufinden. Heideggers Ansatz ist so gewalttätig wie ihm die Geschichte des Seinsdenkens verfehlt erscheint. Für Blumenberg dagegen ist Heideggers Umgang mit der Tradition zu ungeschichtlich und blind gegenüber immer wieder auftauchenden Ursprünglichkeitsmomenten. Er erläutert das exemplarisch an der Scholastik, die für ihn aufgrund herausragender Denkinnovationen eine »paradigmatische Epoche«60 darstellt.
Um verstehbar zu machen, worin denn der originelle Beitrag dieses ›paradigmatischen Zeitalters‹ besteht, unternimmt Blumenberg zunächst eine Kennzeichnung jener traditionellen Deutungen des Seins, gegen die eine mittelalterliche Ursprünglichkeit errungen worden ist. Er verweist auf vier aus der Antike herkommende Seinsverständnisse, die nicht zureichen sollen, das Sein in seiner Geschichtlichkeit angemessen zu denken: Zu ihnen gehören das Sein 1. als ›Hergestelltsein‹ begriffen, 2. als ›Vorhandenheit‹ aufgefasst, 3. als ›Wesenheit‹ interpretiert und 4. als ›Gegenständlichkeit‹ verstanden. Diese Aspekte verlangten nach einer ausführlicheren Darstellung; ich beschränke mich auf Stichworte, die jenen Hintergrund, vor dem sich die Ursprünglichkeit mittelalterlichen Denkens profiliert, andeuten.
Schon Heidegger hat es als für ein angemessenes Seinsverständnis irreführend beschrieben, wenn Seiendes als Seiendes durch Rückführung auf ein anderes Seiendes in seiner Herkunft bestimmt wird. Blumenberg pflichtet ihm bei, »der Grund von Sein« ließe sich »nicht aufweisen im Zurückverfolgen des Herkunftzusammenhanges zwischen Seiendem«.61 Der Umstand, dass ich das Kind meiner Eltern bin, erklärt nicht den Grund meines Seins überhaupt.
Inbegriff des Hergestellten ist für Heidegger wie für Blumenberg das Vorhandene, das über benennbare Eigenschaften verfügt, das abgesetzt und in sich geschlossen, das Fall und Exemplar einer Gattung ist und dabei gleichsam nur einen »›Rest‹ der ursprünglichen Zugänglichkeit von Sein«62 darstellt.
Ebenso unzureichend ist die Bestimmung des Seins als Wesenheit, also als substanzartige, unveränderliche Washeit von Seiendem. Denn in dieser Denkart wird jeder individuelle Mensch zu einer Aktualisierung der Wesenheit ›Mensch‹; gerade das dabei unverstandene Moment der Existenz des Menschen als Dasein wird dabei verfehlt, oder um es anders zu sagen: Die Faktizität der Existenz kommt nicht angemessen in den Blick, solange ein essenzialistisches Denken die Blickrichtung auf das Seiende als einer Realisierung einer ungeschichtlichen Washeit vorgibt.
Schließlich ist es irreführend, das Sein mit Gegenständen zu identifizieren. Vergegenständlichung ist die fundamentale Leistung des wissenschaftlichen Verhaltens, die freilich um den Preis erkauft ist, die Transzendenz alles Seienden außer Acht zu lassen, ist doch die Welt als Horizont aller Gegenstände nicht selbst ein Gegenstand, vielmehr das »unvergegenständlichte ›Worin‹ der Dinge«.63 Alle vier Seinszugänge, nur das soll hier angedeutet werden, stellen Verengungen dar, Reduzierungen auf einen Aspekt und somit ein Verfehlen des Seins in seiner Ganzheit.
In einem zweiten Schritt entfaltet Blumenberg den Nachweis eines ursprünglichen Seinsdenkens im christlichen Mittelalter. Für Heidegger betrachtet die mittelalterliche Ontologie das Sein ganz traditionell als etwas Hergestelltes. In christlicher Lesart ist es Gott, der das Sein geschaffen hat, sodass es mit Blick auf seinen Schöpfer zu verstehen sein soll. Damit bleibe das Mittelalter gefangen in den Grenzen antiken Seinsdenkens, denn »Geschaffenheit … im weitesten Sinne der Hergestelltheit von etwas«, heißt es bei Heidegger, sei »ein wesentliches Strukturmoment des antiken Seinsbegriffes«.64 Blumenberg dagegen widerspricht, es sei schon der im Alten Testament ausgebildete Schöpfungsgedanke einzigartig, und es ist für ihn Augustinus, der dem Denken einer »absoluten Seinssetzung«65 einen theologischen Boden bereitet hat. Heidegger unterschätze und verharmlose die Theologie der Schöpfung, da er sie vorschnell auf antike Denkweisen zurückführe, ohne deren Originalität in den Blick zu nehmen: »Der Schöpfer ist nicht äußerstes Erklärungsprinzip oder gar nur letzte metaphorische oder mythische Zuflucht des Fragens, sondern Person von der ganzen Dichte bezeugter Wirklichkeit. Schöpfung ist erfaßt als das aus der Tiefe der personalen Spontaneität hervorgehende, im willentlichen Entschluß ansetzende Tun Gottes. Schöpfung ist deshalb letztes Woher des Gründens, über das hinaus es kein Rückfragen gibt. Sie ist willentliche Setzung, und damit ist der Seinsgrund selbst willentlich. Alle deutenden Zugriffe, ihn zu rationalisieren und motivieren, müssen an dieser absoluten Willentlichkeit scheitern.«66
Damit hat Blumenberg ein Motiv eingeführt, das die Antike so nicht gekannt hat: die Uneinsehbarkeit des Willens, der sich jeder Rationalisierung seiner Motivation entzieht. In Platons Timaios hatte der Demiurg als der Weltschaffende auf die ewigen Ideen als zeitlose Vorbilder geschaut, für Aristoteles war der Kosmos ungeschaffen und ewig. Erst für Augustinus wird das Sein radikal abhängig vom schöpferischen Willen eines Gottes, der mit dem Senkblei der Vernunft nicht zu ergründen ist. Das klassische Herstellungsschema ist damit durchbrochen, nach dem das eine durch seine Herkunft vom anderen verstanden werden soll. Die Radikalität dieses Seinsbeginns hat bei Augustinus ihren Ausdruck in der Rede von der ›Schöpfung aus dem Nichts‹ gefunden, der creatio ex nihilo. Der anthropologische Hintergrund dieses Denkens ist die spontane Kraft des menschlichen Willens, die so uneinsehbar ist wie die Gottes. Was in dem Seinsdenken des Augustinus vorliege, sei somit »keine Synthese antiker und christlicher Konzeptionen«, vielmehr gelte, »daß hier ›von Grund auf neu‹ gefragt und philosophiert wird, ohne daß freilich ein Bruch der Geschichtlichkeit auftritt«,67 die Innovation verbirgt sich gleichsam unter der Oberfläche einer durchgehaltenen traditionellen Kontinuität.
Die christliche Erfahrung von Personalität aufgrund der Freiheit des Willens, sowohl des Menschen als des Gottes, ist für Blumenberg ein so neues und nachantikes Motiv, dass es nach einer ursprünglichen Vergewisserung verlangte. Man denke nur an die autobiographischen Bekenntnisse von Augustinus, die Confessiones, die ein Zeugnis der Rechenschaft über den individuellen Lebensverlauf in epochalem Maßstab darstellen. Dabei gilt für Blumenberg als ausgemacht, dass das Individuelle »für die unmittelbare Erfahrung das Erstgegebene und als solches Fraglose« ist, unsere philosophische Tradition aber sei »von Anfang an bestimmt durch die Verwunderung über die Möglichkeit des Begriffs in seiner Allgemeingültigkeit«.68 Alles Individuelle sei daher lediglich als ein exemplum eines Allgemeinen begriffen und in seiner Einzigartigkeit verkannt worden. Der Zusammenhang des individuellen Willens und der Personalität ist erst dem mittelalterlichen Denken aufgegangen.
Bereits hier taucht eine Lesart auf, die für Blumenbergs weitere Studien zum Mittelalter und zur Genese der Neuzeit bestimmend sein sollte: Für ihn ist Gott nicht zuerst absolute Vernunft, sondern absoluter Wille. Blumenberg verfolgt daher nicht zuerst die Geschichte des theologischen Intellektualismus, sondern die des Voluntarismus. Eine der zentralen Auskünfte ist für ihn daher die Antwort des Augustinus auf die Frage, warum Gott die Welt geschaffen hat: Quia voluit, weil er es wollte!69 Das bedeutet, »daß die Frage nach dem Seinsgrund nicht wiederum auf Seiendes zurückgehen kann, das heißt, daß das Gründen von Sein nicht nach dem Schema des Ursachenzusammenhanges zwischen Seiendem interpretiert werden darf«.70 Der uneinsehbare Wille Gottes entzieht sich ja jeder kausalen Dechiffrierung.
Daher ist die Welt nicht länger notwendig, sie ist auch nicht zufällig, sondern ›kontingent‹, ist sie doch vom freien Willen Gottes abhängig. Der Gedanke der Kontingenz der Welt ist ein zentrales Motiv der Doktorarbeit und der gesamten Philosophie Blumenbergs. Einen seiner Lexikonartikel hat Blumenberg dem Begriff der Kontingenz gewidmet und darin darauf verwiesen, Kontingenz sei »einer der wenigen Begriffe spezifisch christlicher Herkunft in der Geschichte der Metaphysik«.71 Damit ist eine nachantike Dramatisierung des Weltbezugs vollzogen, denn »die Welt ist kontingent als eine Wirklichkeit, die, weil sie indifferent zu ihrem Dasein ist, Grund und Recht zu ihrem Sein nicht in sich selbst trägt. Das Sein der Welt nimmt Gnadencharakter an. Der antike Kosmos war weder in seinem Ursprung noch in seinem Bestand einem absoluten Willensakt zugeordnet. Er war die volle Ausschöpfung des eidetisch Seinsmöglichen. Seitdem aber Augustin auf die Frage, warum Gott die Welt geschaffen habe, mit dem ›Quia voluit‹ geantwortet hatte, beruhte die Welt auf einem unbefragbaren Hoheitsakt.«72 Das christliche Mittelalter ist somit nicht – wie es Heidegger in seiner Verfallsgeschichte des Seinsdenkens insinuiert – eine Fortsetzung der Denkfehler der Antike mit anderen Mitteln, sondern ein Neueinsatz ursprünglichen Denkens, das der Wirklichkeitserfahrung gesteigerter Individualität, der Willensfreiheit und der spannungsvoll bedachten Kontingenz Ausdruck verliehen hat: »Die Reflexion des Mittelalters, zumal in seiner augustinischen Linie, ist geradezu angetrieben von dem Grunderlebnis dieses Kontrastes zwischen Faktizität und Kontingenz der Wirklichkeit, in der sich der Mensch vorfindet …«73 Geschichte ist eben keine starre Kontinuität, geleitet von Denkschablonen, vielmehr beweise das christliche Bewusstsein eine »volle ursprüngliche Kraft, aus der heraus Rezeption Einschmelzung und Aneignung bedeutet«.74
Der mittelalterliche Augustinismus, so die Annahme, hat die Statik des antiken Seinsdenkens erschüttert. Die Unterstellung einer im Grunde harmonischen Synthese von antiker und christlicher Ontologie unter dem Paradigma des Hergestelltseins ist eine verharmlosende Täuschung. Die Frage nach dem Seinsgrund, die Frage, warum überhaupt etwas ist, hat mit Augustinus eine ungekannte Zuspitzung erfahren. Daher ist es nur folgerichtig, dass der erstarkende Aristotelismus im 13. Jahrhundert die augustinische Ursprünglichkeit eines neuen Selbst- und Weltverständnisses zurückzudrängen unternahm. Blumenbergs Kronzeuge für diese Tendenz ist Thomas von Aquin. Gerade dasjenige, was die Neuscholastik an Thomas rühmen sollte – seine unternommene Synthese von antik-aristotelischem und christlich-theologischem Denken – weist für Blumenberg auf das »Problem des Seinsgrundes in seiner eigentlichen Krise«75 hin. Dabei sollte sich gerade zeigen, »wie sperrig sich die ursprüngliche Konzeption der Schöpfung gegen die aristotelische Systematisierung erwiesen hat und welchen Widerstand sie einer kosmologischen Nivellierung zu bieten vermochte«.76 Hier kam nicht zusammen, was zusammengehört, vielmehr sollte zur Einheit werden, was doch zu unterschiedlich war: Der unbewegte Beweger auf der einen, der personale Schöpfergott auf der anderen Seite, hier die Ewigkeit der Welt, dort die Schöpfung aus dem Nichts. Auf die Darstellung dieses Scheiterns der Hochscholastik, einer Vermittlung zwischen der antiken Metaphysik und der – bei aller terminologischen Kontinuität – ursprünglichen Schöpfungstheologie, wird Blumenberg in seinen späteren Studien größten Wert legen. Über Thomas heißt es aber schon in der Doktorarbeit, sein Versuch einer Vermittlung habe ihn »um die legitime Möglichkeit« gebracht, »den christlichen Schöpfungsgedanken im Gesamt seines Wirklichkeitsverständnisses wirklich ursprünglich zu verwurzeln«.77 Als Zeichen für dieses Zurückfallen hinter die bei Augustinus bereits erreichte Ursprünglichkeit des christlichen Denkens erweist es sich, dass Thomas die Verschiedenheit von Personen nur numerisch zu fassen vermag, also als Exempel einer Wesensform, ohne aber die radikale Singularität einer »qualitativen Individualität«78 angemessen erfassen zu können.
Dennoch ist das Gewonnene für Blumenberg nicht wieder verspielbar. Trotz des starken Einflusses des Aristotelismus ab dem 13. Jahrhundert ist die »Entfestigung der selbstverständlichen Hinnahme des Seins in der Grund-Frage … bleibend gewonnenes Fundament der Ontologie; es ist die endgültige … Transzendierung des kosmologischen Horizontes«.79 Bei Duns Scotus, »dem kritischen Geist der Hochscholastik«,80 könne nachvollzogen werden, »daß auch hier ein Bewußtsein dafür hervortritt, daß Seiendes und Seinsgrund nicht als einem Bewegungsganzen als kosmischer Einheit angehörend verstanden werden können«.81
Anstatt sich durch eine Herleitung von Seiendem aus Seiendem zu beruhigen, stehe das christliche Denken für eine »neue Unruhe«82 der Radikalisierung der Frage nach dem Grund des Seins. Das zeigt sich für Blumenberg an dem Denken Bonaventuras, einem Zeitgenossen des Thomas von Aquin. Der in der augustinischen Linie stehende Franziskanermönch habe eine von Aristotelismen »unbelastetere Vertiefung« der ontologischen Grundfrage geleistet, da bei ihm »das ganze Gewicht der Personalität des christlichen Gottes«83 zur Geltung komme. Der Seinsgrund ist für Bonaventura nicht eine selbstständig ablaufende kosmische Weltbewegung, sondern Folge »personaler Vorsehung«: »Die Weltbewegung ist die geschichtliche, nicht allein aus kosmologischen Kategorien verstehbare Entfaltung dieses entwerfend vorsehenden Willens.«84 Wenn der Entwurf der Welt der Personalität Gottes entstammt, steht der um Orientierung ringende Christ vor einem Gegenüber, »bei dem alles darum geht, mit wem es der Fragende ›zu tun hat‹«.85 Bei Blumenberg nimmt diese Frage einen bedrohlichen Unterton an, scheint doch die Antwort nicht durch einen offenbaren Heilsplan vorversichert. Bereits hier diagnostiziert Blumenberg jene Spannung in der mittelalterlichen Theologie, an der sie wenige Jahrzehnte nach Bonaventura mit der Lehre vom verborgenen Gott zerbrechen wird – dem Leitmotiv der Legitimität der Neuzeit. Die »extreme existenzielle Situation« des Christen, sein göttliches Gegenüber einschätzen können zu müssen, gipfelt in dem von Blumenberg verwendeten Begriff des »eigenen Heilsschicksals«86 als zentraler christlicher Erfahrung. Gott ist »echte Spontaneität«87 und sein »Wille entscheidet zwischen Daß und Daß-nicht; darin erst wird Existenz vom unbefragbar Selbstverständlichen zum Faktischen, Gegründeten und deshalb Fragwürdigen. Von dieser gläubigen Erfahrung des absoluten Willens und von der inneren Erfahrung des in seinem Heil aufgegebenen ›Sum‹ her wird das philosophische Fragen nach der Existenz in Atem gehalten.«88
Unterhalb der Oberfläche der nüchternen Diktion mittelalterlicher Texte macht Blumenberg also eine Dramatik aus, deren Hervorhebung schon in seiner Doktorarbeit zu einem Kennzeichen seiner Hermeneutik geschichtlicher Problemgeschichten wird. Es sei durchaus nicht leicht, gesteht er, »in der Starrheit der mittelalterlichen Schulformen und Denkschemen einer ursprünglichen Problembenommenheit wirklich gewahr zu werden«.89 Blumenberg steigert somit zu einer Prägnanz, was so in den Texten oftmals nicht steht. Die Intensität des erfahrenen Dramas um das eigene Schicksal, die Aufwertung der geschichtlichen Situation, die Unhintergehbarkeit personeller Einzigartigkeit – all das sind Motive, die Blumenberg am mittelalterlichen Denken durchbuchstabiert, um sich einen Reim auf die eigenen Gegenwartserfahrungen machen zu können. In der Zuspitzung der scholastischen Ontologie auf die Frage von gnadenabhängigem Sein oder Nicht-Sein spiegelt sich ein modernes Bewusstsein der unmittelbaren Kriegs- und Nachkriegszeit des je »auf sich geworfenen Selbst«.90 Blumenbergs Doktorarbeit ist daher zumindest auch ein zeitgeschichtliches Dokument der existenziellen Erschütterung in unmittelbarer Nähe zur erlebten Katastrophe. In ihr spiegelt sich die Willkür der biographischen Erfahrung in der Uneinschätzbarkeit eines absoluten Gottes, der sich nicht in die Karten blicken lässt, aber unser Heilsschicksal ist.
Damit kommen die Grenzen von Blumenbergs Doktorarbeit in den Blick. Die Interpretationen sind zuspitzend, ausblendend, fokussierend. Der theologische Voluntarismus, wie ihn Augustinus vertreten haben soll, erfährt eine äußerst starke Betonung, etwa bei dem geradezu isoliert herausgestellten Schöpfungsakt aus dem Nichts aufgrund des freien Willen Gottes. Die Verlagerung der platonischen Ideen in den Intellekt Gottes durch den Kirchenvater – und somit die von ihm gestiftete metaphysische Erkenntnisbrücke von Gott zu Mensch – bleibt dagegen ausgeblendet. Mit einem Wort: Das Bild, das Blumenberg vom vielschichtigen und biographisch sich wandelnden Augustinus zeichnet, ist »monumental einseitig«,91 wie der Augustinus-Kenner Kurt Flasch anmerkt. Überhaupt mutet die Auswahl der vier Kronzeugen – Augustinus, Thomas, Bonaventura, Duns Scotus – etwas eklektizistisch an. Vor allem der für die späteren Studien so wichtige Wilhelm von Ockham, ohne den der Umbruch des späten Mittelalters blass bleiben muss, fehlt noch ganz.
Doch die philosophische Leistung einer Selbstbehauptung überwiegt. Die von Blumenberg vorgelegte Studie setzt sich souverän wie kritisch von Heidegger ab, einem Denker, der trotz seiner politischen Verfehlungen die philosophische Szene noch beherrschte. Blumenberg leistet nicht allein eine diskrete Gegenwartsverständigung, er unternimmt es vielmehr, das Philosophieren als ein notwendigerweise ursprüngliches auf die jeweilige geschichtliche Situation zu verpflichten. Er übernimmt dazu von Heidegger die Emphase der Ursprünglichkeit, um sie doch alternativ zu bestimmen. Ist aber die Ontologie die rechte Leitdisziplin, um die Geschichtlichkeit der Geschichte des Menschen angemessen zu erschließen?
Bereits in der Dissertation deutet sich eine Wende an, die Blumenberg vollziehen wird und die eine Voraussetzung für sein späteres Werk darstellt. Schon im mittelalterlichen Umbruch des Seinsdenkens erkennt er den Ansatz einer anthropologischen Wende, die sich in der Aufwertung des Individuums andeutet: Wenn der Grund des Seins in der personellen Freiheit des göttlichen Willens ruht, dieser Wille aber rational uneinsehbar ist, bedeutet das zum einen eine Aufwertung des von Gott gewollten Individuums, das daher mehr ist als ein Exemplum, und zum anderen eine Abkopplung des menschlichen Selbstverständnisses vom Äußeren eines von Gott geordneten Kosmos. Der Umbruch in der Ontologie und der mittelalterlichen Lehre von der Schöpfung erzwingen eine Neuorientierung, denn es gilt, »vom Menschen aus die Welt und nicht von der Welt aus den Menschen in den Blick zu nehmen«.92 Es ist eine in die Neuzeit führende Entdeckung, »daß der Mensch in allen Fragen stets nur sich selbst in seinem Verstehen befragen kann«.93
Trotz anfänglicher Pläne, die sich zerschlugen, hat Blumenberg seine Doktorarbeit nicht publiziert. Man muss sie nicht gelesen haben, um den späteren Blumenberg zu verstehen, aber man versteht ihn besser, wenn man sie gelesen hat.