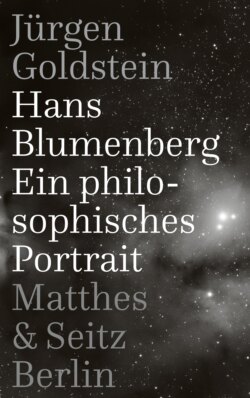Читать книгу Hans Blumenberg - Jürgen Goldstein - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorwort Portrait eines sich Verbergenden
ОглавлениеWie soll man ein Portrait von jemandem anfertigen, der sich nicht zeigen will? Der Philosoph Hans Blumenberg schätzte die Diskretion und forderte sie ein. Zu seinen Lebzeiten erlaubte er lediglich den Abdruck von zwei Fotografien, die ihn zeigen. Als Universitätsprofessor war er vor und nach den Vorlesungen für seine Studenten nicht ansprechbar. Zu öffentlichen Vorträgen ließ er sich in späteren Jahren nicht mehr bewegen. Nach der Emeritierung zog er sich gänzlich in seine private Gelehrtenhöhle zurück und reduzierte den Kontakt zu seinen Mitmenschen auf Briefwechsel und vornehmlich nächtliche Telefonate. Seine Bücher entbehren jeder privaten Einlassung: Keine Widmungen, private schon gar nicht, kein Dank an niemanden, auch nicht an jene, die an der oftmals aufwendigen Drucklegung beteiligt waren. Die Bücher stehen wie Monolithe in der akademischen Landschaft, und so sehr sie Diskussionen angestoßen haben, so wenig haben sie die Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Zeitgeist gesucht. Als Philosoph ist Blumenberg zunehmend in Deckung gegangen. Das war nicht immer so: Er war Gründungsmitglied einer der spannendsten Forschungsinitiativen der jungen bundesrepublikanischen Geisteswissenschaft, für die er den Namen erfand: Poetik und Hermeneutik. Dennoch frappiert der Umstand, es hier mit einem Philosophen zu tun zu haben, dessen Bedeutung in dem Maße gewachsen ist, wie sein Rückzug aus der Öffentlichkeit voranschritt.
Warum dann aber einem Portrait den Titel ›Hans Blumenberg‹ geben, wenn der Bezeichnete als Person sich zu entziehen suchte? Reichte es nicht, seine Werke auf zentrale Argumente und Thesen abzusuchen, diese darzustellen und zu diskutieren? Genügte nicht eine Auseinandersetzung mit den in ihnen behandelten Problemen? Wer auch nur einen Blick in eines der zahlreichen Bücher Blumenbergs geworfen hat, wird auf Anhieb bemerkt haben, wie sehr sich sein Denk- und Schreibstil vom akademisch üblich Gewordenen unterscheidet. Darin liegen sowohl ihre ungebrochene Anziehungskraft als auch die Schwierigkeiten, die man mit ihnen haben kann, begründet. Seine Bücher sind ungemein faszinierend und schwer zu lesen, äußerst anregend und zumeist umständlich, sehr stilbewusst und oftmals lang. Seine Philosophie bezeugt bis in die Feinheiten der Drucklegung der Bücher hinein ein ausgeprägtes Formbewusstsein. Dabei war dieser Autor ein Langstreckendenker, der überraschende Themen über viele Jahre und über Hunderte von Seiten verfolgte, und er war zugleich ein Meister der Miniatur. Blumenberg hat über Jahrzehnte einen unverkennbaren Personalstil ausgebildet. Seine Sprache besitzt einen ihr eigenen Klang, seine Denkwege eine ihnen eigene Typik. Darauf kommt es an: Blumenberg ist in seinem Werk auf eine sehr hintergründige Weise äußerst präsent. Der Kunsthistoriker Joseph Leo Koerner, mit dem Selbstportrait in der Malerei vertraut, hat auf die durchscheinende Persönlichkeit Blumenbergs in seinen Texten hingewiesen: Durch ihren »selbstreflexiven Charakter, durch die nachdrückliche Pflege eines persönlichen literarischen Stils, erhalten seine umfangreichen Veröffentlichungen alle Kennzeichen einer betonten, wenn auch unendlich abstrakten Subjektivität«.1 Das gesamte Werk Blumenbergs lässt sich als ein diskreter Selbstausdruck dieses Philosophen lesen. Das erlaubt ein philosophisches Portrait.
Um das Profil dieser Philosophie und die geistige Physiognomie ihres Denkers hervortreten zu lassen, werde ich das gesamte Werk heranziehen, von Blumenbergs frühen akademischen Qualifikationsschriften über die klassischen Hauptwerke bis zu seinen späten Nachdenklichkeiten über die von ihm gesammelten Anekdoten. Sämtliche Reflexionsfelder, die für ihn wichtig waren, werden dabei in ihrem Zusammenhang auf einer geistigen Landkarte einzuzeichnen sein: Blumenbergs Philosophie der Technik, seine Hinwendung zu einer Theorie der Lebenswelt und der Metapher, die Bewusstseinsgeschichte der Neuzeit als Abwehr eines übermächtigen Gottes und als Folge des Kopernikanismus, die anhaltende Bedeutsamkeit des Mythos, die Not der modernen Zeitknappheit, die Schwelle der Höhle als Realismuseingang und die heutige Hörbarkeit der Matthäuspassion Bachs – um nur die wichtigsten zu nennen. Zentrale Aspekte seiner Philosophie verlangen eine Darstellung in ihrem jeweiligen Zusammenhang: die Selbsterhaltung der Vernunft, der Absolutismus der Wirklichkeit, die Phänomenologie der Geschichte etwa. Zentrale Gestalten, um die dieses philosophische Denken kreist, sind im Koordinatensystem des Werkes zu verorten: Kopernikus und Galilei, Nikolaus von Kues und Giordano Bruno, Augustinus und Wilhelm von Ockham, aber auch Thomas Mann und Theodor Fontane, vor allem aber Heidegger und Husserl. Und von unvergleichlichem Rang: Goethe. Als Klammer dient mir Blumenbergs leitende Aufmerksamkeit für den Menschen, wie sie in der philosophischen Gestalt einer Anthropologie ihren Ausdruck gefunden hat.
Dabei gilt es stets zweierlei zu beobachten: was Blumenberg macht und wie er es macht. Neben den Abschnitten dieses Portraits, die sich den Themen seiner Bücher widmen, werde ich in eigenen Zwischenbetrachtungen die Charakteristika dieses Philosophierens herauszustellen suchen: die Physiognomie seiner Denkform, das versöhnende Glück der Theorie, den Selbstzweck der Quellen, die Humanität der Umständlichkeit, die Kunst der Auslegung und die Kultivierung der Nachdenklichkeit. Bei Blumenberg liegt nichts auf der Hand, oft nicht einmal, worum es in seinen Büchern geht. Oft ist der zweite Blick vonnöten, angereichert mit den Kenntnissen des übrigen Werkes und den Reflexionen über die Eigenarten der Herangehensweise. Nur mit einem Doppelblick auf den behandelten Gegenstand und auf die Art seiner Behandlung lassen sich Blumenberg und seine Philosophie profilieren.
Das Portraitieren hat eine dienende Funktion. Es zielt darauf, den Abzubildenden hervortreten zu lassen. Indem es aber Konturen verstärkt, das zu Erfassende ins rechte Licht setzt und Randständiges abblendet, mit der Perspektive arbeitet und auf Prägnanz setzt, verrät es den unweigerlich subjektiven Zugriff. Dennoch ist es nicht mein Ziel, Blumenbergs Philosophie zu beurteilen, sondern sie beurteilbarer zu machen.
Zwar hat dieses Portrait aufgrund des allmählichen Nachvollzugs der Gedankenlinien der Werke den Charakter einer Denkbiographie, aber es gilt sich zu vergegenwärtigen, dass bei Blumenberg die Publikationsfolge seiner Bücher oftmals nicht die Chronologie seines Denkens widerspiegelt. Die Anfänge mancher spät erschienenen Werke reichen viele Jahre zurück. Die Höhlenausgänge von 1989 etwa haben einen Vorlauf von mehr als drei Jahrzehnten. Zudem hat Blumenberg an verschiedenen Projekten zugleich gearbeitet und sie nebeneinander vorangetrieben. Das Erscheinungsdatum eines Buches sagt daher nur bedingt etwas aus über seine denkbiographische Verortung. Für postume Veröffentlichungen gilt dies insbesondere. Teile der Beschreibung des Menschen, 2006 aus dem Nachlass gehoben, gehen auf die späten Siebziger- und frühen Achtzigerjahre zurück, stellen also kein Alterswerk dar, obgleich sie erst spät veröffentlicht wurden. Für eine Leseanstiftung, als die sich dieses Portrait versteht, sind aber die Finessen der werkimmanenten Genese zweitrangig.
Ich halte es daher trotz aller Vorbehalte für sinnvoll, mit der Lizenz zur Abweichung, der Philosophie Blumenbergs weitestgehend anhand der Abfolge seiner Publikationen zu folgen. Das jeweilige Erscheinungsdatum – soweit es in Blumenbergs Hand lag – zeichnet sich dadurch aus, dass Blumenberg als der penible Autor, der er war, einen zu verschiedenen Zeiten wiederholt durchgesehenen Text für druckreif erachtet hat. Dieses Portrait favorisiert daher die Perspektive des Lesers auf die sich entfaltende Gebirgslandschaft der Philosophie dieses Denkers, nicht die des Autors aus seiner Binnenperspektive. Alles in allem lassen sich, wie ich meine, dabei Werkphasen behutsam voneinander abheben und der Bogen einer intellektuellen Biographie spannen.
Manches verdiente eine eigene, ausführliche Darstellung, die aber eine Spezialstudie verlangen würde: Blumenbergs Verhältnis zur Phänomenologie Husserls etwa oder seine Einbindung in den Arbeitskreis Poetik und Hermeneutik. Das kann und will dieses Portrait nicht leisten. Ebenso wenig strebt es eine Einbeziehung der inzwischen umfangreichen Literatur zu Blumenberg an. So wichtig diese Beiträge für das Verständnis des Werkes auch sein mögen, suche ich nicht die Auseinandersetzung mit ihnen. Das würde den Charakter – und den Umfang – dieses Buches zu sehr verändern und aus einem Einzelportrait ein Gruppenbild werden lassen.
Darüber hinaus hält sich dieses Portrait der leichteren Zugänglichkeit und Vergleichbarkeit mit dem Abgebildeten wegen vornehmlich an die publizierten Bücher, Aufsätze und Feuilletonbeiträge Blumenbergs – schon das ist mehr als genug. Briefwechsel ziehe ich in der Regel nur und sehr zurückhaltend heran, wenn sie bereits ediert vorliegen und somit inzwischen zum Bestandteil des publizierten Werkes zählen. Auf den umfangreichen, im Marbacher Literaturarchiv lagernden Nachlass Blumenbergs zuzugreifen, verzichte ich. Allein ein dort befindliches Konvolut an Kurzessays – mit der Abkürzung ›UNF‹ für ›Unfertiges‹ oder ›Unerlaubte Fragmente‹ –, die bis auf wenige Ausnahmen unveröffentlicht sind, umfasst Tausende von Seiten! Da dieses Portrait zur Lektüre verleiten will, hält es sich an die jedem leicht zugänglichen oberen Stockwerke des publizierten Werkes und überlässt das Durchforsten des Archivkellers anderen. Blumenbergs Doktorarbeit und Habilitationsschrift aber, wenngleich zu Lebzeiten unveröffentlicht, werden aufgrund ihres besonderen Gewichtes einbezogen.
Mein Portrait ist nicht für die Kenner geschrieben, die mit jedem Text Blumenbergs bis in die Fußnoten hinein vertraut sind. Es versteht sich eher als eine Handreichung für jene, die bei einem seiner Bücher ins Stocken geraten oder die Lektüre gar abzubrechen geneigt sind. Ein Überblick über die gedanklichen Verbindungen innerhalb eines Buches und zwischen den Publikationen ist oft nicht leicht und schon gar nicht auf den ersten Blick zu gewinnen. Das vorliegende Buch sucht Wege durch dieses Hochgebirge der Gelehrsamkeit und philosophischen Reflexion zu bahnen, dabei die verschiedenen Erkenntnisgipfel zu kartographieren, Ein- und Ausblicke zu ermöglichen, Rezeptionsabstürze zu verhindern und schließlich zum eigenen gedanklichen Bergsteigen im Werk dieses Philosophen anzuregen.
Blumenberg mochte nicht durchschaut, aber er wollte gelesen werden. In der Gestalt seines umfangreichen und vielschichtigen Werkes hat er uns gleichsam eine Lebendmaske seines scharfsinnigen, humorvollen, ausdauernden und von der Hinfälligkeit gequälten Geistes hinterlassen. Warum hinter diese Maske schauen wollen? »Der Mensch will sich mitteilen«, hat er bekannt, »aber dies setzt voraus, daß er verborgen und undurchsichtig ist, insoweit er es will und sich der Offenheit entzieht.«2 In seiner Philosophie – und nur in ihr – haben wir den Selbstausdruck Blumenbergs vor uns, den er aus der zunehmenden Verborgenheit heraus gesucht hat.