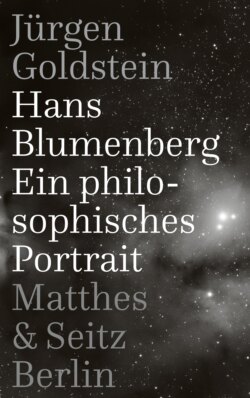Читать книгу Hans Blumenberg - Jürgen Goldstein - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung Der Zettelkasten
ОглавлениеSelten hat eine bedeutende Philosophie ein derart sinnlich zugängliches Fundament aufzuweisen, wie es bei Hans Blumenberg der Fall ist: Seine Werke, die Tausende von Seiten füllen, ruhen auf dem Grund von Abertausenden von Zetteln. Genauer gesagt handelt es sich um Karteikarten, mit handschriftlichen und auf Schreibmaschine getippten Zitaten, mit und ohne Kommentar versehen, um Karten mit aufgeklebten Ausschnitten aus Zeitungen und Zeitschriften und gefüllt mit eigenen Reflexionen. Sie stellen Dokumente einer über Jahrzehnte ununterbrochenen Lektüre- und Denktätigkeit dar und begründen ein akribisch gepflegtes Stichwortarchiv, das für die schriftstellerische Produktivität seines Nutzers nahezu unentbehrlich war.
Für die Ordnung der Karteikarten verwendete Blumenberg einen Rollenstempel. Die fortlaufende Nummerierung machte eine Chronologie seiner quellengeleiteten Gedankengänge über mehr als vierzig Jahre unmittelbar nachvollziehbar, wäre die numerische Ordnung des Zettelkastens von seinem Nutzer nicht zugunsten der kreativen Zusammenstellung der Karteien zu Themengruppen preisgegeben worden. Für seine Schreibprojekte entnahm Blumenberg einzelne Karten ihrer Entstehungsordnung, stellte sie zu thematischen Einheiten zusammen und versah sie mit Siglen – etwa ›AMY‹ für Arbeit am Mythos –, um aus diesen Neugruppierungen Texte und ganze Bücher erwachsen zu lassen. Jede derart genutzte Karteikarte wurde mit drei roten Schrägstrichen an der oberen rechten Ecke markiert und auf der Rückseite mit einem Vermerk zum Einsatzort des Exzerpts versehen. Eine zu häufige Verwendung und somit penetrante Wiederholung von Schlüsselfundstücken und Lieblingszitaten schloss Blumenberg aus, da er nach mehrfachem Gebrauch ganze Stapel an Karteikarten aussortierte und sorgfältig in Papier oder in Umschläge verpackte.
Blumenberg hat um 1941 mit der Erstellung von Karteikarten begonnen. Die erste Sammlung wurde Opfer eines Luftangriffs während des Zweiten Weltkrieges – später hat Blumenberg sein wertvolles Archiv einem feuerfesten Tresorschrank anvertraut. Über den jährlichen Zuwachs, die Gesamtzahl der Karteikarten und deren Verwendung legte sich Blumenberg penibel Rechenschaft ab. Am 1. August 1945 konnte er als Beleg des Neuanfangs 280 Karteikarten verzeichnen. Nicht ohne Stolz über seine erfolgreiche Arbeit im Bergwerk der Denkgeschichte präsentierte er im Frühjahr 1966 die zehntausendste Karte seinem langjährigen Mitarbeiter Karl-Heinz Gerschmann. Auch andere Autoren haben sich vor dem Aufkommen digitaler Speichermöglichkeiten des Systems über die Jahrzehnte angelegter Zettelkästen bedient – Niklas Luhmanns Zettelkasten ist legendär. Blumenbergs handgreifliche Gedankeninseln sind daher durchaus zeittypisch und an sich nicht ungewöhnlich. Der Umfang aber schon: Am 24. April 1984, im Jahr von Blumenbergs Emeritierung, beherbergten die Zettelkästen 24 000 nummerierte Karteikarten. Insgesamt enthält der Zettelkasten etwa 30 000 Exzerpte und Überlegungen.1
Der philosophische Reiz eines derartigen Gedankenarchivs besteht in der ermöglichten Variabilität seiner Bedeutungsfundstücke. Erst die Isolation eines Zitats von seinem ursprünglichen Kontext im Textfluss des Werkes, dem es entnommen worden ist, eröffnet das Spiel der überraschenden Kombination. Durs Grünbein hat mit Blick auf seine Poetik einmal von den »kleinen Entladungen« gesprochen, »die aus der Reibung gewisser elektrostatischer Wörter folgen«.2 Dieser Reiz, in einer Verszeile lustvoll Unerwartetes nebeneinanderzustellen, findet sich offensichtlich auch in Blumenbergs Umgang mit in Zitaten verdichteten Gedanken wieder: Wenn ein gegenwärtiger Autor mit einem mittelalterlichen Kollegen ›kurzgeschlossen‹ wird, wenn Husserl auf Platon trifft, eine Gedichtzeile auf ein Traktat, dann kann sich ein Funkenflug der Vernunft einstellen. In diesem Sinne gleicht die Arbeit mit einem umfangreichen Zettelkasten einer Alchemie des Geistigen: Die ungewohnte Zusammenstellung steigert das Herbeizitierte gegenseitig, verwandelt und wiederbelebt die Gedankenfunde. Eine solche Kombinatorik setzt eine Lust am Überraschungsmoment, ein sehr gutes Gedächtnis und eine Meisterschaft in der Zusammenführung des auf den ersten Blick oftmals heterogenen Quellenmaterials voraus.
Der souveräne Umgang mit Zehntausenden von Reflexionsinseln, die sich erst in der erzeugten neuen Textur als archipelartig und somit untergründig miteinander verbunden offenbaren, macht einen Teil dessen aus, was an Blumenbergs Texten so fasziniert: Mit Kommentaren und Verweisen von Hand ausgestattet, ermöglichten es die Karteikarten ihrem Nutzer, traditionsgesättigte Werke zu verfassen, in denen oftmals Zitate unterschiedlichster Herkunft aus entlegensten Winkeln der abendländischen Denkhistorie zu einer überraschenden problemgeschichtlichen Nachbarschaft gefunden haben. So werden Autoren und deren Texte im wechselvollen Nacheinander gruppiert: Schlägt man ein beliebiges Kapitel in einem Buch von Blumenberg auf, etwa »Apokalypse und Paradies« aus Lebenszeit und Weltzeit, weisen die Fußnoten die Apokalypse des Johannes, Jean Paul, Irenäus von Lyon, Michel de Montaigne und Arthur Schopenhauer als herangezogene Referenzquellen aus. Blumenberg denkt zusammen, was zusammengehört, aber durch Jahrhunderte, mitunter Jahrtausende voneinander getrennt ist. Darauf muss man erst einmal kommen, das biblische Motiv vom ›Buch des Lebens‹, in dem im Himmel die Taten der Menschen und ihr Heilsstatus verzeichnet werden, innerhalb weniger Seiten mit der Autobiographie von Jean-Jacques Rousseau in Beziehung zu setzen, schrieb doch der Genfer mit seinen Confessions selbst das Buch seines Lebens, um Rechenschaft abzulegen von seinen Taten.3
In der Stiftung einer Gedankenbrücke von der einen zur anderen Sinnfigur, vom einen zum anderen Zitat, beglaubigt sich die Souveränität des Zettelkastennutzers gegenüber seinem unermesslich scheinenden Material. Je rigider der methodische Zwang der Quellenarbeit ist, desto freier hat der denkerische Zugriff auf das Archiv zu sein, wenn das philosophische Denken nicht der Fülle an Zitierbarem erliegen und verkümmern soll. Doch wie frei darf der Umgang mit dem mitunter weit Auseinanderliegenden werden, damit den intellektuellen Edelsteinen, von ihren jeweiligen Horizonten und Kontexten gereinigt, keine Gewalt angetan wird, wenn sie in ein neues gedankliches Mosaik eingefügt werden?
Um Gefahr und Herausforderung ermessen zu können, die der philosophische Umgang mit Zehntausenden von isolierten Zitaten bedeuten, ist man gut beraten, bei der Bezeichnung ›Zettelkasten‹ zu bleiben, anstatt von ›Karteikasten‹ zu sprechen, auch wenn Blumenbergs Archivsystem aus Karteikarten besteht. Zettel und Karteien hängen ohnehin zusammen: In der antiken Welt bezeichnete das lateinische Wort scida oder scheda ein Stück, das man für Notizen von einem Papyrusblatt abriss, von flüchtiger Dauer, der Vorläufer des ›Zettels‹; die charta, aus der die ›Kartei‹ wurde, bezeichnete ein Papyrusblatt und ein Stückchen Papier für rasche Aufzeichnungen. Die Kartei als Informationsträger eroberte sich erst in den großen Bibliotheken der Moderne mit ihren vordigitalen Archivsystemen durch ihre Dauerhaftigkeit und den Vorzug der normierten Größe die Stellung des bevorzugten Formats. Bleibt man also beim Zettel als Hauptbegriff, bekommt die Gefahr des sich ›Verzettelns‹ einen Namen. Dieser Begriff entstammt ursprünglich dem Weberhandwerk: Der Weber arbeitet mit Kettfäden, auch Zettel genannt, um für das Gewebe eine Längsrichtung vorzugeben, zu der die Schussfäden quer eingeführt werden. Wer sich also verzettelt, kommt mit dem Gewirr an Fäden nicht mehr klar. Die Nähe zum Versinken in einer Unmenge an Notizen liegt auf der Hand. Für das aus den Zettelkästen Zusammengestellte besteht, wie Blumenberg es einmal formuliert hat, gleichermaßen die Gefahr, »wertvoll vom Gesichtspunkt der Materialsammlung, aber hilflos in der Interpretation«4 zu sein – die Anforderung an die deutende Interpretation wächst mit dem zu bewältigenden Quellenreichtum. Wie aber kann aus einer Zettelwirtschaft, trotz aller Verweissysteme und Übersichten, ein Textgewebe hervorgehen, das durch einen Erzählstrang zusammengehalten wird?
Ein weiterer Fallstrick beim Verzetteln der Tradition liegt in der Verwandlung des Lesers in einen Zitatenjäger. Da Blumenberg genauestens notiert hat, was er wann gelesen hat, werden auch Lektüreunterbrechungen offenbar. Mitunter legte er ein gelesenes Buch beiseite, um Jahre später an genau der Stelle der Unterbrechung wieder mit der Lektüre einzusetzen. Auch wenn man ein noch so gutes Gedächtnis unterstellt, lassen Bücher einen derart abrupten Umgang mit ihrer Gesamtkonzeption nicht zu. Der argumentative Bogen geht verloren oder wird erst gar nicht verfolgt, wenn man – wie Blumenberg mit Lineal und Stift bewaffnet – für das eigene Schaffen interessante Einzelstellen zu entdecken sucht. Blumenberg hat es aber auf eine Isolierung der Zitatfunde geradezu angelegt, nutzte er doch für das Exzerpieren von wissenschaftlichen Monographien keine zusammenhängenden Kladden für Notate. Der Reiz des auf einer Karteikarte Festgehaltenen bestand für ihn gerade in der Hervorhebung des Gedankenfundes durch Abschottung, die erst eine Zuweisung eines Ortes in einem neuen Gedankenkontext zuließ. Blumenberg besaß einen ausgeprägten Spürsinn für Quellen und ihr oftmals verdecktes Potenzial. Es wird vielen Lesern so ergehen, in seinen Werken auf Zitate zu stoßen, »über die man hinwegläse, brächte sie nicht ein Interpret wie Blumenberg zum Funkeln«.5 Angesichts der Herausforderung, die nicht so sehr die Erstellung, sondern vornehmlich der fruchtbare Umgang mit einem großen Archiv an Gedankensplittern darstellt, ist es durchaus bemerkenswert, dass Blumenberg an der Maßlosigkeit seines Zettelkastens philosophisch nicht zugrunde gegangen ist. Seine Philosophie bezeugt vielmehr durch ihre gedanklichen Kontinuitätsstiftungen, wie sie in den großen problemgeschichtlichen Narrativen ihren Ausdruck gefunden haben, eine intellektuelle Meisterung der Überfülle des bedenkenswerten Materials.
Zugleich gehört es zum Glück des Nutzers eines Zettelkastens, wenn sich die Verbindung zwischen zwei scheinbar weit auseinanderliegenden Gedankenmotiven wie von selbst einstellt, sobald man die Notizen nebeneinanderlegt. Erst die präparierende Hervorhebung und somit Kontextabschottung schafft jene verblüffende Verknüpfungsbereitschaft der Fundstücke, wenn etwa in dem Buch Lebenszeit und Weltzeit der Satz aus der Apokalypse des Johannes, der Teufel wisse, dass er wenig Zeit habe, als Vorbereitung für das folgende Kapitel über das Betreiben des Untergangs durch Hitlers Vernichtungswahn dient. Wer für eine derartige Geometrie von Sinnfiguren auch über große Zeiträume hinweg unempfänglich ist, wer nicht ins Staunen gerät, wenn das eine zum anderen findet und sich überraschenderweise fügt oder als gegensätzlich spiegelt, dem wird ein wichtiges Lustmoment der Schriften Blumenbergs verborgen bleiben. So eindrucksvoll der Zettelkasten in seiner materialisierten Gestalt auch ist – das philosophisch Spannende findet zwischen den einzelnen Karteikarten statt.
Aus dem Bodensatz der flachen Notizkarten hat Blumenberg ein Hochgebirge an gelehrten Büchern erwachsen lassen, die eine Geschichte der Gegenwart nachzeichnen. Sie suchen im Bildungskanon der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ihresgleichen. Das ist nicht ohne Anerkennung geblieben. Odo Marquard hat in Blumenbergs Werk – »trotz Adorno und Gehlen und Gadamer, trotz Lübbe und Habermas« – das »wohl faszinierendste Œuvre der Nachkriegszeit in Deutschland«6 ausgemacht. Eckhard Nordhofen nannte Blumenberg den »vielleicht gelehrtesten Denker des Landes«, für dessen Beschreibung man »eine eigene Klasse einrichten müßte«;7 für ihn sind Blumenbergs Bücher »gelehrte Schatzhäuser, reich und dick, die Bücher eines einzigartig Belesenen«.8 Henning Ritter zeigte sich beeindruckt von dem »Reichtum solcher Bildung in einem Umfang, wie sie sonst von kaum einem mehr produktiv beherrscht« werde, und der zu Leseerfahrungen führe, »für die es innerhalb der Philosophie keine Parallele«9 gebe. Es ist von »auf eine fast schon absonderliche Art gebildeten Büchern«10 gesprochen worden. Thomas Assheuer lobte seine »meisterhaften Deutungen«.11 Blumenbergs Schriften haben somit ein Echo ausgelöst – weit über die akademische Fachwelt hinaus, wie die genannten Feuilletonisten belegen –, das ihn als einen »der bedeutendsten deutschen Philosophen der Nachkriegszeit«12 auszeichnet. Damit nicht genug: Blumenbergs literarisch ambitionierter Stil hat zu einer Prosa geführt, die, wie manche meinen, »seit Thomas Mann im Deutschen unerreicht geblieben ist«.13 Nicht umsonst zählte Frank Schirrmacher Blumenberg zu den »führenden Schriftstellern des Landes«.14
Dem haben andere widersprochen. Ferdinand Fellmann hat stellvertretend für analytisch geschulte Geister kritisiert, Blumenbergs Stil wirke »stellenweise manieriert«.15 Die Germanistin Hannelore Schlaffer hat Blumenbergs Schreibstil, vor allem mit Blick auf den 1987 erschienenen Essayband Die Sorge geht über den Fluß, einer Grundsatzkritik unterzogen und Blumenberg als »dilettierenden Poeten« bezeichnet, der Adornos Stil – vor allem in Minima Moralia – »bis zur Verkrampfung«16 zu imitieren unternommen habe. Auch die sich in seinem Denken dokumentierende Gelehrsamkeit als Frucht seines Zettelkastens hat kritische Vorbehalte provoziert. Selbst Zeitgenossen, die Blumenbergs Leistung zu schätzen wussten, Karl Löwith etwa, monierten mitunter ein Missverhältnis von Anstrengung und Ertrag: »Wozu dieser Aufwand an scharfsinnigen Überlegungen« und an »ausgebreiteter historischer Bildung«?17 Nahezu wortgleich Kurt Flasch: »Warum diese vielen Wege? Wozu der ungeheure gelehrte Aufwand?«18 Weshalb also den mühsamen Durchgang durch die heranzitierte Geistesgeschichte wählen, wenn es doch auch ohne Exzesse an Quellenmaterial geht? Edmund Husserl oder Ludwig Wittgenstein kommen einem in den Sinn, sucht man nach Denkern, die – von Detailkenntnissen der Geistesgeschichte oftmals unbehelligt – nahezu zitatfrei philosophiert haben. Im Kern seien Blumenbergs Antworten auf die Fragen des Lebens recht einfach, urteilt Hermann Lübbe, aber Blumenberg verstecke das, »gleicherweise diskret wie trivialitätsscheu, hinter den Reichtümern seines überaus gebildeten Zettelkastens«.19
Sollte sich die stupende Gelehrsamkeit Blumenbergs als Prunk erweisen, um philosophische Dürftigkeit zu kaschieren? Wer in Münster studiert hat, konnte noch während seiner Lehrtätigkeit von einer unter den Studenten kursierenden und hinter vorgehaltener Hand kolportierten Frage hören, die dem Philosophen gestellt worden sei: Was würde er eigentlich tun, so die Provokation, wenn man all seine Zettelkästen auf dem Münsteraner Prinzipalmarkt ausschütten würde?
Härter hätte die Infragestellung nicht ausfallen können, grundsätzlicher nicht der Vorwurf. Mit einer einzigen Frage wird die genuine Produktivität dieses Philosophen, seine denkerische Impulskraft und systematische Souveränität, angezweifelt. Alles voll von Zitaten, mag man einen berühmten Satz des Thales variieren. Ein Beleg nach dem anderen, ein ermüdender Historismus an Gelehrsamkeit, Rezeptionsgeschichte statt Philosophie – so ist die Provokation zu lesen. Seit den Anfangstagen der Philosophie ist Sokrates, der nichts Geschriebenes hinterlassen hat, Inbegriff einer Frische des dialogischen Denkens, demgegenüber zitatschwere Texte gelehrter Autoren schnell behäbig wirken können.
Ich halte diese Kritik für falsch, aber fruchtbar. Man sollte ihr nicht vorschnell den Stachel ziehen, indem man – völlig zu Recht! – auf die umfangreichen Texte Blumenbergs verweist, die nahezu ohne den Gedankenfahrplan sortierter Karteikarten auskommen und die philosophische Kraft dieses Denkers mehr als belegen – man denke nur an die ausladende wie intensive Beschreibung des Menschen. Die vorgetragene Kritik aber zwingt dazu, die imponierende Materialität des Zettelkastens zurückzustellen und stattdessen über seine Bedeutung zu philosophieren. Solange man über ihn den Kopf schüttelt, da man den dafür notwendigen Arbeitseifer als eine Kompensation von Defiziten entlarven zu können meint, oder solange man voller Bewunderung auf ihn blickt, als hätte man den weltlichen Gral philosophischen Denkens vor sich, bleibt äußerlich, was doch der philosophischen Reflexion bedarf.
Auf die höhnische Frage, was das Ausschütten der Karteikarten auf dem Münsteraner Prinzipalmarkt für ihn bedeuten würde, hat Blumenberg nicht reagiert, zumindest ist mir keine Antwort zu Ohren gekommen. Gleichwohl lassen sich in seinen Texten Andeutungen finden, wie er den Angriff hätte parieren können. Blumenberg stemmt sich mit seinem gesamten Werk gegen die von ihm diagnostizierte gegenwärtige »Zeit der Verachtung von Gelehrsamkeit«.20 Er verweist auf die Folge von »Jahrzehnten entschlossener Destruktion klassischer Anteile am Bildungswesen«.21 Für ihn ein verheerender Vorgang, der die Reichweite unseres Denkens limitiert, denn: »Bildung ist kein Arsenal, Bildung ist ein Horizont.«22 Zeichen für die »intellektuelle Gesundheit« sei die »Spannweite von Unvereinbarkeiten im Hinblick auf ein und dieselbe Sache, die ausgehalten wird und dazu noch Anreiz bietet, Gewinn aus der Beirrung zu ziehen«.23 Der Zettelkasten als Archiv des widersprüchlich Gedachten wird zum Anlass geistiger Gymnastik und zum Instrument der eigenen Humanisierung, die darin besteht, Welt zu haben.
Vehement tritt Blumenberg daher der Naivität entgegen, die meint, auch in der Philosophie auf den sich aus der Tradition nährenden Bildungsreichtum verzichten und die Geschichte Geschichte sein lassen zu können. Dem »Vorteil der Authentizität durch Geschichtslosigkeit«, der Husserl und Wittgenstein als maßgeblichen Denkern der Moderne zugutezukommen scheint, stellt Blumenberg das »Risiko der Lächerlichkeit« entgegen, die in der »Verblüffung« besteht, »daß schon lange und vielgestaltig gesagt worden ist, was einer zum erstenmal gesagt zu haben meint«.24 Jedes noch so sehr auf Aktualität und Gegenwärtigkeit geeichte Denken verdankt sich für ihn einem gewachsenen Hintergrund seiner Ermöglichung, der oft nur ausgeblendet und mitunter nicht einmal bemerkt wird, aber in seiner konstituierenden Kraft vorausgesetzt werden muss. Daher ist Ungeschichtlichkeit für Blumenberg »eine opportunistische Marscherleichterung mit verhängnisvollen Folgen«.25 Wir haben nicht Geschichte, wir sind Geschichte: »Daß die Auswahl von Weltdeutungen, die Entscheidung unter Lebensformen bereits erfolgt ist, macht den Sachverhalt aus, Geschichte zu haben.«26
Als Repräsentanten für die Kultivierung einer vermeintlichen Geschichtslosigkeit führt Blumenberg Denker wie René Descartes an, der postuliert hat, für die Wissenschaften sei insgesamt überhaupt kein Gedächtnis nötig.27 Da Descartes auch die Philosophie zu den Wissenschaften zählte, sank für ihn auch die ihr eigene Tradition zu einem Hort zu überwindender Vorurteile herab. Noch Husserl wird als Cartesianer – in Blumenbergs Worten – ein »Geschichtsverächter«28 sein und die Jahrtausende als eine Vorgeschichte seiner Phänomenologie zusammenschnurren lassen. Größer könnte die Distanz Blumenbergs zu dem Protorationalisten der Neuzeit und Erneuerer des geschichtslosen Neuanfangs nicht sein. In seinem umfangreichsten wie vielleicht gelehrtesten Buch, Höhlenausgänge, betreibt Blumenberg mit großem Aufwand eine geschichtliche Umfeldanreicherung des platonischen Höhlengleichnisses. Dieser in Buchform gebrachte Anticartesianismus, die rationale als die kürzeste Verbindung zwischen zwei Gedankenpunkten auszuschlagen und stattdessen all die Um- und Abwege zu verfolgen, die das Höhlengleichnis durch die Denkgeschichte genommen hat, hat ihn drei Jahrzehnte Erinnerungsarbeit gekostet. Heidegger dagegen behandelte das platonische Höhlengleichnis, wie Blumenberg kopfschüttelnd anmerkt, »wie ein Vorsokratikerfragment: als habe man ringsum nichts«.29 Und während Blumenberg die mäandernden Denkwege des Menschen in seiner Geschichte in opulenten Werken abzuschreiten unternommen hat, kultivierte Wittgenstein in seinen Augen eine »Rhetorik der Kargheit« mit einer »apodiktischen Kürze seiner Sätze«.30 Blumenberg verweist auf Wittgensteins Pflichtvortrag als neues Mitglied des Cambridge University Moral Science Club im Jahr 1912, der die Frage »Was ist Philosophie?« zum Thema hatte und laut Protokoll nur vier Minuten gedauert hat.
Der Streit um den Nutzen und Nachteil des Zettelkastens für das Philosophieren – nur das möchte ich andeuten – ist kein äußerlicher, kein in persönlichen Animositäten aufgehender, sondern selbst ein philosophischer. Man kann es auch so sagen: Je sicherer man sich sein kann, Wahrheiten vorweisen zu können, desto eher kann man auf die Unmenge an Dokumenten des jemals Gedachten verzichten. Je mehr aber das andauernde Provisorium von Selbst- und Weltdeutungen anerkannt wird, desto spannender, hilfreicher und notwendiger werden die Auskünfte anderer und eben auch vormals Gewesener. Insofern ist Blumenbergs Zettelkasten auch ein materialisierter Ausdruck der anthropologischen Grundeinsicht, den Menschen als ein kognitives Mängelwesen zu begreifen, da ihm Wahrheit nicht leicht zugänglich ist und er dadurch erst den unersättlichen Appetit auf die Weltdeutung anderer bekommt. Platon hat keinen Zettelkasten angelegt.
Der Zettelkasten ist Ausdruck der Anerkennung einer unumgänglichen Umwegigkeit der menschlichen Selbsterkenntnis. Wo letzte Evidenzen nicht momentan erreichbar sind, setzen Ausführlichkeit und Umständlichkeit ein. »Über das Endgültige läßt sich nicht so viel sagen wie über das Vorläufige.«31 Umwegigkeit aber ist im Kern nichts anderes als Kultur, die wiederum in der Vermeidung der kürzesten Wege besteht. Erst die vielen, manchmal schon ausgetretenen und selten kurzen Wege, die gegangen werden, spannen ein Netz an Bewusstseinsrouten über unsere Welt. Damit kommen die anderen erneut ins Spiel: »Nicht jeder erlebt alles, wenn auf Umwegen gegangen wird; dafür aber auch nicht alle dasselbe, wie wenn auf dem kürzesten Weg gegangen würde. Andersherum: Alles hat Aussicht, erlebt zu werden, wenn es gelingt, alle auf Umwegen gehen zu lassen.«32 Darin besteht die Kostbarkeit alles von Menschen Erfahrenen, Gedachten und zum Ausdruck Gebrachten. »Jeder hat für jeden, den Voraussetzungen nach, etwas in pectore«, also unter Verschluss, »was nur er herauszugeben vermag und wodurch er Anspruch auf das erwirbt, was der andere seinerseits auf seinem Weg ad notam«, also zur Kenntnis, »genommen hat.«33 Jedes konservierte und präparierte Zitat auf einer von Blumenbergs Karteikarten ist Teil dieses humanen Tauschhandels mit Einsichten über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg. Jedes von ihnen ist eine Wegmarke einer gelebten und sich zum Ausdruck bringenden biographischen Bewusstseinsgeschichte.
Dabei ist der ideelle Tauschhandel mit Welterfahrungen unter den Bedingungen der Geschichte jenseits der Zeitgenossenschaft ein einseitiger. Der Textfund als ausdrückliches oder unausdrückliches Dokument eines humanen Wirklichkeitsverständnisses, das uns aus der Tiefe der Zeit erreicht, bereichert unsere Welthaltigkeit, ohne dass wir in der Lage wären, dessen Autor etwas von unserer Weltsicht zurückzugeben. Schon Bernard de Fontenelle hat in seinen Nouveaux dialogues des morts, die 1683 erschienen sind, eine Dankesschuld empfunden. In seiner Vorbemerkung wendet er sich an Lukian, den antiken Begründer des Genres der Nekrikoi dialogoi, der ›Totengespräche‹. Es sei nur billig, »daß ich, nachdem ich eine Idee aufgegriffen habe, die Euch gehört, Euch dafür auch eine gewisse Huldigung darbringe«.34 Das gilt auch für die erlaubten Einsichten in die Umwege anderer, denen wir ebenso eine ›gewisse Huldigung‹, quelque sorte d’hommage,35 schuldig sind.
Der Zettelkasten Blumenbergs, insofern er Zitate Verstorbener enthält, gleicht einem Friedhof des Gedachten, das in den Texten des Philosophen seine Auferstehung feiern soll. Das mag angesichts sonstiger pragmatischer Funktionsbeschreibungen pathetisch anmuten, doch Blumenberg selbst war – bei seltenen Gelegenheiten – das Pathos nicht fremd. Er hat von einer »elementaren Obligation« gesprochen, »Menschliches nicht verloren zu geben«.36 Es sei dabei »nicht Sache unserer Wahl, sondern des an uns bestehenden Anspruches, die Ubiquität des Menschlichen präsent zu halten«.37 In dieser anerkannten Verpflichtung drückt sich ein Humanismus aus, der die Arbeit mit einem so reichhaltigen Archiv über den Aspekt des Nutzens für seinen Besitzer erhebt.
Faktisch begrenzt, steht das Archiv zumindest symbolisch für die prinzipiell unabschließbare Verzettelung der gedachten Welt. Darauf verweist schon das Ordnungsprinzip der Kartennummerierung. Zwar sieht das numerische System eine erste, aber keine letzte Karte vor, könnte doch der Zählung nach stets eine weitere folgen. Es ist darüber hinaus ein leicht zu übersehender Aspekt, dass Blumenberg zwar im Nachhinein Karteikarten zu Themengruppen für seine Bücher zusammengestellt, aber eben nicht im Vorhinein gedankliche Schubladen entworfen hat, die dann lediglich noch mit passendem Material bestückt zu werden brauchten. Darin drückt sich eine Rezeptionsoffenheit aus, die ebenso unbedingt ist wie die Verpflichtung zur Erinnerung, zur memoria. Pathos und Nüchternheit, Ethos und Pragmatismus bestimmen Blumenbergs Umgang mit dem Zettelkasten gleichermaßen. Nichts ist randständig genug, zu abgelegen, zu skurril oder befremdlich, um nicht einen gleichrangigen Ort im Zettelarchiv der bewussten Welt zu finden – ebendiese Gleichwertigkeit als Dokument des Humanen bringt die normierte Karteikarte zum Ausdruck, die einem Wort Goethes kein anderes Format zuweist als einem Gedanken von Wilhelm Busch oder eines nahezu vergessenen Autors von den Rändern der intellektuellen Welt. »Die Ureinwohner Patagoniens ebenso wie die … Kwakiutl«, die Ureinwohner Vancouver Islands in Kanada, »haben einen Anspruch darauf, nicht nur am Leben gelassen zu werden, sondern auch von denen, die Theorie betreiben, theoretisch nicht vergessen zu werden, den Anteil an der Menschheit in ihrer Person gewürdigt und bewahrt zu sehen«.38
Das gilt für jeden. Blumenberg hat im begrenzten Feld seiner geistesgeschichtlichen Studien dem elementaren Wunsch des Menschen, nicht vergessen werden zu wollen, exemplarisch entsprochen. »Auch Geschichte der Philosophie, weiterhin Geschichte der Wissenschaften zu betreiben, kann nur eine der Formen sein, Anspruch auf die Achtung der Kommenden geltend zu machen, indem wir sie den Gewesenen erweisen.«39 Und sei es, indem man ihnen zunächst eine Karteikarte zuweist.